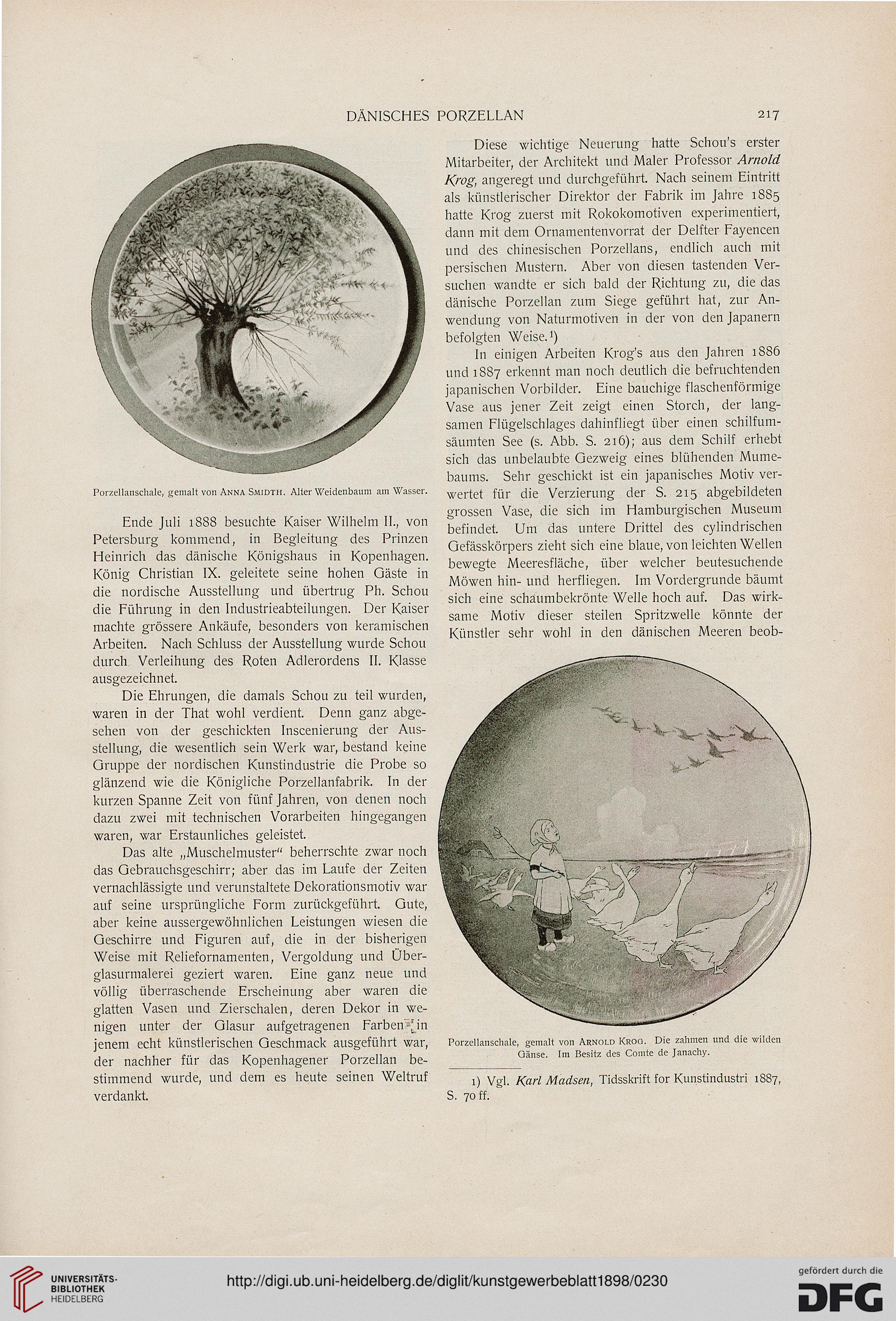DÄNISCHES PORZELLAN
217
Porzellanschale, gemalt von Anna Smidth. Alter Weidenbaum am Wasser.
Ende Juli 1888 besuchte Kaiser Wilhelm IL, von
Petersburg kommend, in Begleitung des Prinzen
Heinrich das dänische Königshaus in Kopenhagen.
König Christian IX. geleitete seine hohen Gäste in
die nordische Ausstellung und übertrug Ph. Schou
die Führung in den Industrieabteilungen. Der Kaiser
machte grössere Ankäufe, besonders von keramischen
Arbeiten. Nach Schluss der Ausstellung wurde Schou
durch Verleihung des Roten Adlerordens II. Klasse
ausgezeichnet.
Die Ehrungen, die damals Schou zu teil wurden,
waren in der That wohl verdient. Denn ganz abge-
sehen von der geschickten Inscenierung der Aus-
stellung, die wesentlich sein Werk war, bestand keine
Gruppe der nordischen Kunstindustrie die Probe so
glänzend wie die Königliche Porzellanfabrik. In der
kurzen Spanne Zeit von fünf Jahren, von denen noch
dazu zwei mit technischen Vorarbeiten hingegangen
waren, war Erstaunliches geleistet.
Das alte „Muschelmuster" beherrschte zwar noch
das Gebrauchsgeschirr; aber das im Laufe der Zeiten
vernachlässigte und verunstaltete Dekorationsmotiv war
auf seine ursprüngliche Form zurückgeführt. Gute,
aber keine aussergewöhnlichen Leistungen wiesen die
Geschirre und Figuren auf, die in der bisherigen
Weise mit Reliefornamenten, Vergoldung und Über-
glasurmalerei geziert waren. Eine ganz neue und
völlig überraschende Erscheinung aber waren die
glatten Vasen und Zierschalen, deren Dekor in we-
nigen unter der Glasur aufgetragenen Farben-,; in
jenem echt künstlerischen Geschmack ausgeführt war,
der nachher für das Kopenhagener Porzellan be-
stimmend wurde, und dem es heute seinen Weltruf
verdankt.
Diese wichtige Neuerung hatte Schou's erster
Mitarbeiter, der Architekt und Maler Professor Arnold
Krog, angeregt und durchgeführt. Nach seinem Eintritt
als künstlerischer Direktor der Fabrik im Jahre 1885
hatte Krog zuerst mit Rokokomotiven experimentiert,
dann mit dem Ornamentenvorrat der Delfter Fayencen
und des chinesischen Porzellans, endlich auch mit
persischen Mustern. Aber von diesen tastenden Ver-
suchen wandte er sich bald der Richtung zu, die das
dänische Porzellan zum Siege geführt hat, zur An-
wendung von Naturmotiven in der von den Japanern
befolgten Weise.1)
In einigen Arbeiten Krog's aus den Jahren 1886
und 1887 erkennt man noch deutlich die befruchtenden
japanischen Vorbilder. Eine bauchige flaschenförmige
Vase aus jener Zeit zeigt einen Storch, der lang-
samen Flügelschlages dahinfliegt über einen schilfum-
säumten See (s. Abb. S. 216); aus dem Schilf erhebt
sich das unbelaubte Gezweig eines blühenden Mume-
baums. Sehr geschickt ist ein japanisches Motiv ver-
wertet für die Verzierung der S. 215 abgebildeten
grossen Vase, die sich im Hamburgischen Museum
befindet. Um das untere Drittel des cylindrischen
Gefässkörpers zieht sich eine blaue, von leichten Wellen
bewegte Meeresfläche, über welcher beutesuchende
Möwen hin- und herfliegen. Im Vordergrunde bäumt
sich eine schaumbekrönte Welle hoch auf. Das wirk-
same Motiv dieser steilen Spritzwelle könnte der
Künstler sehr wohl in den dänischen Meeren beob-
Porzellanschale, gemalt von Arnold Krog. Die zahmen und die wilden
Gänse. Im Besitz des Comte de Janachy.
1) Vgl. Karl Madsen, Tidsskrift for Kunstindustri 1887,
S. 70 ff.
217
Porzellanschale, gemalt von Anna Smidth. Alter Weidenbaum am Wasser.
Ende Juli 1888 besuchte Kaiser Wilhelm IL, von
Petersburg kommend, in Begleitung des Prinzen
Heinrich das dänische Königshaus in Kopenhagen.
König Christian IX. geleitete seine hohen Gäste in
die nordische Ausstellung und übertrug Ph. Schou
die Führung in den Industrieabteilungen. Der Kaiser
machte grössere Ankäufe, besonders von keramischen
Arbeiten. Nach Schluss der Ausstellung wurde Schou
durch Verleihung des Roten Adlerordens II. Klasse
ausgezeichnet.
Die Ehrungen, die damals Schou zu teil wurden,
waren in der That wohl verdient. Denn ganz abge-
sehen von der geschickten Inscenierung der Aus-
stellung, die wesentlich sein Werk war, bestand keine
Gruppe der nordischen Kunstindustrie die Probe so
glänzend wie die Königliche Porzellanfabrik. In der
kurzen Spanne Zeit von fünf Jahren, von denen noch
dazu zwei mit technischen Vorarbeiten hingegangen
waren, war Erstaunliches geleistet.
Das alte „Muschelmuster" beherrschte zwar noch
das Gebrauchsgeschirr; aber das im Laufe der Zeiten
vernachlässigte und verunstaltete Dekorationsmotiv war
auf seine ursprüngliche Form zurückgeführt. Gute,
aber keine aussergewöhnlichen Leistungen wiesen die
Geschirre und Figuren auf, die in der bisherigen
Weise mit Reliefornamenten, Vergoldung und Über-
glasurmalerei geziert waren. Eine ganz neue und
völlig überraschende Erscheinung aber waren die
glatten Vasen und Zierschalen, deren Dekor in we-
nigen unter der Glasur aufgetragenen Farben-,; in
jenem echt künstlerischen Geschmack ausgeführt war,
der nachher für das Kopenhagener Porzellan be-
stimmend wurde, und dem es heute seinen Weltruf
verdankt.
Diese wichtige Neuerung hatte Schou's erster
Mitarbeiter, der Architekt und Maler Professor Arnold
Krog, angeregt und durchgeführt. Nach seinem Eintritt
als künstlerischer Direktor der Fabrik im Jahre 1885
hatte Krog zuerst mit Rokokomotiven experimentiert,
dann mit dem Ornamentenvorrat der Delfter Fayencen
und des chinesischen Porzellans, endlich auch mit
persischen Mustern. Aber von diesen tastenden Ver-
suchen wandte er sich bald der Richtung zu, die das
dänische Porzellan zum Siege geführt hat, zur An-
wendung von Naturmotiven in der von den Japanern
befolgten Weise.1)
In einigen Arbeiten Krog's aus den Jahren 1886
und 1887 erkennt man noch deutlich die befruchtenden
japanischen Vorbilder. Eine bauchige flaschenförmige
Vase aus jener Zeit zeigt einen Storch, der lang-
samen Flügelschlages dahinfliegt über einen schilfum-
säumten See (s. Abb. S. 216); aus dem Schilf erhebt
sich das unbelaubte Gezweig eines blühenden Mume-
baums. Sehr geschickt ist ein japanisches Motiv ver-
wertet für die Verzierung der S. 215 abgebildeten
grossen Vase, die sich im Hamburgischen Museum
befindet. Um das untere Drittel des cylindrischen
Gefässkörpers zieht sich eine blaue, von leichten Wellen
bewegte Meeresfläche, über welcher beutesuchende
Möwen hin- und herfliegen. Im Vordergrunde bäumt
sich eine schaumbekrönte Welle hoch auf. Das wirk-
same Motiv dieser steilen Spritzwelle könnte der
Künstler sehr wohl in den dänischen Meeren beob-
Porzellanschale, gemalt von Arnold Krog. Die zahmen und die wilden
Gänse. Im Besitz des Comte de Janachy.
1) Vgl. Karl Madsen, Tidsskrift for Kunstindustri 1887,
S. 70 ff.