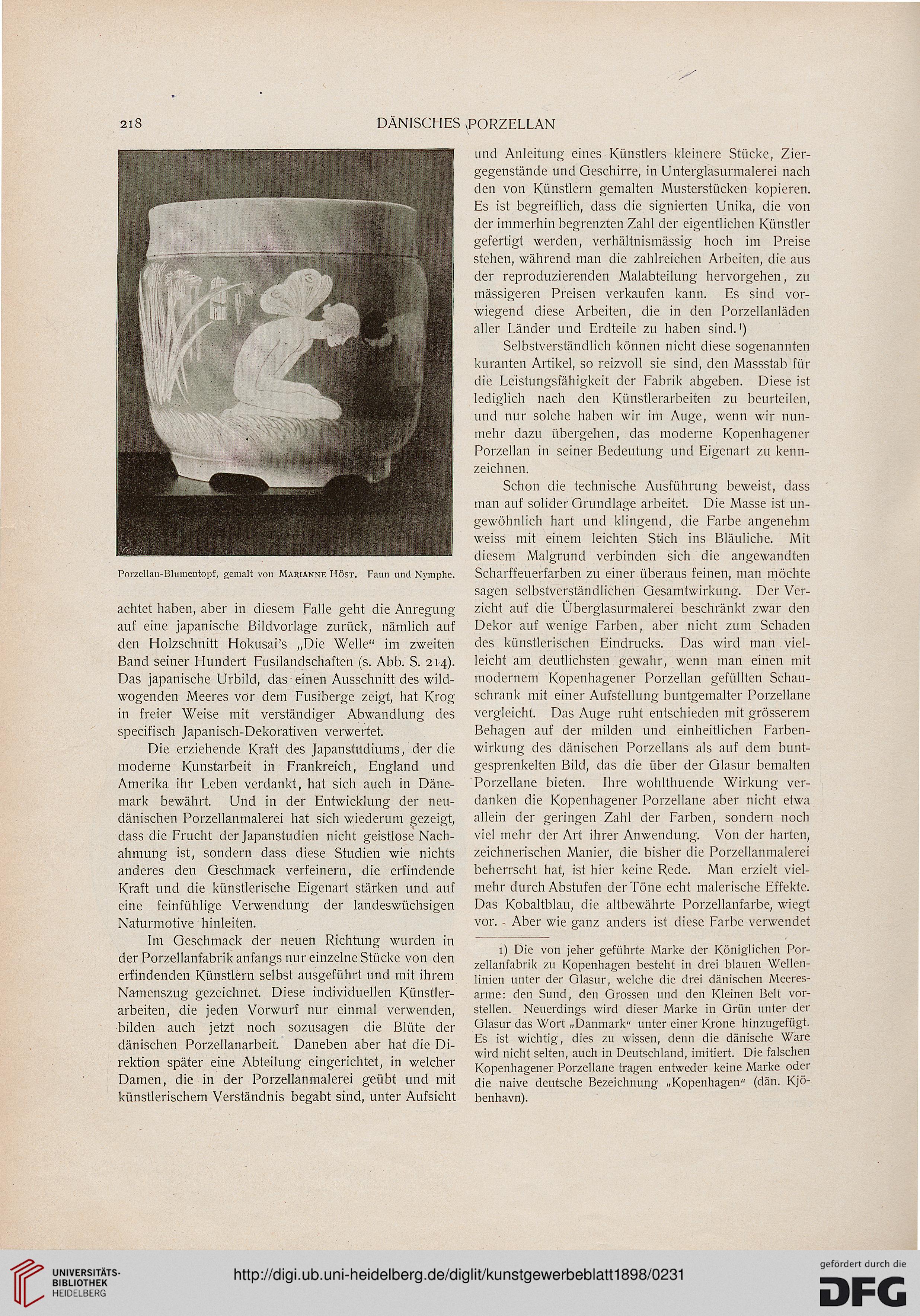218
DÄNISCHES PORZELLAN
Porzellan-Blumentopf, gemalt von Marianne Host. Faun und Nymphe.
achtet haben, aber in diesem Falle geht die Anregung
auf eine japanische Bildvorlage zurück, nämlich auf
den Holzschnitt Hokusai's „Die Welle" im zweiten
Band seiner Hundert Fusilandschaften (s. Abb. S. 214).
Das japanische Urbild, das ■ einen Ausschnitt des wild-
wogenden Meeres vor dem Fusiberge zeigt, hat Krog
in freier Weise mit verständiger Abwandlung des
speeifisch Japanisch-Dekorativen verwertet.
Die erziehende Kraft des Japanstudiums, der die
moderne Kunstarbeit in Frankreich, England und
Amerika ihr Leben verdankt, hat sich auch in Däne-
mark bewährt. Und in der Entwicklung der neu-
dänischen Porzellanmalerei hat sich wiederum gezeigt,
dass die Frucht der Japanstudien nicht geistlose Nach-
ahmung ist, sondern dass diese Studien wie nichts
anderes den Geschmack verfeinern, die erfindende
Kraft und die künstlerische Eigenart stärken und auf
eine feinfühlige Verwendung der landeswüchsigen
Naturmotive hinleiten.
Im Geschmack der neuen Richtung wurden in
der Porzellanfabrik anfangs nur einzelne Stücke von den
erfindenden Künstlern selbst ausgeführt und mit ihrem
Namenszug gezeichnet. Diese individuellen Künstler-
arbeiten, die jeden Vorwurf nur einmal verwenden,
bilden auch jetzt noch sozusagen die Blüte der
dänischen Porzellanarbeit. Daneben aber hat die Di-
rektion später eine Abteilung eingerichtet, in welcher
Damen, die in der Porzellanmalerei geübt und mit
künstlerischem Verständnis begabt sind, unter Aufsicht
und Anleitung eines Künstlers kleinere Stücke, Zier-
gegenstände und Geschirre, in Unterglasurmalerei nach
den von Künstlern gemalten Musterstücken kopieren.
Es ist begreiflich, dass die signierten Unika, die von
der immerhin begrenzten Zahl der eigentlichen Künstler
gefertigt werden, verhältnismässig hoch im Preise
stehen, während man die zahlreichen Arbeiten, die aus
der reproduzierenden Malabteilung hervorgehen, zu
massigeren Preisen verkaufen kann. Es sind vor-
wiegend diese Arbeiten, die in den Porzellanläden
aller Länder und Erdteile zu haben sind.')
Selbstverständlich können nicht diese sogenannten
kuranten Artikel, so reizvoll sie sind, den Massstab für
die Leistungsfähigkeit der Fabrik abgeben. Diese ist
lediglich nach den Künstlerarbeiten zu beurteilen,
und nur solche haben wir im Auge, wenn wir nun-
mehr dazu übergehen, das moderne Kopenhagener
Porzellan in seiner Bedeutung und Eigenart zu kenn-
zeichnen.
Schon die technische Ausführung beweist, dass
man auf solider Grundlage arbeitet. Die Masse ist un-
gewöhnlich hart und klingend, die Farbe angenehm
weiss mit einem leichten Stich ins Bläuliche. Mit
diesem Malgrund verbinden sich die angewandten
Scharffeuerfarben zu einer überaus feinen, man möchte
sagen selbstverständlichen Gesamtwirkung. Der Ver-
zicht auf die Überglasurmalerei beschränkt zwar den
Dekor auf wenige Farben, aber nicht zum Schaden
des künstlerischen Eindrucks. Das wird man viel-
leicht am deutlichsten gewahr, wenn man einen mit
modernem Kopenhagener Porzellan gefüllten Schau-
schrank mit einer Aufstellung buntgemalter Porzellane
vergleicht. Das Auge ruht entschieden mit grösserem
Behagen auf der milden und einheitlichen Farben-
wirkung des dänischen Porzellans als auf dem bunt-
gesprenkelten Bild, das die über der Glasur bemalten
Porzellane bieten. Ihre wohlthuende Wirkung ver-
danken die Kopenhagener Porzellane aber nicht etwa
allein der geringen Zahl der Farben, sondern noch
viel mehr der Art ihrer Anwendung. Von der harten,
zeichnerischen Manier, die bisher die Porzellanmalerei
beherrscht hat, ist hier keine Rede. Man erzielt viel-
mehr durch Abstufen der Töne echt malerische Effekte.
Das Kobaltblau, die altbewährte Porzellanfarbe, wiegt
vor. - Aber wie ganz anders ist diese Farbe verwendet
1) Die von jeher geführte Marke der Königlichen Por-
zellanfabrik zu Kopenhagen besteht in drei blauen Wellen-
linien unter der Glasur, welche die drei dänischen Meeres-
arme: den Sund, den Grossen und den Kleinen Belt vor-
stellen. Neuerdings wird dieser Marke in Grün unter der
Glasur das Wort „Danmark" unter einer Krone hinzugefügt.
Es ist wichtig, dies zu wissen, denn die dänische Ware
wird nicht selten, auch in Deutschland, imitiert. Die falschen
Kopenhagener Porzellane tragen entweder keine Marke oder
die naive deutsche Bezeichnung „Kopenhagen" (dän. Kjö-
benhavn).
DÄNISCHES PORZELLAN
Porzellan-Blumentopf, gemalt von Marianne Host. Faun und Nymphe.
achtet haben, aber in diesem Falle geht die Anregung
auf eine japanische Bildvorlage zurück, nämlich auf
den Holzschnitt Hokusai's „Die Welle" im zweiten
Band seiner Hundert Fusilandschaften (s. Abb. S. 214).
Das japanische Urbild, das ■ einen Ausschnitt des wild-
wogenden Meeres vor dem Fusiberge zeigt, hat Krog
in freier Weise mit verständiger Abwandlung des
speeifisch Japanisch-Dekorativen verwertet.
Die erziehende Kraft des Japanstudiums, der die
moderne Kunstarbeit in Frankreich, England und
Amerika ihr Leben verdankt, hat sich auch in Däne-
mark bewährt. Und in der Entwicklung der neu-
dänischen Porzellanmalerei hat sich wiederum gezeigt,
dass die Frucht der Japanstudien nicht geistlose Nach-
ahmung ist, sondern dass diese Studien wie nichts
anderes den Geschmack verfeinern, die erfindende
Kraft und die künstlerische Eigenart stärken und auf
eine feinfühlige Verwendung der landeswüchsigen
Naturmotive hinleiten.
Im Geschmack der neuen Richtung wurden in
der Porzellanfabrik anfangs nur einzelne Stücke von den
erfindenden Künstlern selbst ausgeführt und mit ihrem
Namenszug gezeichnet. Diese individuellen Künstler-
arbeiten, die jeden Vorwurf nur einmal verwenden,
bilden auch jetzt noch sozusagen die Blüte der
dänischen Porzellanarbeit. Daneben aber hat die Di-
rektion später eine Abteilung eingerichtet, in welcher
Damen, die in der Porzellanmalerei geübt und mit
künstlerischem Verständnis begabt sind, unter Aufsicht
und Anleitung eines Künstlers kleinere Stücke, Zier-
gegenstände und Geschirre, in Unterglasurmalerei nach
den von Künstlern gemalten Musterstücken kopieren.
Es ist begreiflich, dass die signierten Unika, die von
der immerhin begrenzten Zahl der eigentlichen Künstler
gefertigt werden, verhältnismässig hoch im Preise
stehen, während man die zahlreichen Arbeiten, die aus
der reproduzierenden Malabteilung hervorgehen, zu
massigeren Preisen verkaufen kann. Es sind vor-
wiegend diese Arbeiten, die in den Porzellanläden
aller Länder und Erdteile zu haben sind.')
Selbstverständlich können nicht diese sogenannten
kuranten Artikel, so reizvoll sie sind, den Massstab für
die Leistungsfähigkeit der Fabrik abgeben. Diese ist
lediglich nach den Künstlerarbeiten zu beurteilen,
und nur solche haben wir im Auge, wenn wir nun-
mehr dazu übergehen, das moderne Kopenhagener
Porzellan in seiner Bedeutung und Eigenart zu kenn-
zeichnen.
Schon die technische Ausführung beweist, dass
man auf solider Grundlage arbeitet. Die Masse ist un-
gewöhnlich hart und klingend, die Farbe angenehm
weiss mit einem leichten Stich ins Bläuliche. Mit
diesem Malgrund verbinden sich die angewandten
Scharffeuerfarben zu einer überaus feinen, man möchte
sagen selbstverständlichen Gesamtwirkung. Der Ver-
zicht auf die Überglasurmalerei beschränkt zwar den
Dekor auf wenige Farben, aber nicht zum Schaden
des künstlerischen Eindrucks. Das wird man viel-
leicht am deutlichsten gewahr, wenn man einen mit
modernem Kopenhagener Porzellan gefüllten Schau-
schrank mit einer Aufstellung buntgemalter Porzellane
vergleicht. Das Auge ruht entschieden mit grösserem
Behagen auf der milden und einheitlichen Farben-
wirkung des dänischen Porzellans als auf dem bunt-
gesprenkelten Bild, das die über der Glasur bemalten
Porzellane bieten. Ihre wohlthuende Wirkung ver-
danken die Kopenhagener Porzellane aber nicht etwa
allein der geringen Zahl der Farben, sondern noch
viel mehr der Art ihrer Anwendung. Von der harten,
zeichnerischen Manier, die bisher die Porzellanmalerei
beherrscht hat, ist hier keine Rede. Man erzielt viel-
mehr durch Abstufen der Töne echt malerische Effekte.
Das Kobaltblau, die altbewährte Porzellanfarbe, wiegt
vor. - Aber wie ganz anders ist diese Farbe verwendet
1) Die von jeher geführte Marke der Königlichen Por-
zellanfabrik zu Kopenhagen besteht in drei blauen Wellen-
linien unter der Glasur, welche die drei dänischen Meeres-
arme: den Sund, den Grossen und den Kleinen Belt vor-
stellen. Neuerdings wird dieser Marke in Grün unter der
Glasur das Wort „Danmark" unter einer Krone hinzugefügt.
Es ist wichtig, dies zu wissen, denn die dänische Ware
wird nicht selten, auch in Deutschland, imitiert. Die falschen
Kopenhagener Porzellane tragen entweder keine Marke oder
die naive deutsche Bezeichnung „Kopenhagen" (dän. Kjö-
benhavn).