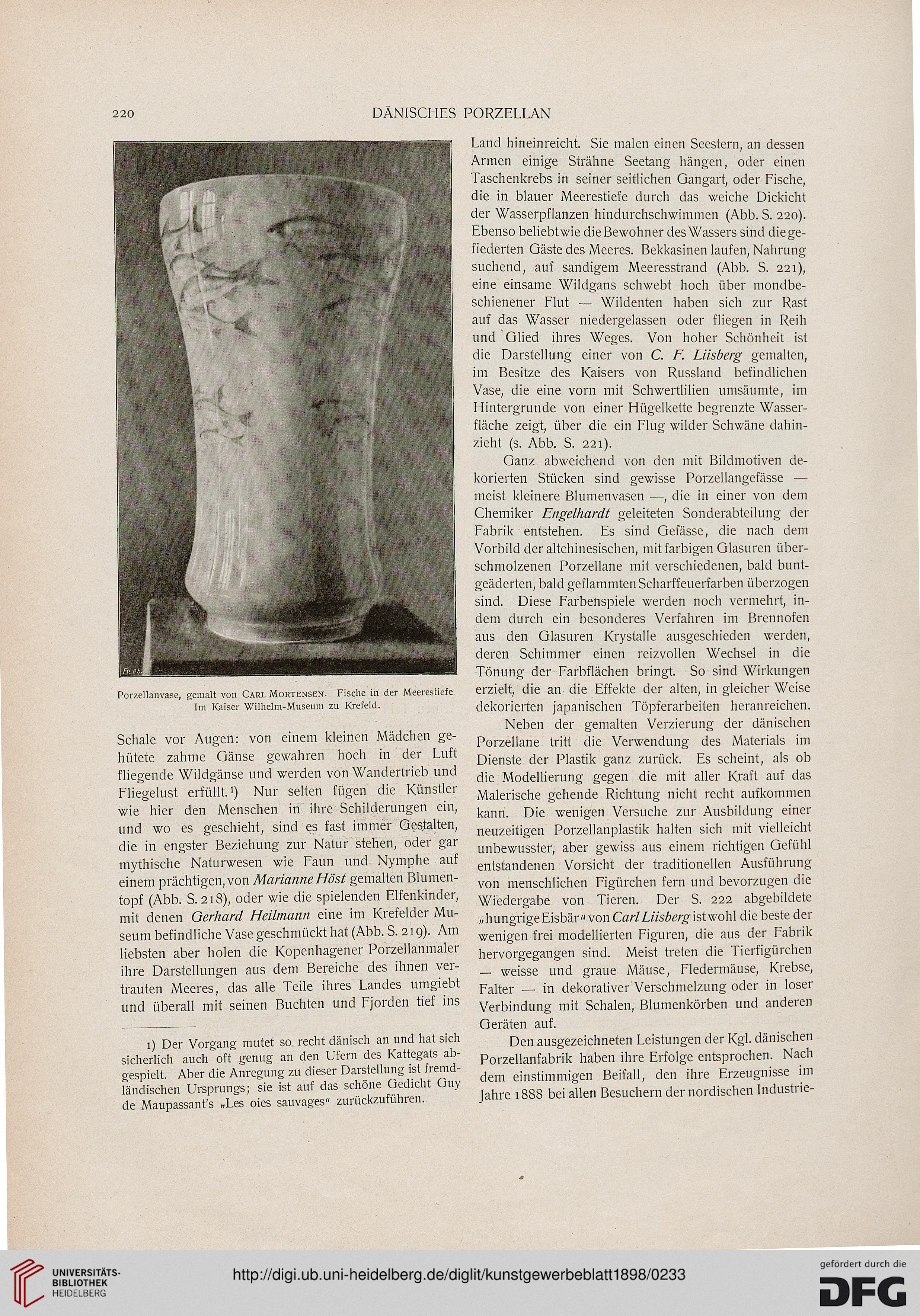220
DÄNISCHES PORZELLAN
Porzellanvase, gemalt von Carl Mortensen. Fische in der Meerestiefe
Im Kaiser Wilhelm-Museum zu Krefeld.
Schale vor Augen: von einem kleinen Mädchen ge-
hütete zahme Gänse gewahren hoch in der Luft
fliegende Wildgänse und werden von Wandertrieb und
Fliegelust erfüllt.1) Nur selten fügen die Künstler
wie hier den Menschen in ihre Schilderungen ein,
und wo es geschieht, sind es fast immer Gestalten,
die in engster Beziehung zur Natur stehen, oder gar
mythische Naturwesen wie Faun und Nymphe auf
einem prächtigen, von Marianne Host gemalten Blumen-
topf (Abb. S. 218), oder wie die spielenden Elfenkinder,
mit denen Gerhard Heilmann eine im Krefelder Mu-
seum befindliche Vase geschmückt hat (Abb. S. 219). Am
liebsten aber holen die Kopenhagener Porzellanmaler
ihre Darstellungen aus dem Bereiche des ihnen ver-
trauten Meeres, das alle Teile ihres Landes umgiebt
und überall mit seinen Buchten und Fjorden tief ins
1) Der Vorgang mutet so recht dänisch an und hat sich
sicherlich auch oft genug an den Ufern des Kattegats ab-
gespielt. Aber die Anregung zu dieser Darstellung ist fremd-
ländischen Ursprungs; sie ist auf das schöne Gedicht Guy
de Maupassant's „Les oies sauvages" zurückzuführen.
Land hineinreicht. Sie malen einen Seestern, an dessen
Armen einige Strähne Seetang hängen, oder einen
Taschenkrebs in seiner seitlichen Gangart, oder Fische,
die in blauer Meerestiefe durch das weiche Dickicht
der Wasserpflanzen hindurchschwimmen (Abb. S. 220).
Ebenso beliebtwie die Bewohner des Wassers sind diege-
fiederten Gäste des Meeres. Bekkasinen laufen, Nahrung
suchend, auf sandigem Meeresstrand (Abb. S. 221),
eine einsame Wildgans schwebt hoch über mondbe-
schienener Flut — Wildenten haben sich zur Rast
auf das Wasser niedergelassen oder fliegen in Reih
und Glied ihres Weges. Von hoher Schönheit ist
die Darstellung einer von C. F. Liisberg gemalten,
im Besitze des Kaisers von Russland befindlichen
Vase, die eine vorn mit Schwertlilien umsäumte, im
Hintergrunde von einer Hügelkette begrenzte Wasser-
fläche zeigt, über die ein Flug wilder Schwäne dahin-
zieht (s. Abb. S. 221).
Ganz abweichend von den mit Bildmotiven de-
korierten Stücken sind gewisse Porzellangefässe —
meist kleinere Blumenvasen —, die in einer von dem
Chemiker Engelhardt geleiteten Sonderabteilung der
Fabrik entstehen. Es sind Gefässe, die nach dem
Vorbild der altchinesischen, mit farbigen Glasuren über-
schmolzenen Porzellane mit verschiedenen, bald bunt-
geäderten, bald geflammten Scharffeuerfarben überzogen
sind. Diese Farbenspiele werden noch vermehrt, in-
dem durch ein besonderes Verfahren im Brennofen
aus den Glasuren Krystalle ausgeschieden werden,
deren Schimmer einen reizvollen Wechsel in die
Tönung der Farbflächen bringt. So sind Wirkungen
erzielt, die an die Effekte der alten, in gleicher Weise
dekorierten japanischen Töpferarbeiten heranreichen.
Neben der gemalten Verzierung der dänischen
Porzellane tritt die Verwendung des Materials im
Dienste der Plastik ganz zurück. Es scheint, als ob
die Modellierung gegen die mit aller Kraft auf das
Malerische gehende Richtung nicht recht aufkommen
kann. Die wenigen Versuche zur Ausbildung einer
neuzeitigen Porzellanplastik halten sich mit vielleicht
unbewusster, aber gewiss aus einem richtigen Gefühl
entstandenen Vorsicht der traditionellen Ausführung
von menschlichen Figürchen fern und bevorzugen die
Wiedergabe von Tieren. Der S. 222 abgebildete
„hungrigeEisbär" vonCa/"/Zi«Z>e/g-istwohl die beste der
wenigen frei modellierten Figuren, die aus der Fabrik
hervorgegangen sind. Meist treten die Tierfigürchen
— weisse und graue Mäuse, Fledermäuse, Krebse,
Falter — in dekorativer Verschmelzung oder in loser
Verbindung mit Schalen, Blumenkörben und anderen
Geräten auf.
Den ausgezeichneten Leistungen der Kgl. dänischen
Porzellanfabrik haben ihre Erfolge entsprochen. Nach
dem einstimmigen Beifall, den ihre Erzeugnisse im
Jahre 1888 bei allen Besuchern der nordischen Industrie-
DÄNISCHES PORZELLAN
Porzellanvase, gemalt von Carl Mortensen. Fische in der Meerestiefe
Im Kaiser Wilhelm-Museum zu Krefeld.
Schale vor Augen: von einem kleinen Mädchen ge-
hütete zahme Gänse gewahren hoch in der Luft
fliegende Wildgänse und werden von Wandertrieb und
Fliegelust erfüllt.1) Nur selten fügen die Künstler
wie hier den Menschen in ihre Schilderungen ein,
und wo es geschieht, sind es fast immer Gestalten,
die in engster Beziehung zur Natur stehen, oder gar
mythische Naturwesen wie Faun und Nymphe auf
einem prächtigen, von Marianne Host gemalten Blumen-
topf (Abb. S. 218), oder wie die spielenden Elfenkinder,
mit denen Gerhard Heilmann eine im Krefelder Mu-
seum befindliche Vase geschmückt hat (Abb. S. 219). Am
liebsten aber holen die Kopenhagener Porzellanmaler
ihre Darstellungen aus dem Bereiche des ihnen ver-
trauten Meeres, das alle Teile ihres Landes umgiebt
und überall mit seinen Buchten und Fjorden tief ins
1) Der Vorgang mutet so recht dänisch an und hat sich
sicherlich auch oft genug an den Ufern des Kattegats ab-
gespielt. Aber die Anregung zu dieser Darstellung ist fremd-
ländischen Ursprungs; sie ist auf das schöne Gedicht Guy
de Maupassant's „Les oies sauvages" zurückzuführen.
Land hineinreicht. Sie malen einen Seestern, an dessen
Armen einige Strähne Seetang hängen, oder einen
Taschenkrebs in seiner seitlichen Gangart, oder Fische,
die in blauer Meerestiefe durch das weiche Dickicht
der Wasserpflanzen hindurchschwimmen (Abb. S. 220).
Ebenso beliebtwie die Bewohner des Wassers sind diege-
fiederten Gäste des Meeres. Bekkasinen laufen, Nahrung
suchend, auf sandigem Meeresstrand (Abb. S. 221),
eine einsame Wildgans schwebt hoch über mondbe-
schienener Flut — Wildenten haben sich zur Rast
auf das Wasser niedergelassen oder fliegen in Reih
und Glied ihres Weges. Von hoher Schönheit ist
die Darstellung einer von C. F. Liisberg gemalten,
im Besitze des Kaisers von Russland befindlichen
Vase, die eine vorn mit Schwertlilien umsäumte, im
Hintergrunde von einer Hügelkette begrenzte Wasser-
fläche zeigt, über die ein Flug wilder Schwäne dahin-
zieht (s. Abb. S. 221).
Ganz abweichend von den mit Bildmotiven de-
korierten Stücken sind gewisse Porzellangefässe —
meist kleinere Blumenvasen —, die in einer von dem
Chemiker Engelhardt geleiteten Sonderabteilung der
Fabrik entstehen. Es sind Gefässe, die nach dem
Vorbild der altchinesischen, mit farbigen Glasuren über-
schmolzenen Porzellane mit verschiedenen, bald bunt-
geäderten, bald geflammten Scharffeuerfarben überzogen
sind. Diese Farbenspiele werden noch vermehrt, in-
dem durch ein besonderes Verfahren im Brennofen
aus den Glasuren Krystalle ausgeschieden werden,
deren Schimmer einen reizvollen Wechsel in die
Tönung der Farbflächen bringt. So sind Wirkungen
erzielt, die an die Effekte der alten, in gleicher Weise
dekorierten japanischen Töpferarbeiten heranreichen.
Neben der gemalten Verzierung der dänischen
Porzellane tritt die Verwendung des Materials im
Dienste der Plastik ganz zurück. Es scheint, als ob
die Modellierung gegen die mit aller Kraft auf das
Malerische gehende Richtung nicht recht aufkommen
kann. Die wenigen Versuche zur Ausbildung einer
neuzeitigen Porzellanplastik halten sich mit vielleicht
unbewusster, aber gewiss aus einem richtigen Gefühl
entstandenen Vorsicht der traditionellen Ausführung
von menschlichen Figürchen fern und bevorzugen die
Wiedergabe von Tieren. Der S. 222 abgebildete
„hungrigeEisbär" vonCa/"/Zi«Z>e/g-istwohl die beste der
wenigen frei modellierten Figuren, die aus der Fabrik
hervorgegangen sind. Meist treten die Tierfigürchen
— weisse und graue Mäuse, Fledermäuse, Krebse,
Falter — in dekorativer Verschmelzung oder in loser
Verbindung mit Schalen, Blumenkörben und anderen
Geräten auf.
Den ausgezeichneten Leistungen der Kgl. dänischen
Porzellanfabrik haben ihre Erfolge entsprochen. Nach
dem einstimmigen Beifall, den ihre Erzeugnisse im
Jahre 1888 bei allen Besuchern der nordischen Industrie-