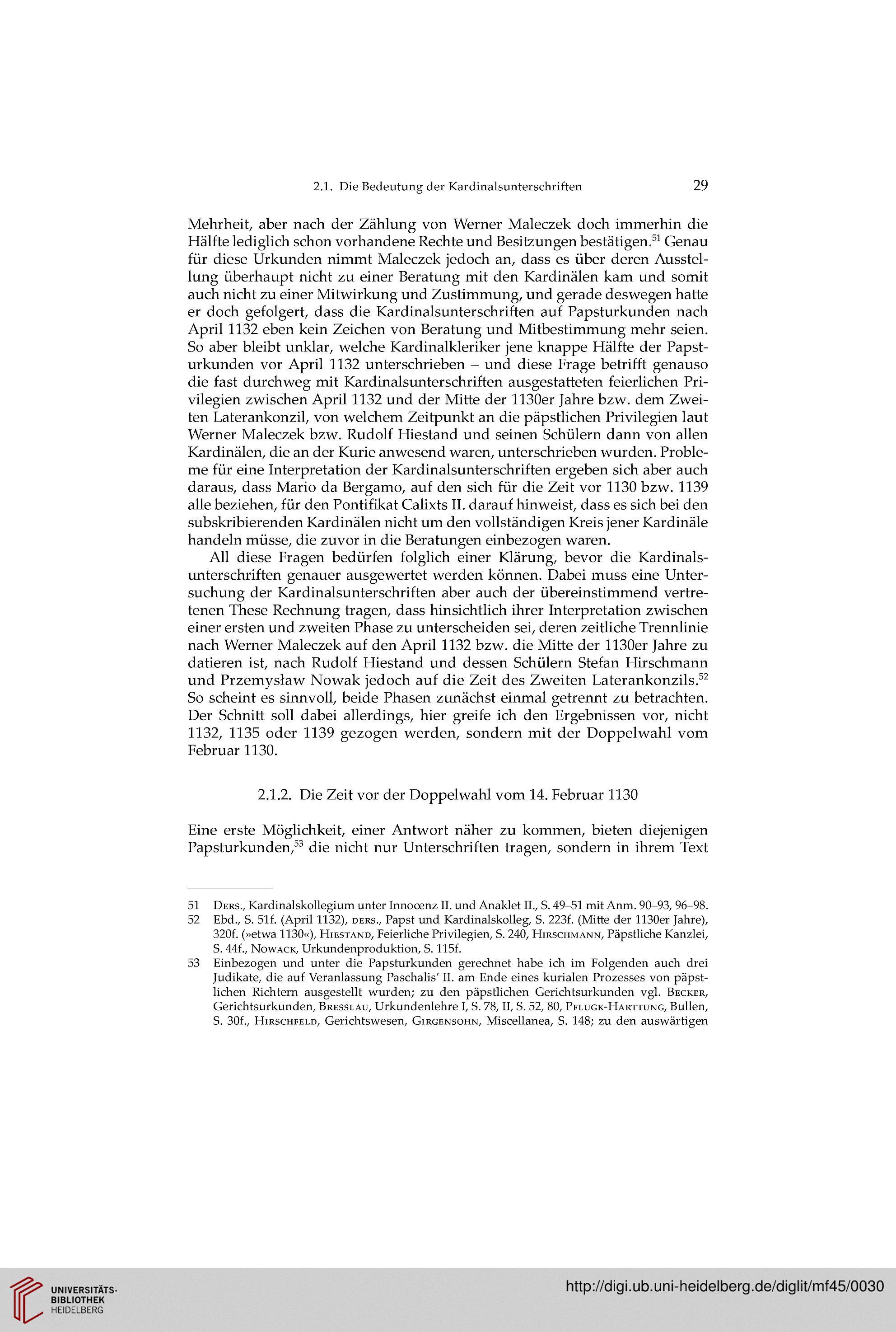2.1. Die Bedeutung der Kardinalsunterschriften
29
Mehrheit, aber nach der Zählung von Werner Maleczek doch immerhin die
Hälfte lediglich schon vorhandene Rechte und Besitzungen bestätigen.^ Genau
für diese Urkunden nimmt Maleczek jedoch an, dass es über deren Ausstel-
lung überhaupt nicht zu einer Beratung mit den Kardinälen kam und somit
auch nicht zu einer Mitwirkung und Zustimmung, und gerade deswegen hatte
er doch gefolgert, dass die Kardinalsunterschriften auf Papsturkunden nach
April 1132 eben kein Zeichen von Beratung und Mitbestimmung mehr seien.
So aber bleibt unklar, welche Kardinalkleriker jene knappe Hälfte der Papst-
urkunden vor April 1132 unterschrieben - und diese Frage betrifft genauso
die fast durchweg mit Kardinalsunterschriften ausgestatteten feierlichen Pri-
vilegien zwischen April 1132 und der Mitte der 1130er Jahre bzw. dem Zwei-
ten Laterankonzil, von welchem Zeitpunkt an die päpstlichen Privilegien laut
Werner Maleczek bzw. Rudolf Hiestand und seinen Schülern dann von allen
Kardinälen, die an der Kurie anwesend waren, unterschrieben wurden. Proble-
me für eine Interpretation der Kardinalsunterschriften ergeben sich aber auch
daraus, dass Mario da Bergamo, auf den sich für die Zeit vor 1130 bzw. 1139
alle beziehen, für den Pontifikat Calixts II. darauf hinweist, dass es sich bei den
subskribierenden Kardinälen nicht um den vollständigen Kreis jener Kardinäle
handeln müsse, die zuvor in die Beratungen einbezogen waren.
All diese Fragen bedürfen folglich einer Klärung, bevor die Kardinals-
unterschriften genauer ausgewertet werden können. Dabei muss eine Unter-
suchung der Kardinalsunterschriften aber auch der übereinstimmend vertre-
tenen These Rechnung tragen, dass hinsichtlich ihrer Interpretation zwischen
einer ersten und zweiten Phase zu unterscheiden sei, deren zeitliche Trennlinie
nach Werner Maleczek auf den April 1132 bzw. die Mitte der 1130er Jahre zu
datieren ist, nach Rudolf Hiestand und dessen Schülern Stefan Hirschmann
und Przemyslaw Nowak jedoch auf die Zeit des Zweiten Laterankonzils.^
So scheint es sinnvoll, beide Phasen zunächst einmal getrennt zu betrachten.
Der Schnitt soll dabei allerdings, hier greife ich den Ergebnissen vor, nicht
1132, 1135 oder 1139 gezogen werden, sondern mit der Doppelwahl vom
Februar 1130.
2.1.2. Die Zeit vor der Doppelwahl vom 14. Februar 1130
Eine erste Möglichkeit, einer Antwort näher zu kommen, bieten diejenigen
Papsturkünden/' die nicht nur Unterschriften tragen, sondern in ihrem Text
51 DERS., Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet II., S. 49-51 mit Anm. 90-93, 96-98.
52 Ebd., S. 51f. (April 1132), DERS., Papst und Kardinalskolleg, S. 223f. (Mitte der 1130er Jahre),
320f. (»etwa 1130«), HiESTAND, Feierliche Privilegien, S. 240, HmscHMANN, Päpstliche Kanzlei,
S. 44f., NowACK, Urkundenproduktion, S. 115f.
53 Einbezogen und unter die Papsturkunden gerechnet habe ich im Folgenden auch drei
Judikate, die auf Veranlassung Paschalis' II. am Ende eines kurialen Prozesses von päpst-
lichen Richtern ausgestellt wurden; zu den päpstlichen Gerichtsurkunden vgl. BECKER,
Gerichtsurkunden, BRESSLAu, Urkundenlehre I, S. 78, II, S. 52, 80, PFLUGK-HARTTUNG, Bullen,
S. 30f., HiRSCHFELD, Gerichtswesen, GiRGENSOHN, Miscellanea, S. 148; zu den auswärtigen
29
Mehrheit, aber nach der Zählung von Werner Maleczek doch immerhin die
Hälfte lediglich schon vorhandene Rechte und Besitzungen bestätigen.^ Genau
für diese Urkunden nimmt Maleczek jedoch an, dass es über deren Ausstel-
lung überhaupt nicht zu einer Beratung mit den Kardinälen kam und somit
auch nicht zu einer Mitwirkung und Zustimmung, und gerade deswegen hatte
er doch gefolgert, dass die Kardinalsunterschriften auf Papsturkunden nach
April 1132 eben kein Zeichen von Beratung und Mitbestimmung mehr seien.
So aber bleibt unklar, welche Kardinalkleriker jene knappe Hälfte der Papst-
urkunden vor April 1132 unterschrieben - und diese Frage betrifft genauso
die fast durchweg mit Kardinalsunterschriften ausgestatteten feierlichen Pri-
vilegien zwischen April 1132 und der Mitte der 1130er Jahre bzw. dem Zwei-
ten Laterankonzil, von welchem Zeitpunkt an die päpstlichen Privilegien laut
Werner Maleczek bzw. Rudolf Hiestand und seinen Schülern dann von allen
Kardinälen, die an der Kurie anwesend waren, unterschrieben wurden. Proble-
me für eine Interpretation der Kardinalsunterschriften ergeben sich aber auch
daraus, dass Mario da Bergamo, auf den sich für die Zeit vor 1130 bzw. 1139
alle beziehen, für den Pontifikat Calixts II. darauf hinweist, dass es sich bei den
subskribierenden Kardinälen nicht um den vollständigen Kreis jener Kardinäle
handeln müsse, die zuvor in die Beratungen einbezogen waren.
All diese Fragen bedürfen folglich einer Klärung, bevor die Kardinals-
unterschriften genauer ausgewertet werden können. Dabei muss eine Unter-
suchung der Kardinalsunterschriften aber auch der übereinstimmend vertre-
tenen These Rechnung tragen, dass hinsichtlich ihrer Interpretation zwischen
einer ersten und zweiten Phase zu unterscheiden sei, deren zeitliche Trennlinie
nach Werner Maleczek auf den April 1132 bzw. die Mitte der 1130er Jahre zu
datieren ist, nach Rudolf Hiestand und dessen Schülern Stefan Hirschmann
und Przemyslaw Nowak jedoch auf die Zeit des Zweiten Laterankonzils.^
So scheint es sinnvoll, beide Phasen zunächst einmal getrennt zu betrachten.
Der Schnitt soll dabei allerdings, hier greife ich den Ergebnissen vor, nicht
1132, 1135 oder 1139 gezogen werden, sondern mit der Doppelwahl vom
Februar 1130.
2.1.2. Die Zeit vor der Doppelwahl vom 14. Februar 1130
Eine erste Möglichkeit, einer Antwort näher zu kommen, bieten diejenigen
Papsturkünden/' die nicht nur Unterschriften tragen, sondern in ihrem Text
51 DERS., Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet II., S. 49-51 mit Anm. 90-93, 96-98.
52 Ebd., S. 51f. (April 1132), DERS., Papst und Kardinalskolleg, S. 223f. (Mitte der 1130er Jahre),
320f. (»etwa 1130«), HiESTAND, Feierliche Privilegien, S. 240, HmscHMANN, Päpstliche Kanzlei,
S. 44f., NowACK, Urkundenproduktion, S. 115f.
53 Einbezogen und unter die Papsturkunden gerechnet habe ich im Folgenden auch drei
Judikate, die auf Veranlassung Paschalis' II. am Ende eines kurialen Prozesses von päpst-
lichen Richtern ausgestellt wurden; zu den päpstlichen Gerichtsurkunden vgl. BECKER,
Gerichtsurkunden, BRESSLAu, Urkundenlehre I, S. 78, II, S. 52, 80, PFLUGK-HARTTUNG, Bullen,
S. 30f., HiRSCHFELD, Gerichtswesen, GiRGENSOHN, Miscellanea, S. 148; zu den auswärtigen