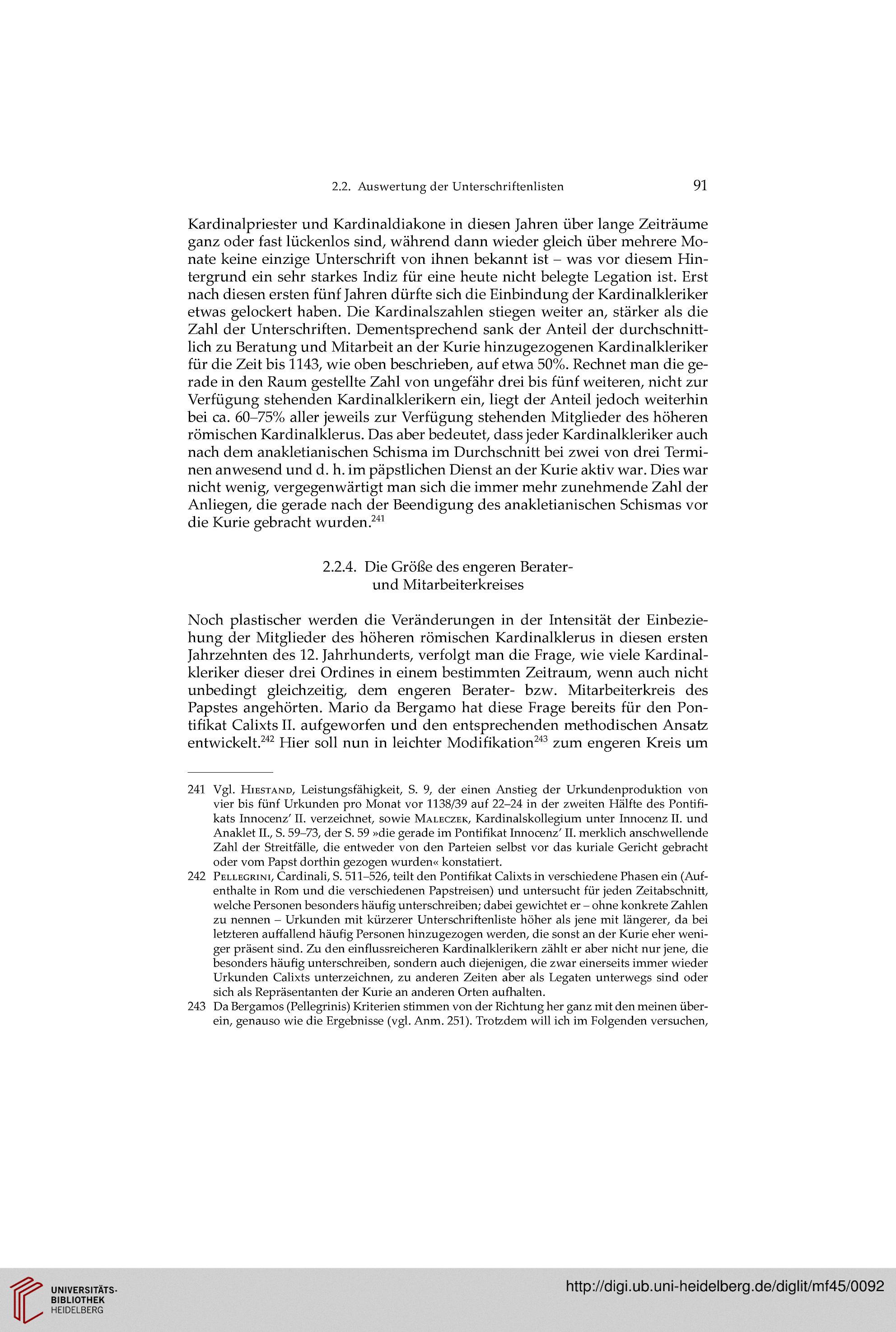2.2. Auswertung der Unterschriftenlisten
91
Kardinalpriester und Kardinaldiakone in diesen Jahren über lange Zeiträume
ganz oder fast lückenlos sind, während dann wieder gleich über mehrere Mo-
nate keine einzige Unterschrift von ihnen bekannt ist - was vor diesem Hin-
tergrund ein sehr starkes Indiz für eine heute nicht belegte Legation ist. Erst
nach diesen ersten fünf Jahren dürfte sich die Einbindung der Kardinalkleriker
etwas gelockert haben. Die Kardinalszahlen stiegen weiter an, stärker als die
Zahl der Unterschriften. Dementsprechend sank der Anteil der durchschnitt-
lich zu Beratung und Mitarbeit an der Kurie hinzugezogenen Kardinalkleriker
für die Zeit bis 1143, wie oben beschrieben, auf etwa 50%. Rechnet man die ge-
rade in den Raum gestellte Zahl von ungefähr drei bis fünf weiteren, nicht zur
Verfügung stehenden Kardinalklerikern ein, liegt der Anteil jedoch weiterhin
bei ca. 60-75% aller jeweils zur Verfügung stehenden Mitglieder des höheren
römischen Kardinalklerus. Das aber bedeutet, dass jeder Kardinalkleriker auch
nach dem anakletianischen Schisma im Durchschnitt bei zwei von drei Termi-
nen anwesend und d. h. im päpstlichen Dienst an der Kurie aktiv war. Dies war
nicht wenig, vergegenwärtigt man sich die immer mehr zunehmende Zahl der
Anliegen, die gerade nach der Beendigung des anakletianischen Schismas vor
die Kurie gebracht wurden.^'
2.2.4. Die Größe des engeren Berater-
und Mitarbeiterkreises
Noch plastischer werden die Veränderungen in der Intensität der Einbezie-
hung der Mitglieder des höheren römischen Kardinalklerus in diesen ersten
Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts, verfolgt man die Frage, wie viele Kardinal-
kleriker dieser drei Ordines in einem bestimmten Zeitraum, wenn auch nicht
unbedingt gleichzeitig, dem engeren Berater- bzw. Mitarbeiterkreis des
Papstes angehörten. Mario da Bergamo hat diese Frage bereits für den Pon-
tifikat Calixts II. aufgeworfen und den entsprechenden methodischen Ansatz
entwickelt.^ Hier soll nun in leichter Modifikation^ zum engeren Kreis um
241 Vgl. HiESTAND, Leistungsfähigkeit, S. 9, der einen Anstieg der Urkundenproduktion von
vier bis fünf Urkunden pro Monat vor 1138/39 auf 22-24 in der zweiten Hälfte des Pontifi-
kats Innocenz' II. verzeichnet, sowie MALECZEK, Kardinalskollegium unter Innocenz II. und
Anaklet II., S. 59-73, der S. 59 »die gerade im Pontifikat Innocenz' II. merklich anschwellende
Zahl der Streitfälle, die entweder von den Parteien selbst vor das kuriale Gericht gebracht
oder vom Papst dorthin gezogen wurden« konstatiert.
242 PELLEGRiNi, Cardinali, S. 511-526, teilt den Pontifikat Calixts in verschiedene Phasen ein (Auf-
enthalte in Rom und die verschiedenen Papstreisen) und untersucht für jeden Zeitabschnitt,
welche Personen besonders häufig unterschreiben; dabei gewichtet er - ohne konkrete Zahlen
zu nennen - Urkunden mit kürzerer Unterschriftenliste höher als jene mit längerer, da bei
letzteren auffallend häufig Personen hinzugezogen werden, die sonst an der Kurie eher weni-
ger präsent sind. Zu den einflussreicheren Kardinalklerikern zählt er aber nicht nur jene, die
besonders häufig unterschreiben, sondern auch diejenigen, die zwar einerseits immer wieder
Urkunden Calixts unterzeichnen, zu anderen Zeiten aber als Legaten unterwegs sind oder
sich als Repräsentanten der Kurie an anderen Orten aufhalten.
243 Da Bergamos (Pellegrinis) Kriterien stimmen von der Richtung her ganz mit den meinen über-
ein, genauso wie die Ergebnisse (vgl. Anm. 251). Trotzdem will ich im Folgenden versuchen.
91
Kardinalpriester und Kardinaldiakone in diesen Jahren über lange Zeiträume
ganz oder fast lückenlos sind, während dann wieder gleich über mehrere Mo-
nate keine einzige Unterschrift von ihnen bekannt ist - was vor diesem Hin-
tergrund ein sehr starkes Indiz für eine heute nicht belegte Legation ist. Erst
nach diesen ersten fünf Jahren dürfte sich die Einbindung der Kardinalkleriker
etwas gelockert haben. Die Kardinalszahlen stiegen weiter an, stärker als die
Zahl der Unterschriften. Dementsprechend sank der Anteil der durchschnitt-
lich zu Beratung und Mitarbeit an der Kurie hinzugezogenen Kardinalkleriker
für die Zeit bis 1143, wie oben beschrieben, auf etwa 50%. Rechnet man die ge-
rade in den Raum gestellte Zahl von ungefähr drei bis fünf weiteren, nicht zur
Verfügung stehenden Kardinalklerikern ein, liegt der Anteil jedoch weiterhin
bei ca. 60-75% aller jeweils zur Verfügung stehenden Mitglieder des höheren
römischen Kardinalklerus. Das aber bedeutet, dass jeder Kardinalkleriker auch
nach dem anakletianischen Schisma im Durchschnitt bei zwei von drei Termi-
nen anwesend und d. h. im päpstlichen Dienst an der Kurie aktiv war. Dies war
nicht wenig, vergegenwärtigt man sich die immer mehr zunehmende Zahl der
Anliegen, die gerade nach der Beendigung des anakletianischen Schismas vor
die Kurie gebracht wurden.^'
2.2.4. Die Größe des engeren Berater-
und Mitarbeiterkreises
Noch plastischer werden die Veränderungen in der Intensität der Einbezie-
hung der Mitglieder des höheren römischen Kardinalklerus in diesen ersten
Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts, verfolgt man die Frage, wie viele Kardinal-
kleriker dieser drei Ordines in einem bestimmten Zeitraum, wenn auch nicht
unbedingt gleichzeitig, dem engeren Berater- bzw. Mitarbeiterkreis des
Papstes angehörten. Mario da Bergamo hat diese Frage bereits für den Pon-
tifikat Calixts II. aufgeworfen und den entsprechenden methodischen Ansatz
entwickelt.^ Hier soll nun in leichter Modifikation^ zum engeren Kreis um
241 Vgl. HiESTAND, Leistungsfähigkeit, S. 9, der einen Anstieg der Urkundenproduktion von
vier bis fünf Urkunden pro Monat vor 1138/39 auf 22-24 in der zweiten Hälfte des Pontifi-
kats Innocenz' II. verzeichnet, sowie MALECZEK, Kardinalskollegium unter Innocenz II. und
Anaklet II., S. 59-73, der S. 59 »die gerade im Pontifikat Innocenz' II. merklich anschwellende
Zahl der Streitfälle, die entweder von den Parteien selbst vor das kuriale Gericht gebracht
oder vom Papst dorthin gezogen wurden« konstatiert.
242 PELLEGRiNi, Cardinali, S. 511-526, teilt den Pontifikat Calixts in verschiedene Phasen ein (Auf-
enthalte in Rom und die verschiedenen Papstreisen) und untersucht für jeden Zeitabschnitt,
welche Personen besonders häufig unterschreiben; dabei gewichtet er - ohne konkrete Zahlen
zu nennen - Urkunden mit kürzerer Unterschriftenliste höher als jene mit längerer, da bei
letzteren auffallend häufig Personen hinzugezogen werden, die sonst an der Kurie eher weni-
ger präsent sind. Zu den einflussreicheren Kardinalklerikern zählt er aber nicht nur jene, die
besonders häufig unterschreiben, sondern auch diejenigen, die zwar einerseits immer wieder
Urkunden Calixts unterzeichnen, zu anderen Zeiten aber als Legaten unterwegs sind oder
sich als Repräsentanten der Kurie an anderen Orten aufhalten.
243 Da Bergamos (Pellegrinis) Kriterien stimmen von der Richtung her ganz mit den meinen über-
ein, genauso wie die Ergebnisse (vgl. Anm. 251). Trotzdem will ich im Folgenden versuchen.