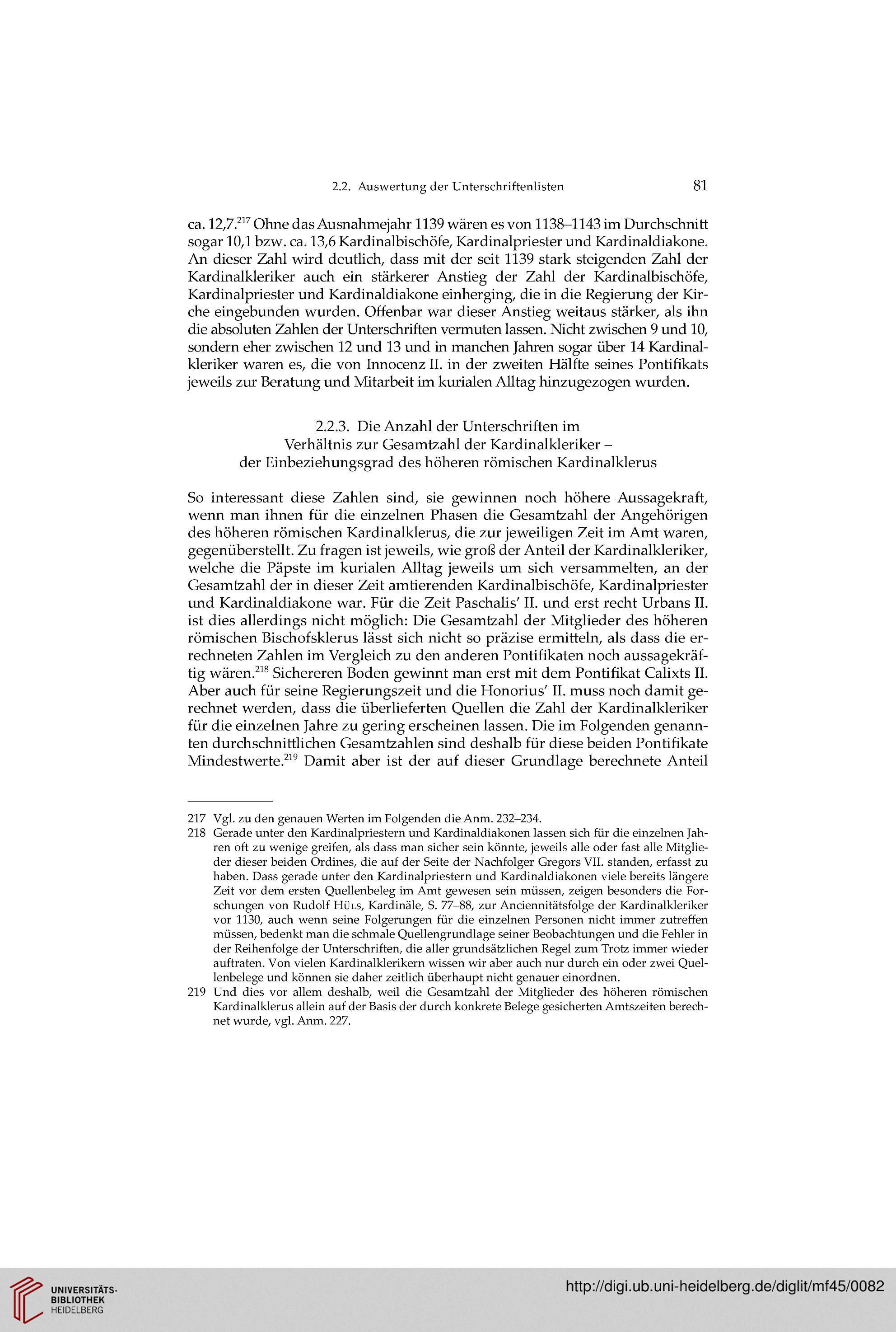2.2. Auswertung der Unterschriftenlisten
81
ca. 12,73^ Ohrte das Ausnahmejahr 1139 wären es von 1138-1143 im Durchschnitt
sogar 10,1 bzw. ca. 13,6 Kardinalbischöfe, Kardinalpriester und Kardinaldiakone.
An dieser Zahl wird deutlich, dass mit der seit 1139 stark steigenden Zahl der
Kardinalkleriker auch ein stärkerer Anstieg der Zahl der Kardinalbischöfe,
Kardinalpriester und Kardinaldiakone einherging, die in die Regierung der Kir-
che eingebunden wurden. Offenbar war dieser Anstieg weitaus stärker, als ihn
die absoluten Zahlen der Unterschriften vermuten lassen. Nicht zwischen 9 und 10,
sondern eher zwischen 12 und 13 und in manchen Jahren sogar über 14 Kardinal-
kleriker waren es, die von Innocenz II. in der zweiten Hälfte seines Pontifikats
jeweils zur Beratung und Mitarbeit im kurialen Alltag hinzugezogen wurden.
2.2.3. Die Anzahl der Unterschriften im
Verhältnis zur Gesamtzahl der Kardinalkleriker -
der Einbeziehungsgrad des höheren römischen Kardinalklerus
So interessant diese Zahlen sind, sie gewinnen noch höhere Aussagekraft,
wenn man ihnen für die einzelnen Phasen die Gesamtzahl der Angehörigen
des höheren römischen Kardinalklerus, die zur jeweiligen Zeit im Amt waren,
gegenüberstellt. Zu fragen ist jeweils, wie groß der Anteil der Kardinalkleriker,
welche die Päpste im kurialen Alltag jeweils um sich versammelten, an der
Gesamtzahl der in dieser Zeit amtierenden Kardinalbischöfe, Kardinalpriester
und Kardinaldiakone war. Für die Zeit Paschalis' II. und erst recht Urbans II.
ist dies allerdings nicht möglich: Die Gesamtzahl der Mitglieder des höheren
römischen Bischofsklerus lässt sich nicht so präzise ermitteln, als dass die er-
rechnten Zahlen im Vergleich zu den anderen Pontifikaten noch aussagekräf-
tig wärenZ'^ Sichereren Boden gewinnt man erst mit dem Pontifikat Calixts II.
Aber auch für seine Regierungszeit und die Honorius' II. muss noch damit ge-
rechnet werden, dass die überlieferten Quellen die Zahl der Kardinalkleriker
für die einzelnen Jahre zu gering erscheinen lassen. Die im Folgenden genann-
ten durchschnittlichen Gesamtzahlen sind deshalb für diese beiden Pontifikate
Mindestwerte.^ Damit aber ist der auf dieser Grundlage berechnete Anteil
217 Vgl. zu den genauen Werten im Folgenden die Anm. 232-234.
218 Gerade unter den Kardinalpriestern und Kardinaldiakonen lassen sich für die einzelnen Jah-
ren oft zu wenige greifen, als dass man sicher sein könnte, jeweils alle oder fast alle Mitglie-
der dieser beiden Ordines, die auf der Seite der Nachfolger Gregors VII. standen, erfasst zu
haben. Dass gerade unter den Kardinalpriestern und Kardinaldiakonen viele bereits längere
Zeit vor dem ersten Quellenbeleg im Amt gewesen sein müssen, zeigen besonders die For-
schungen von Rudolf HÜLS, Kardinale, S. 77-88, zur Anciennitätsfolge der Kardinalkleriker
vor 1130, auch wenn seine Folgerungen für die einzelnen Personen nicht immer zutreffen
müssen, bedenkt man die schmale Quellengrundlage seiner Beobachtungen und die Fehler in
der Reihenfolge der Unterschriften, die aller grundsätzlichen Regel zum Trotz immer wieder
auftraten. Von vielen Kardinalklerikern wissen wir aber auch nur durch ein oder zwei Quel-
lenbelege und können sie daher zeitlich überhaupt nicht genauer einordnen.
219 Und dies vor allem deshalb, weil die Gesamtzahl der Mitglieder des höheren römischen
Kardinalklerus allein auf der Basis der durch konkrete Belege gesicherten Amtszeiten berech-
net wurde, vgl. Anm. 227.
81
ca. 12,73^ Ohrte das Ausnahmejahr 1139 wären es von 1138-1143 im Durchschnitt
sogar 10,1 bzw. ca. 13,6 Kardinalbischöfe, Kardinalpriester und Kardinaldiakone.
An dieser Zahl wird deutlich, dass mit der seit 1139 stark steigenden Zahl der
Kardinalkleriker auch ein stärkerer Anstieg der Zahl der Kardinalbischöfe,
Kardinalpriester und Kardinaldiakone einherging, die in die Regierung der Kir-
che eingebunden wurden. Offenbar war dieser Anstieg weitaus stärker, als ihn
die absoluten Zahlen der Unterschriften vermuten lassen. Nicht zwischen 9 und 10,
sondern eher zwischen 12 und 13 und in manchen Jahren sogar über 14 Kardinal-
kleriker waren es, die von Innocenz II. in der zweiten Hälfte seines Pontifikats
jeweils zur Beratung und Mitarbeit im kurialen Alltag hinzugezogen wurden.
2.2.3. Die Anzahl der Unterschriften im
Verhältnis zur Gesamtzahl der Kardinalkleriker -
der Einbeziehungsgrad des höheren römischen Kardinalklerus
So interessant diese Zahlen sind, sie gewinnen noch höhere Aussagekraft,
wenn man ihnen für die einzelnen Phasen die Gesamtzahl der Angehörigen
des höheren römischen Kardinalklerus, die zur jeweiligen Zeit im Amt waren,
gegenüberstellt. Zu fragen ist jeweils, wie groß der Anteil der Kardinalkleriker,
welche die Päpste im kurialen Alltag jeweils um sich versammelten, an der
Gesamtzahl der in dieser Zeit amtierenden Kardinalbischöfe, Kardinalpriester
und Kardinaldiakone war. Für die Zeit Paschalis' II. und erst recht Urbans II.
ist dies allerdings nicht möglich: Die Gesamtzahl der Mitglieder des höheren
römischen Bischofsklerus lässt sich nicht so präzise ermitteln, als dass die er-
rechnten Zahlen im Vergleich zu den anderen Pontifikaten noch aussagekräf-
tig wärenZ'^ Sichereren Boden gewinnt man erst mit dem Pontifikat Calixts II.
Aber auch für seine Regierungszeit und die Honorius' II. muss noch damit ge-
rechnet werden, dass die überlieferten Quellen die Zahl der Kardinalkleriker
für die einzelnen Jahre zu gering erscheinen lassen. Die im Folgenden genann-
ten durchschnittlichen Gesamtzahlen sind deshalb für diese beiden Pontifikate
Mindestwerte.^ Damit aber ist der auf dieser Grundlage berechnete Anteil
217 Vgl. zu den genauen Werten im Folgenden die Anm. 232-234.
218 Gerade unter den Kardinalpriestern und Kardinaldiakonen lassen sich für die einzelnen Jah-
ren oft zu wenige greifen, als dass man sicher sein könnte, jeweils alle oder fast alle Mitglie-
der dieser beiden Ordines, die auf der Seite der Nachfolger Gregors VII. standen, erfasst zu
haben. Dass gerade unter den Kardinalpriestern und Kardinaldiakonen viele bereits längere
Zeit vor dem ersten Quellenbeleg im Amt gewesen sein müssen, zeigen besonders die For-
schungen von Rudolf HÜLS, Kardinale, S. 77-88, zur Anciennitätsfolge der Kardinalkleriker
vor 1130, auch wenn seine Folgerungen für die einzelnen Personen nicht immer zutreffen
müssen, bedenkt man die schmale Quellengrundlage seiner Beobachtungen und die Fehler in
der Reihenfolge der Unterschriften, die aller grundsätzlichen Regel zum Trotz immer wieder
auftraten. Von vielen Kardinalklerikern wissen wir aber auch nur durch ein oder zwei Quel-
lenbelege und können sie daher zeitlich überhaupt nicht genauer einordnen.
219 Und dies vor allem deshalb, weil die Gesamtzahl der Mitglieder des höheren römischen
Kardinalklerus allein auf der Basis der durch konkrete Belege gesicherten Amtszeiten berech-
net wurde, vgl. Anm. 227.