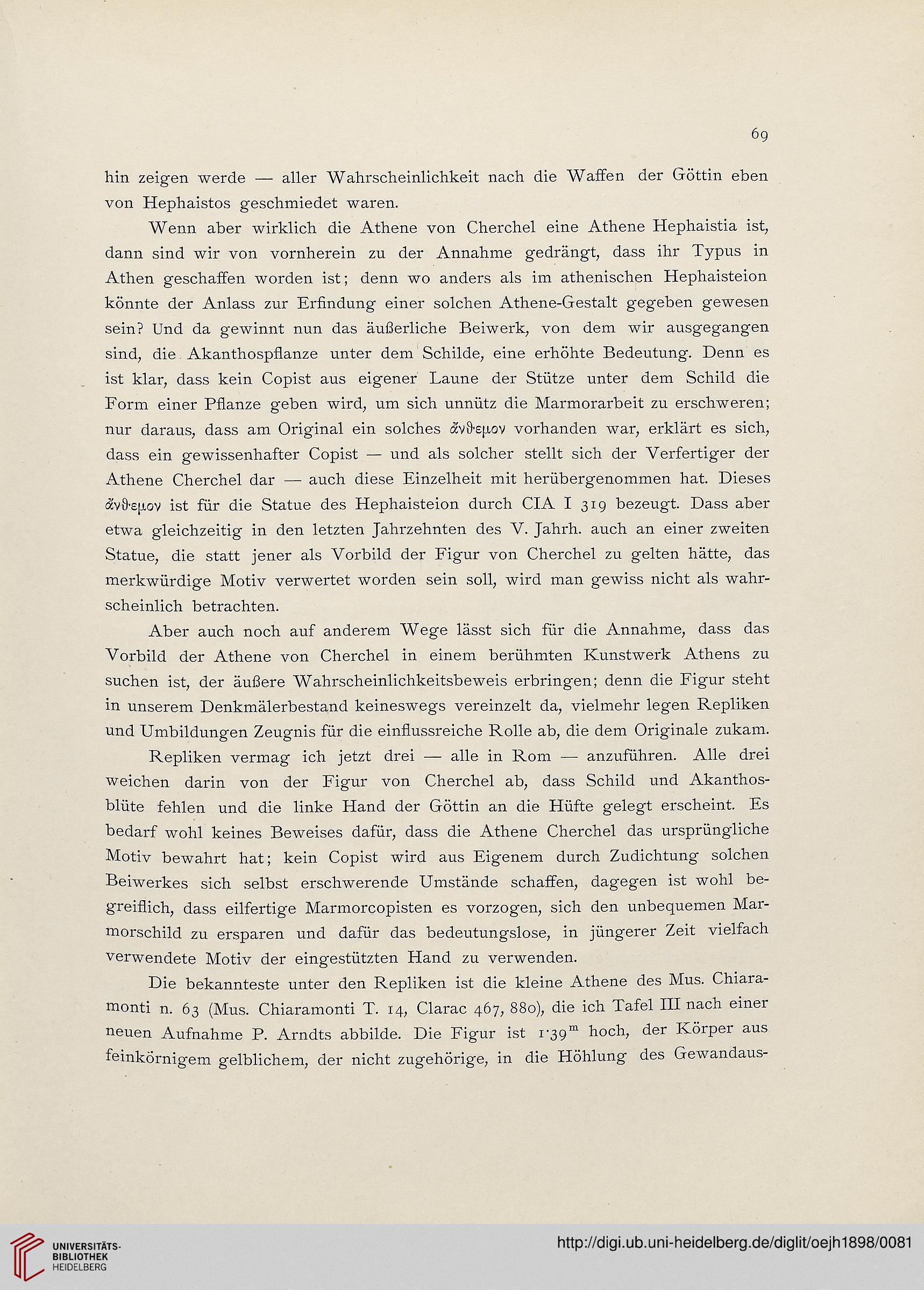6g
hin zeigen werde — aller Wahrscheinlichkeit nach die Waffen der Göttin eben
von Hephaistos geschmiedet waren.
Wenn aber wirklich die Athene von Cherchel eine Athene Hephaistia ist,
dann sind wir von vornherein zu der Annahme gedrängt, dass ihr Typus in
Athen geschaffen worden ist; denn wo anders als im athenischen Hephaisteion
könnte der Anlass zur Erfindung einer solchen Athene-Gestalt gegeben gewesen
sein? Und da gewinnt nun das äußerliche Beiwerk, von dem wir ausgegangen
sind, die Akanthospflanze unter dem Schilde, eine erhöhte Bedeutung. Denn es
ist klar, dass kein Copist aus eigener Laune der Stütze unter dem Schild die
Form einer Pflanze geben wird, um sich unnütz die Marmorarbeit zu erschweren;
nur daraus, dass am Original ein solches av9-£[Jiov vorhanden war, erklärt es sich,
dass ein gewissenhafter Copist — und als solcher stellt sich der Verfertiger der
Athene Cherchel dar — auch diese Einzelheit mit herübergenommen hat. Dieses
av9'E[xov ist für die Statue des Hephaisteion durch CIA I 31g bezeugt. Dass aber
etwa gleichzeitig in den letzten Jahrzehnten des V. Jahrh. auch an einer zweiten
Statue, die statt jener als Vorbild der Figur von Cherchel zu gelten hätte, das
merkwürdige Motiv verwertet worden sein soll, wird man gewiss nicht als wahr-
scheinlich betrachten.
Aber auch noch auf anderem Wege lässt sich für die Annahme, dass das
Vorbild der Athene von Cherchel in einem berühmten Kunstwerk Athens zu
suchen ist, der äußere Wahrscheinlichkeitsbeweis erbringen; denn die Figur steht
in unserem Denkmälerbestand keineswegs vereinzelt da, vielmehr legen Repliken
und Umbildungen Zeugnis für die einflussreiche Rolle ab, die dem Originale zukam.
Repliken vermag ich jetzt drei — alle in Rom — anzuführen. Alle drei
weichen darin von der Figur von Cherchel ab, dass Schild und Akanthos-
blüte fehlen und die linke Hand der Göttin an die Hüfte gelegt erscheint. Es
bedarf wohl keines Beweises dafür, dass die Athene Cherchel das ursprüngliche
Motiv bewahrt hat; kein Copist wird aus Eigenem durch Zudichtung solchen
Beiwerkes sich selbst erschwerende Umstände schaffen, dagegen ist wohl be-
greiflich, dass eilfertige Marmorcopisten es vorzogen, sich den unbequemen Mar-
morschild zu ersparen und dafür das bedeutungslose, in jüngerer Zeit vielfach
verwendete Motiv der eingestützten Hand zu verwenden.
Die bekannteste unter den Repliken ist die kleine Athene des Mus. Chiara-
monti n. 63 (Mus. Chiaramonti T. 14, Clarac 467, 880), die ich Tafel III nach einer
neuen Aufnahme P. Arndts abbilde. Die Figur ist r39m hoch, der Körper aus
feinkörnigem gelblichem, der nicht zugehörige, in die Höhlung des Gewandaus-
hin zeigen werde — aller Wahrscheinlichkeit nach die Waffen der Göttin eben
von Hephaistos geschmiedet waren.
Wenn aber wirklich die Athene von Cherchel eine Athene Hephaistia ist,
dann sind wir von vornherein zu der Annahme gedrängt, dass ihr Typus in
Athen geschaffen worden ist; denn wo anders als im athenischen Hephaisteion
könnte der Anlass zur Erfindung einer solchen Athene-Gestalt gegeben gewesen
sein? Und da gewinnt nun das äußerliche Beiwerk, von dem wir ausgegangen
sind, die Akanthospflanze unter dem Schilde, eine erhöhte Bedeutung. Denn es
ist klar, dass kein Copist aus eigener Laune der Stütze unter dem Schild die
Form einer Pflanze geben wird, um sich unnütz die Marmorarbeit zu erschweren;
nur daraus, dass am Original ein solches av9-£[Jiov vorhanden war, erklärt es sich,
dass ein gewissenhafter Copist — und als solcher stellt sich der Verfertiger der
Athene Cherchel dar — auch diese Einzelheit mit herübergenommen hat. Dieses
av9'E[xov ist für die Statue des Hephaisteion durch CIA I 31g bezeugt. Dass aber
etwa gleichzeitig in den letzten Jahrzehnten des V. Jahrh. auch an einer zweiten
Statue, die statt jener als Vorbild der Figur von Cherchel zu gelten hätte, das
merkwürdige Motiv verwertet worden sein soll, wird man gewiss nicht als wahr-
scheinlich betrachten.
Aber auch noch auf anderem Wege lässt sich für die Annahme, dass das
Vorbild der Athene von Cherchel in einem berühmten Kunstwerk Athens zu
suchen ist, der äußere Wahrscheinlichkeitsbeweis erbringen; denn die Figur steht
in unserem Denkmälerbestand keineswegs vereinzelt da, vielmehr legen Repliken
und Umbildungen Zeugnis für die einflussreiche Rolle ab, die dem Originale zukam.
Repliken vermag ich jetzt drei — alle in Rom — anzuführen. Alle drei
weichen darin von der Figur von Cherchel ab, dass Schild und Akanthos-
blüte fehlen und die linke Hand der Göttin an die Hüfte gelegt erscheint. Es
bedarf wohl keines Beweises dafür, dass die Athene Cherchel das ursprüngliche
Motiv bewahrt hat; kein Copist wird aus Eigenem durch Zudichtung solchen
Beiwerkes sich selbst erschwerende Umstände schaffen, dagegen ist wohl be-
greiflich, dass eilfertige Marmorcopisten es vorzogen, sich den unbequemen Mar-
morschild zu ersparen und dafür das bedeutungslose, in jüngerer Zeit vielfach
verwendete Motiv der eingestützten Hand zu verwenden.
Die bekannteste unter den Repliken ist die kleine Athene des Mus. Chiara-
monti n. 63 (Mus. Chiaramonti T. 14, Clarac 467, 880), die ich Tafel III nach einer
neuen Aufnahme P. Arndts abbilde. Die Figur ist r39m hoch, der Körper aus
feinkörnigem gelblichem, der nicht zugehörige, in die Höhlung des Gewandaus-