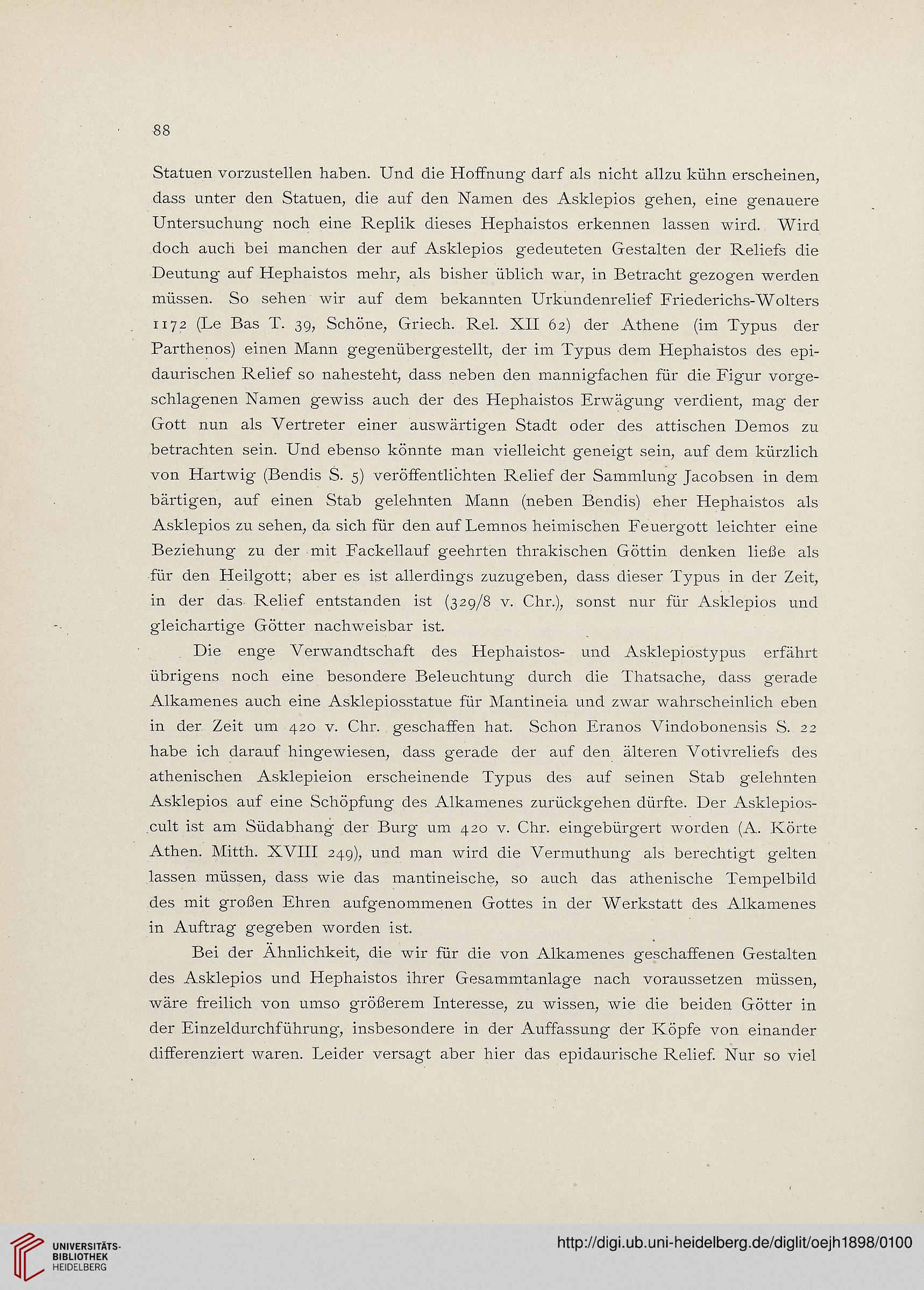Statuen vorzustellen haben. Und die Hoffnung darf als nicht allzu kühn erscheinen,
dass unter den Statuen, die auf den Namen des Asklepios gehen, eine genauere
Untersuchung noch eine Replik dieses Hephaistos erkennen lassen wird. Wird
doch auch bei manchen der auf Asklepios gedeuteten Gestalten der Reliefs die
Deutung auf Hephaistos mehr, als bisher üblich war, in Betracht gezogen werden
müssen. So sehen wir auf dem bekannten Urkundenrelief Friederichs-Wolters
ii72 (Le Bas T. 39, Schöne, Griech. Rel. XII 62) der Athene (im Typus der
Parthenos) einen Mann gegenübergestellt, der im Typus dem Hephaistos des epi-
daurischen Relief so nahesteht, dass neben den mannigfachen für die Figur vorge-
schlagenen Namen gewiss auch der des Hephaistos Erwägung verdient, mag der
Gott nun als Vertreter einer auswärtigen Stadt oder des attischen Demos zu
betrachten sein. Und ebenso könnte man vielleicht geneigt sein, auf dem kürzlich
von Hartwig (Bendis S. 5) veröffentlichten Relief der Sammlung Jacobsen in dem
bärtigen, auf einen Stab gelehnten Mann (neben Bendis) eher Hephaistos als
Asklepios zu sehen, da sich für den auf Lemnos heimischen Feuergott leichter eine
Beziehung zu der mit Fackellauf geehrten thrakischen Göttin denken ließe als
für den Heilgott; aber es ist allerdings zuzugeben, dass dieser Typus in der Zeit,
in der das Relief entstanden ist (329/8 v. Chr.), sonst nur für Asklepios und
gleichartige Götter nachweisbar ist.
Die enge Verwandtschaft des Hephaistos- und Asklepiostypus erfährt
übrigens noch eine besondere Beleuchtung durch die Thatsache, dass gerade
Alkamenes auch eine Asklepiosstatue für Mantineia und zwar wahrscheinlich eben
in der Zeit um 420 v. Chr. geschaffen hat. Schon Eranos Vindobonensis S. 22
habe ich darauf hingewiesen, dass gerade der auf den älteren Votivreliefs des
athenischen Asklepieion erscheinende Typus des auf seinen Stab gelehnten
Asklepios auf eine Schöpfung des Alkamenes zurückgehen dürfte. Der Asklepios-
cult ist am Südabhang der Burg um 420 v. Chr. eingebürgert worden (A. Körte
Athen. Mitth. XVIII 249), und man wird die Vermuthung als berechtigt gelten
lassen müssen, dass wie das mantineische, so auch das athenische Tempelbild
des mit großen Ehren aufgenommenen Gottes in der Werkstatt des Alkamenes
in Auftrag gegeben worden ist.
Bei der Ähnlichkeit, die wir für die von Alkamenes geschaffenen Gestalten
des Asklepios und Hephaistos ihrer Gesammtanlage nach voraussetzen müssen,
wäre freilich von umso größerem Interesse, zu wissen, wie die beiden Götter in
der Einzeldurchführung", insbesondere in der Auffassung der Köpfe von einander
differenziert waren. Leider versagt aber hier das epidaurische Relief. Nur so viel
dass unter den Statuen, die auf den Namen des Asklepios gehen, eine genauere
Untersuchung noch eine Replik dieses Hephaistos erkennen lassen wird. Wird
doch auch bei manchen der auf Asklepios gedeuteten Gestalten der Reliefs die
Deutung auf Hephaistos mehr, als bisher üblich war, in Betracht gezogen werden
müssen. So sehen wir auf dem bekannten Urkundenrelief Friederichs-Wolters
ii72 (Le Bas T. 39, Schöne, Griech. Rel. XII 62) der Athene (im Typus der
Parthenos) einen Mann gegenübergestellt, der im Typus dem Hephaistos des epi-
daurischen Relief so nahesteht, dass neben den mannigfachen für die Figur vorge-
schlagenen Namen gewiss auch der des Hephaistos Erwägung verdient, mag der
Gott nun als Vertreter einer auswärtigen Stadt oder des attischen Demos zu
betrachten sein. Und ebenso könnte man vielleicht geneigt sein, auf dem kürzlich
von Hartwig (Bendis S. 5) veröffentlichten Relief der Sammlung Jacobsen in dem
bärtigen, auf einen Stab gelehnten Mann (neben Bendis) eher Hephaistos als
Asklepios zu sehen, da sich für den auf Lemnos heimischen Feuergott leichter eine
Beziehung zu der mit Fackellauf geehrten thrakischen Göttin denken ließe als
für den Heilgott; aber es ist allerdings zuzugeben, dass dieser Typus in der Zeit,
in der das Relief entstanden ist (329/8 v. Chr.), sonst nur für Asklepios und
gleichartige Götter nachweisbar ist.
Die enge Verwandtschaft des Hephaistos- und Asklepiostypus erfährt
übrigens noch eine besondere Beleuchtung durch die Thatsache, dass gerade
Alkamenes auch eine Asklepiosstatue für Mantineia und zwar wahrscheinlich eben
in der Zeit um 420 v. Chr. geschaffen hat. Schon Eranos Vindobonensis S. 22
habe ich darauf hingewiesen, dass gerade der auf den älteren Votivreliefs des
athenischen Asklepieion erscheinende Typus des auf seinen Stab gelehnten
Asklepios auf eine Schöpfung des Alkamenes zurückgehen dürfte. Der Asklepios-
cult ist am Südabhang der Burg um 420 v. Chr. eingebürgert worden (A. Körte
Athen. Mitth. XVIII 249), und man wird die Vermuthung als berechtigt gelten
lassen müssen, dass wie das mantineische, so auch das athenische Tempelbild
des mit großen Ehren aufgenommenen Gottes in der Werkstatt des Alkamenes
in Auftrag gegeben worden ist.
Bei der Ähnlichkeit, die wir für die von Alkamenes geschaffenen Gestalten
des Asklepios und Hephaistos ihrer Gesammtanlage nach voraussetzen müssen,
wäre freilich von umso größerem Interesse, zu wissen, wie die beiden Götter in
der Einzeldurchführung", insbesondere in der Auffassung der Köpfe von einander
differenziert waren. Leider versagt aber hier das epidaurische Relief. Nur so viel