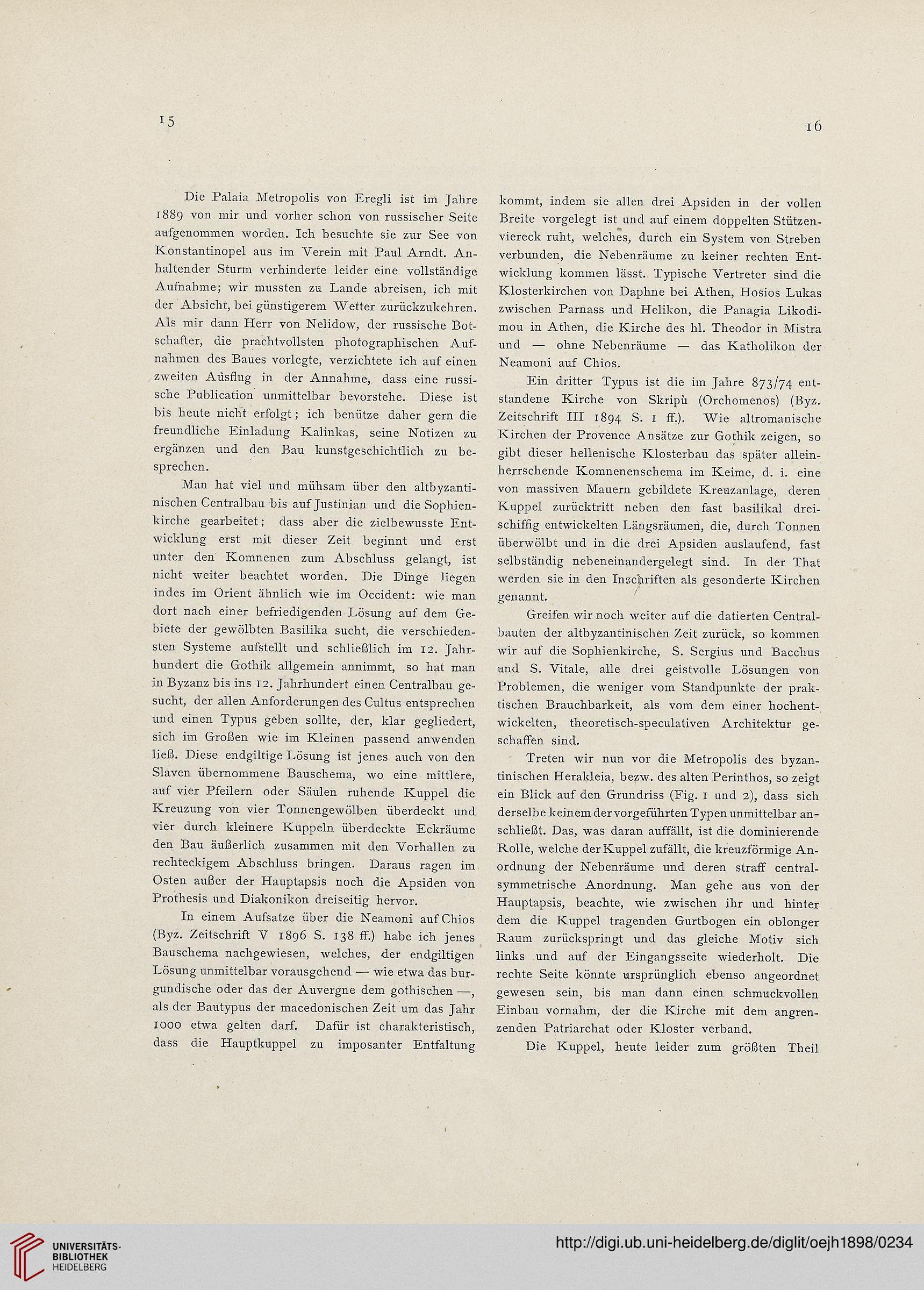15
t6
Die Palaia Metropolis von Eregli ist im Jahre
188g von mir und vorher schon von russischer Seite
aufgenommen worden. Ich besuchte sie zur See von
Konstantinopel aus im Verein mit Paul Arndt. An-
haltender Sturm verhinderte leider eine vollständige
Aufnahme; wir mussten zu Lande abreisen, ich mit
der Absicht, bei günstigerem Wetter zurückzukehren.
Als mir dann Herr von Nelidow, der russische Bot-
schafter, die prachtvollsten photographischen Auf-
nahmen des Baues vorlegte, verzichtete ich auf einen
zweiten Ausflug in der Annahme, dass eine russi-
sche Publication unmittelbar bevorstehe. Diese ist
bis heute nicht erfolgt; ich benütze daher gern die
freundliche Einladung Kalinkas, seine Notizen zu
ergänzen und den Bau kunstgeschichtlich zu be-
sprechen.
Man hat viel und mühsam über den altbyzanti-
nischen Ccntralbau bis auf Justinian und die Sophien-
kirche gearbeitet; dass aber die zielbewusste Ent-
wicklung erst mit dieser Zeit beginnt und erst
unter den Komnenen zum Abschluss gelangt, ist
nicht weiter beachtet worden. Die Dinge liegen
indes im Orient ähnlich wie im Occident: wie man
dort nach einer befriedigenden Lösung auf dem Ge-
biete der gewölbten Basilika sucht, die verschieden-
sten Systeme aufstellt und schließlich im 12. Jahr-
hundert die Gothik allgemein annimmt, so hat man
in Byzanz bis ins 12. Jahrhundert einen Centraibau ge-
sucht, der allen Anforderungen des Cultus entsprechen
und einen Typus geben sollte, der, klar gegliedert,
sich im Großen wie im Kleinen passend anwenden
ließ. Diese endgiltige Lösung ist jenes auch von den
Slaven übernommene Bauschema, wo eine mittlere,
auf vier Pfeilern oder Säulen ruhende Kuppel die
Kreuzung von vier Tonnengewölben überdeckt und
vier durch kleinere Kuppeln überdeckte Eckräume
den Bau äußerlich zusammen mit den Vorhallen zu
rechteckigem Abschluss bringen. Daraus ragen im
Osten außer der Hauptapsis noch die Apsiden von
Prothesis und Diakonikon dreiseitig hervor.
In einem Aufsatze über die Neamoni aufChios
(Byz. Zeitschrift V 1896 S. 138 ff.) habe ich jenes
Bauschema nachgewiesen, welches, der endgiltigen
Lösung unmittelbar vorausgehend — wie etwa das bur-
gundische oder das der Auvergne dem gothischen —,
als der Bautypus der macedonischen Zeit um das Jahr
1000 etwa gelten darf. Dafür ist charakteristisch,
dass die Hauptkuppel zu imposanter Entfaltung
kommt, indem sie allen drei Apsiden in der vollen
Breite vorgelegt ist und auf einem doppelten Stützen-
viereck ruht, welches, durch ein System von Streben
verbunden, die Nebenräume zu keiner rechten Ent-
wicklung kommen lässt. Typische Vertreter sind die
Klosterkirchen von Daphne bei Athen, Hosios Lukas
zwischen Parnass und Helikon, die Panagia Likodi-
mou in Athen, die Kirche des hl. Theodor in Mistra
und — ohne Nebenräume — das Katholikon der
Neamoni auf Chios.
Ein dritter Typus ist die im Jahre 873/74 ent-
standene Kirche von Skripü (Orchomenos) (Byz.
Zeitschrift III 1894 s- 1 ff-)- wie altromanische
Kirchen der Provence Ansätze zur Gothik zeigen, so
gibt dieser hellenische Klosterbau das später allein-
herrschende Komnenenschema im Keime, d. i. eine
von massiven Mauern gebildete Kreuzanlage, deren
Kuppel zurücktritt neben den fast basilikal drei-
schiffig entwickelten Längsräumen, die, durch Tonnen
überwölbt und in die drei Apsiden auslaufend, fast
selbständig nebeneinandergelegt sind. In der That
werden sie in den Insichriften als gesonderte Kirchen
genannt.
Greifen wir noch weiter auf die datierten Centrai-
bauten der altbyzantinischen Zeit zurück, so kommen
wir auf die Sophienkirche, S. Sergius und Bacchus
und S. Vitale, alle drei geistvolle Lösungen von
Problemen, die weniger vom Standpunkte der prak-
tischen Brauchbarkeit, als vom dem einer hochent-
wickelten, theoretisch-speculativen Architektur ge-
schaffen sind.
Treten wir nun vor die Metropolis des byzan-
tinischen Herakleia, bezw. des alten Perinthos, so zeigt
ein Blick auf den Grundriss (Fig. 1 und 2), dass sich
derselbe keinem der vorgeführten Typen unmittelbar an-
schließt. Das, was daran auffällt, ist die dominierende
Rolle, welche der Kuppel zufällt, die kreuzförmige An-
ordnung der Nebenräume und deren straff central-
symmetrische Anordnung. Man gehe aus von der
Hauptapsis, beachte, wie zwischen ihr und hinter
dem die Kuppel tragenden Gurtbogen ein oblonger
Raum zurückspringt und das gleiche Motiv sich
links und auf der Eingangsseite wiederholt. Die
rechte Seite könnte ursprünglich ebenso angeordnet
gewesen sein, bis man dann einen schmuckvollen
Einbau vornahm, der die Kirche mit dem angren-
zenden Patriarchat oder Kloster verband.
Die Kuppel, heute leider zum größten Theil
t6
Die Palaia Metropolis von Eregli ist im Jahre
188g von mir und vorher schon von russischer Seite
aufgenommen worden. Ich besuchte sie zur See von
Konstantinopel aus im Verein mit Paul Arndt. An-
haltender Sturm verhinderte leider eine vollständige
Aufnahme; wir mussten zu Lande abreisen, ich mit
der Absicht, bei günstigerem Wetter zurückzukehren.
Als mir dann Herr von Nelidow, der russische Bot-
schafter, die prachtvollsten photographischen Auf-
nahmen des Baues vorlegte, verzichtete ich auf einen
zweiten Ausflug in der Annahme, dass eine russi-
sche Publication unmittelbar bevorstehe. Diese ist
bis heute nicht erfolgt; ich benütze daher gern die
freundliche Einladung Kalinkas, seine Notizen zu
ergänzen und den Bau kunstgeschichtlich zu be-
sprechen.
Man hat viel und mühsam über den altbyzanti-
nischen Ccntralbau bis auf Justinian und die Sophien-
kirche gearbeitet; dass aber die zielbewusste Ent-
wicklung erst mit dieser Zeit beginnt und erst
unter den Komnenen zum Abschluss gelangt, ist
nicht weiter beachtet worden. Die Dinge liegen
indes im Orient ähnlich wie im Occident: wie man
dort nach einer befriedigenden Lösung auf dem Ge-
biete der gewölbten Basilika sucht, die verschieden-
sten Systeme aufstellt und schließlich im 12. Jahr-
hundert die Gothik allgemein annimmt, so hat man
in Byzanz bis ins 12. Jahrhundert einen Centraibau ge-
sucht, der allen Anforderungen des Cultus entsprechen
und einen Typus geben sollte, der, klar gegliedert,
sich im Großen wie im Kleinen passend anwenden
ließ. Diese endgiltige Lösung ist jenes auch von den
Slaven übernommene Bauschema, wo eine mittlere,
auf vier Pfeilern oder Säulen ruhende Kuppel die
Kreuzung von vier Tonnengewölben überdeckt und
vier durch kleinere Kuppeln überdeckte Eckräume
den Bau äußerlich zusammen mit den Vorhallen zu
rechteckigem Abschluss bringen. Daraus ragen im
Osten außer der Hauptapsis noch die Apsiden von
Prothesis und Diakonikon dreiseitig hervor.
In einem Aufsatze über die Neamoni aufChios
(Byz. Zeitschrift V 1896 S. 138 ff.) habe ich jenes
Bauschema nachgewiesen, welches, der endgiltigen
Lösung unmittelbar vorausgehend — wie etwa das bur-
gundische oder das der Auvergne dem gothischen —,
als der Bautypus der macedonischen Zeit um das Jahr
1000 etwa gelten darf. Dafür ist charakteristisch,
dass die Hauptkuppel zu imposanter Entfaltung
kommt, indem sie allen drei Apsiden in der vollen
Breite vorgelegt ist und auf einem doppelten Stützen-
viereck ruht, welches, durch ein System von Streben
verbunden, die Nebenräume zu keiner rechten Ent-
wicklung kommen lässt. Typische Vertreter sind die
Klosterkirchen von Daphne bei Athen, Hosios Lukas
zwischen Parnass und Helikon, die Panagia Likodi-
mou in Athen, die Kirche des hl. Theodor in Mistra
und — ohne Nebenräume — das Katholikon der
Neamoni auf Chios.
Ein dritter Typus ist die im Jahre 873/74 ent-
standene Kirche von Skripü (Orchomenos) (Byz.
Zeitschrift III 1894 s- 1 ff-)- wie altromanische
Kirchen der Provence Ansätze zur Gothik zeigen, so
gibt dieser hellenische Klosterbau das später allein-
herrschende Komnenenschema im Keime, d. i. eine
von massiven Mauern gebildete Kreuzanlage, deren
Kuppel zurücktritt neben den fast basilikal drei-
schiffig entwickelten Längsräumen, die, durch Tonnen
überwölbt und in die drei Apsiden auslaufend, fast
selbständig nebeneinandergelegt sind. In der That
werden sie in den Insichriften als gesonderte Kirchen
genannt.
Greifen wir noch weiter auf die datierten Centrai-
bauten der altbyzantinischen Zeit zurück, so kommen
wir auf die Sophienkirche, S. Sergius und Bacchus
und S. Vitale, alle drei geistvolle Lösungen von
Problemen, die weniger vom Standpunkte der prak-
tischen Brauchbarkeit, als vom dem einer hochent-
wickelten, theoretisch-speculativen Architektur ge-
schaffen sind.
Treten wir nun vor die Metropolis des byzan-
tinischen Herakleia, bezw. des alten Perinthos, so zeigt
ein Blick auf den Grundriss (Fig. 1 und 2), dass sich
derselbe keinem der vorgeführten Typen unmittelbar an-
schließt. Das, was daran auffällt, ist die dominierende
Rolle, welche der Kuppel zufällt, die kreuzförmige An-
ordnung der Nebenräume und deren straff central-
symmetrische Anordnung. Man gehe aus von der
Hauptapsis, beachte, wie zwischen ihr und hinter
dem die Kuppel tragenden Gurtbogen ein oblonger
Raum zurückspringt und das gleiche Motiv sich
links und auf der Eingangsseite wiederholt. Die
rechte Seite könnte ursprünglich ebenso angeordnet
gewesen sein, bis man dann einen schmuckvollen
Einbau vornahm, der die Kirche mit dem angren-
zenden Patriarchat oder Kloster verband.
Die Kuppel, heute leider zum größten Theil