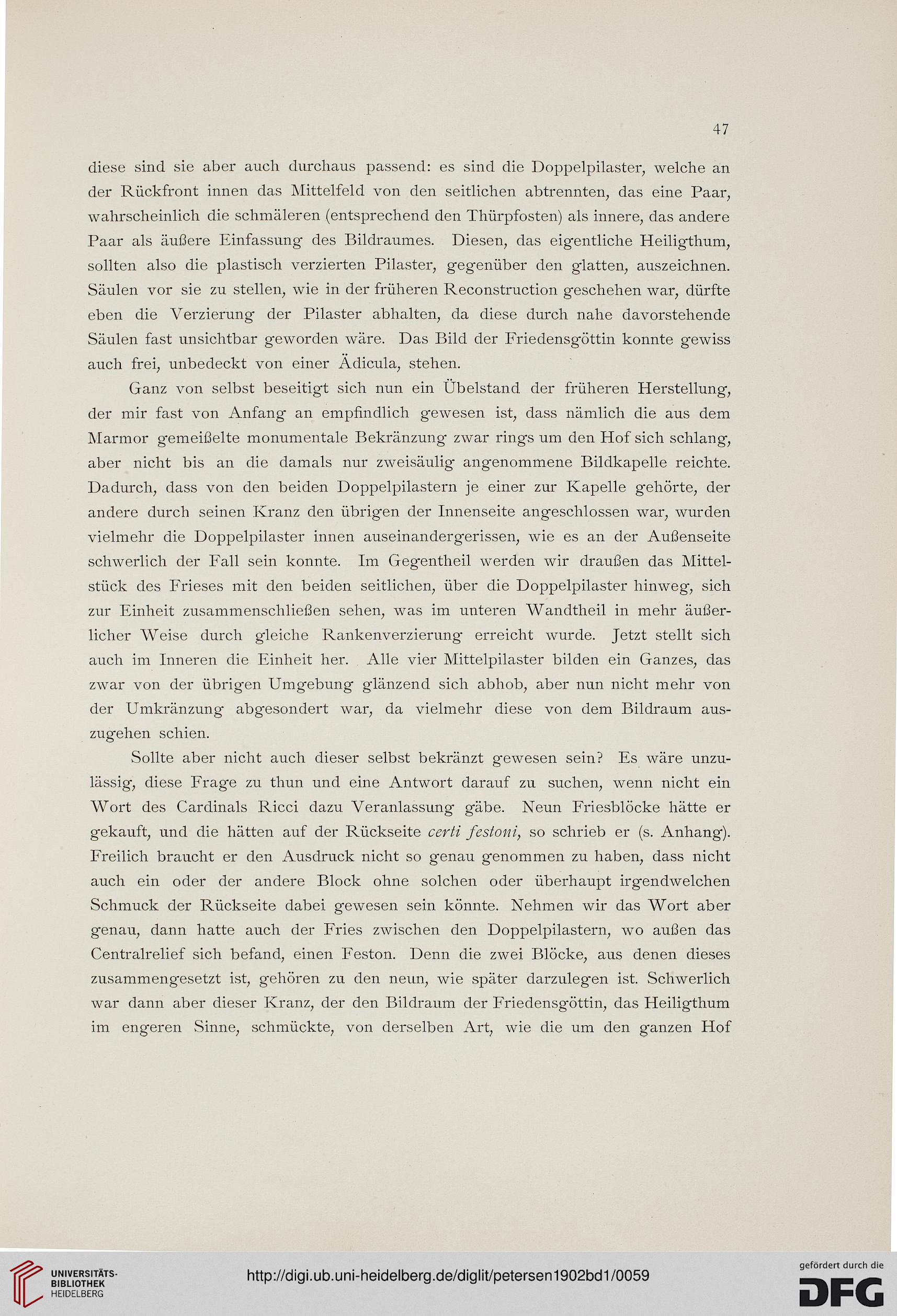47
diese sind sie aber auch durchaus passend: es sind die Doppelpilaster, welche an
der Rückfront innen das Mittelfeld von den seitlichen abtrennten, das eine Paar,
wahrscheinlich die schmäleren (entsprechend den Thürpfosten) als innere, das andere
Paar als äußere Einfassung des Bildraumes. Diesen, das eigentliche Heiligthum,
sollten also die plastisch verzierten Pilaster, gegenüber den glatten, auszeichnen.
Säulen vor sie zu stellen, wie in der früheren Reconstruction geschehen war, dürfte
eben die Verzierung der Pilaster abhalten, da diese durch nahe davorstehende
Säulen fast unsichtbar geworden wäre. Das Bild der Friedensgöttin konnte gewiss
auch frei, unbedeckt von einer Adicula, stehen.
Ganz von selbst beseitigt sich nun ein Übelstand der früheren Herstellung,
der mir fast von Anfang an empfindlich gewesen ist, dass nämlich die aus dem
Marmor gemeißelte monumentale Bekränzung zwar rings um den Hof sich schlang,
aber nicht bis an die damals nur zweisäulig angenommene Bildkapelle reichte.
Dadurch, dass von den beiden Doppelpilastern je einer zur Kapelle gehörte, der
andere durch seinen Kranz den übrigen der Innenseite angeschlossen war, wurden
vielmehr die Doppelpilaster innen auseinandergerissen, wie es an der Außenseite
schwerlich der Fall sein konnte. Im Gegentheil werden wir draußen das Mittel-
stück des Frieses mit den beiden seitlichen, über die Doppelpilaster hinweg, sich
zur Einheit zusammenschließen sehen, was im unteren Wandtheil in mehr äußer-
licher Weise durch gleiche Rankenverzierung erreicht wurde. Jetzt stellt sich
auch im Inneren die Einheit her. Alle vier Mittelpilaster bilden ein Ganzes, das
zwar von der übrigen Umgebung glänzend sich abhob, aber nun nicht mehr von
der Umkränzung abgesondert war, da vielmehr diese von dem Bildraum aus-
zugehen schien.
Sollte aber nicht auch dieser selbst bekränzt gewesen sein? Es wäre unzu-
lässig, diese Frage zu thun und eine Antwort darauf zu suchen, wenn nicht ein
Wort des Cardinais Ricci dazu Veranlassung gäbe. Neun Friesblöcke hätte er
gekauft, und die hätten auf der Rückseite certi festoni, so schrieb er (s. Anhang).
Freilich braucht er den Ausdruck nicht so genau genommen zu haben, dass nicht
auch ein oder der andere Block ohne solchen oder überhaupt irgendwelchen
Schmuck der Rückseite dabei gewesen sein könnte. Nehmen wir das Wort aber
genau, dann hatte auch der Fries zwischen den Doppelpilastern, wo außen das
Centrairelief sich befand, einen Feston. Denn die zwei Blöcke, aus denen dieses
zusammengesetzt ist, gehören zu den neun, wie später darzulegen ist. Schwerlich
war dann aber dieser Kranz, der den Bildraum der Friedensgöttin, das Heiligthum
im engeren Sinne, schmückte, von derselben Art, wie die um den ganzen Hof
diese sind sie aber auch durchaus passend: es sind die Doppelpilaster, welche an
der Rückfront innen das Mittelfeld von den seitlichen abtrennten, das eine Paar,
wahrscheinlich die schmäleren (entsprechend den Thürpfosten) als innere, das andere
Paar als äußere Einfassung des Bildraumes. Diesen, das eigentliche Heiligthum,
sollten also die plastisch verzierten Pilaster, gegenüber den glatten, auszeichnen.
Säulen vor sie zu stellen, wie in der früheren Reconstruction geschehen war, dürfte
eben die Verzierung der Pilaster abhalten, da diese durch nahe davorstehende
Säulen fast unsichtbar geworden wäre. Das Bild der Friedensgöttin konnte gewiss
auch frei, unbedeckt von einer Adicula, stehen.
Ganz von selbst beseitigt sich nun ein Übelstand der früheren Herstellung,
der mir fast von Anfang an empfindlich gewesen ist, dass nämlich die aus dem
Marmor gemeißelte monumentale Bekränzung zwar rings um den Hof sich schlang,
aber nicht bis an die damals nur zweisäulig angenommene Bildkapelle reichte.
Dadurch, dass von den beiden Doppelpilastern je einer zur Kapelle gehörte, der
andere durch seinen Kranz den übrigen der Innenseite angeschlossen war, wurden
vielmehr die Doppelpilaster innen auseinandergerissen, wie es an der Außenseite
schwerlich der Fall sein konnte. Im Gegentheil werden wir draußen das Mittel-
stück des Frieses mit den beiden seitlichen, über die Doppelpilaster hinweg, sich
zur Einheit zusammenschließen sehen, was im unteren Wandtheil in mehr äußer-
licher Weise durch gleiche Rankenverzierung erreicht wurde. Jetzt stellt sich
auch im Inneren die Einheit her. Alle vier Mittelpilaster bilden ein Ganzes, das
zwar von der übrigen Umgebung glänzend sich abhob, aber nun nicht mehr von
der Umkränzung abgesondert war, da vielmehr diese von dem Bildraum aus-
zugehen schien.
Sollte aber nicht auch dieser selbst bekränzt gewesen sein? Es wäre unzu-
lässig, diese Frage zu thun und eine Antwort darauf zu suchen, wenn nicht ein
Wort des Cardinais Ricci dazu Veranlassung gäbe. Neun Friesblöcke hätte er
gekauft, und die hätten auf der Rückseite certi festoni, so schrieb er (s. Anhang).
Freilich braucht er den Ausdruck nicht so genau genommen zu haben, dass nicht
auch ein oder der andere Block ohne solchen oder überhaupt irgendwelchen
Schmuck der Rückseite dabei gewesen sein könnte. Nehmen wir das Wort aber
genau, dann hatte auch der Fries zwischen den Doppelpilastern, wo außen das
Centrairelief sich befand, einen Feston. Denn die zwei Blöcke, aus denen dieses
zusammengesetzt ist, gehören zu den neun, wie später darzulegen ist. Schwerlich
war dann aber dieser Kranz, der den Bildraum der Friedensgöttin, das Heiligthum
im engeren Sinne, schmückte, von derselben Art, wie die um den ganzen Hof