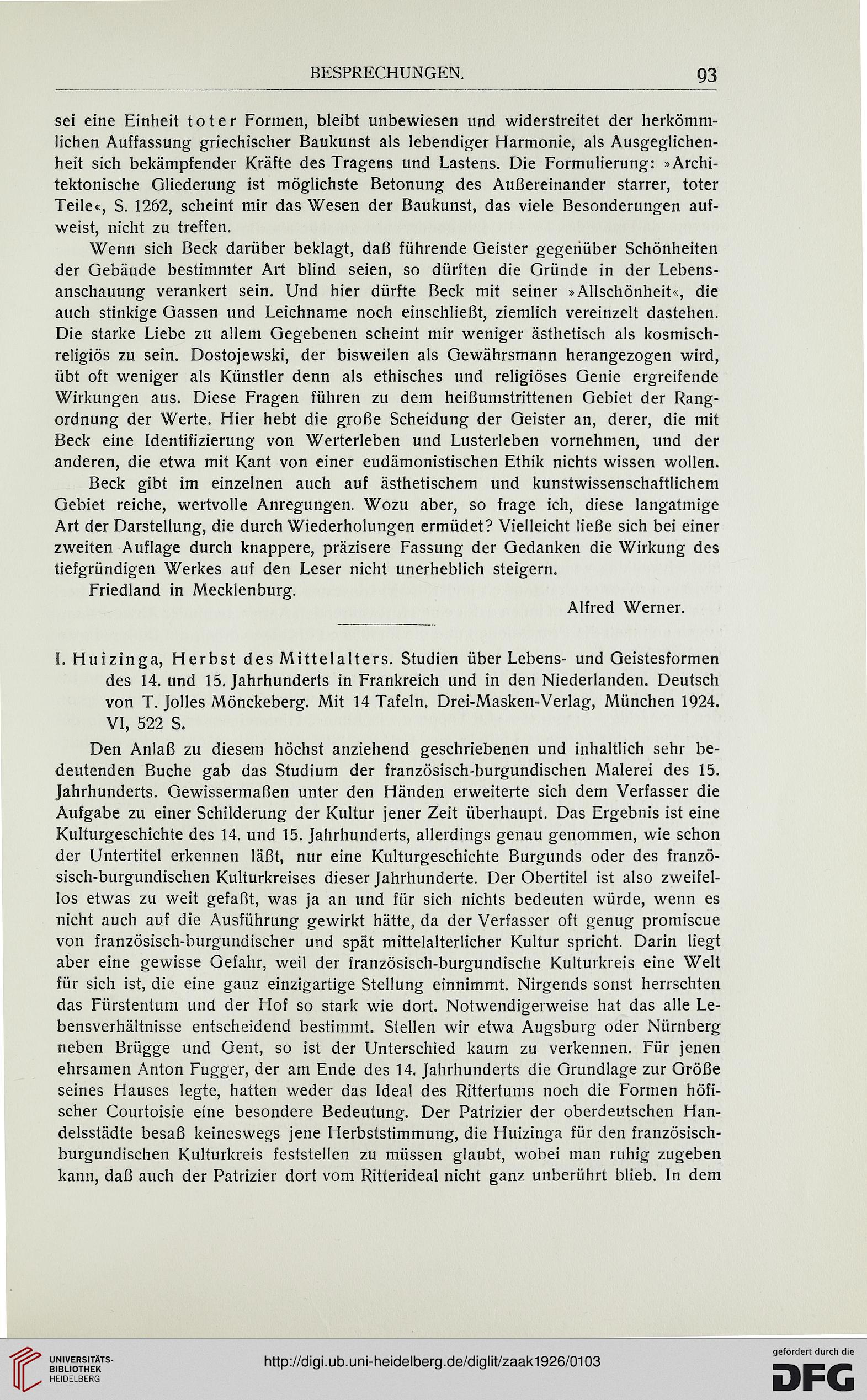BESPRECHUNGEN.
93
sei eine Einheit toter Formen, bleibt unbewiesen und widerstreitet der herkömm-
lichen Auffassung griechischer Baukunst als lebendiger Harmonie, als Ausgeglichen-
heit sich bekämpfender Kräfte des Tragens und Lastens. Die Formulierung: »Archi-
tektonische Gliederung ist möglichste Betonung des Außereinander starrer, toter
Teile«, S. 1262, scheint mir das Wesen der Baukunst, das viele Besonderungen auf-
weist, nicht zu treffen.
Wenn sich Beck darüber beklagt, daß führende Geister gegenüber Schönheiten
der Gebäude bestimmter Art blind seien, so dürften die Gründe in der Lebens-
anschauung verankert sein. Und hier dürfte Beck mit seiner »Allschönheit«, die
auch stinkige Gassen und Leichname noch einschließt, ziemlich vereinzelt dastehen.
Die starke Liebe zu allem Gegebenen scheint mir weniger ästhetisch als kosmisch-
religiös zu sein. Dostojewski, der bisweilen als Gewährsmann herangezogen wird,
übt oft weniger als Künstler denn als ethisches und religiöses Genie ergreifende
Wirkungen aus. Diese Fragen führen zu dem heißumstrittenen Gebiet der Rang-
ordnung der Werte. Hier hebt die große Scheidung der Geister an, derer, die mit
Beck eine Identifizierung von Werterleben und Lusterleben vornehmen, und der
anderen, die etwa mit Kant von einer eudämonistischen Ethik nichts wissen wollen.
Beck gibt im einzelnen auch auf ästhetischem und kunstwissenschaftlichem
Gebiet reiche, wertvolle Anregungen. Wozu aber, so frage ich, diese langatmige
Art der Darstellung, die durch Wiederholungen ermüdet? Vielleicht ließe sich bei einer
zweiten Auflage durch knappere, präzisere Fassung der Gedanken die Wirkung des
tiefgründigen Werkes auf den Leser nicht unerheblich steigern.
Friedland in Mecklenburg.
Alfred Werner.
I. Huizinga, Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen
des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden. Deutsch
von T. Jolles Mönckeberg. Mit 14 Tafeln. Drei-Masken-Verlag, München 1924.
VI, 522 S.
Den Anlaß zu diesem höchst anziehend geschriebenen und inhaltlich sehr be-
deutenden Buche gab das Studium der französisch-burgundischen Malerei des 15.
Jahrhunderts. Gewissermaßen unter den Händen erweiterte sich dem Verfasser die
Aufgabe zu einer Schilderung der Kultur jener Zeit überhaupt. Das Ergebnis ist eine
Kulturgeschichte des 14. und 15. Jahrhunderts, allerdings genau genommen, wie schon
der Untertitel erkennen läßt, nur eine Kulturgeschichte Burgunds oder des franzö-
sisch-burgundischen Kulturkreises dieser Jahrhunderte. Der Obertitel ist also zweifel-
los etwas zu weit gefaßt, was ja an und für sich nichts bedeuten würde, wenn es
nicht auch auf die Ausführung gewirkt hätte, da der Verfasser oft genug promiscue
von französisch-burgundischer und spät mittelalterlicher Kultur spricht. Darin liegt
aber eine gewisse Gefahr, weil der französisch-burgundische Kulturkreis eine Welt
für sich ist, die eine ganz einzigartige Stellung einnimmt. Nirgends sonst herrschten
das Fürstentum und der Hof so stark wie dort. Notwendigerweise hat das alle Le-
bensverhältnisse entscheidend bestimmt. Stellen wir etwa Augsburg oder Nürnberg
neben Brügge und Gent, so ist der Unterschied kaum zu verkennen. Für jenen
ehrsamen Anton Fugger, der am Ende des 14. Jahrhunderts die Grundlage zur Größe
seines Hauses legte, hatten weder das Ideal des Rittertums noch die Formen höfi-
scher Courtoisie eine besondere Bedeutung. Der Patrizier der oberdeutschen Han-
delsstädte besaß keineswegs jene Herbststimmung, die Huizinga für den französisch-
burgundischen Kulturkreis feststellen zu müssen glaubt, wobei man ruhig zugeben
kann, daß auch der Patrizier dort vom Ritterideal nicht ganz unberührt blieb. In dem
93
sei eine Einheit toter Formen, bleibt unbewiesen und widerstreitet der herkömm-
lichen Auffassung griechischer Baukunst als lebendiger Harmonie, als Ausgeglichen-
heit sich bekämpfender Kräfte des Tragens und Lastens. Die Formulierung: »Archi-
tektonische Gliederung ist möglichste Betonung des Außereinander starrer, toter
Teile«, S. 1262, scheint mir das Wesen der Baukunst, das viele Besonderungen auf-
weist, nicht zu treffen.
Wenn sich Beck darüber beklagt, daß führende Geister gegenüber Schönheiten
der Gebäude bestimmter Art blind seien, so dürften die Gründe in der Lebens-
anschauung verankert sein. Und hier dürfte Beck mit seiner »Allschönheit«, die
auch stinkige Gassen und Leichname noch einschließt, ziemlich vereinzelt dastehen.
Die starke Liebe zu allem Gegebenen scheint mir weniger ästhetisch als kosmisch-
religiös zu sein. Dostojewski, der bisweilen als Gewährsmann herangezogen wird,
übt oft weniger als Künstler denn als ethisches und religiöses Genie ergreifende
Wirkungen aus. Diese Fragen führen zu dem heißumstrittenen Gebiet der Rang-
ordnung der Werte. Hier hebt die große Scheidung der Geister an, derer, die mit
Beck eine Identifizierung von Werterleben und Lusterleben vornehmen, und der
anderen, die etwa mit Kant von einer eudämonistischen Ethik nichts wissen wollen.
Beck gibt im einzelnen auch auf ästhetischem und kunstwissenschaftlichem
Gebiet reiche, wertvolle Anregungen. Wozu aber, so frage ich, diese langatmige
Art der Darstellung, die durch Wiederholungen ermüdet? Vielleicht ließe sich bei einer
zweiten Auflage durch knappere, präzisere Fassung der Gedanken die Wirkung des
tiefgründigen Werkes auf den Leser nicht unerheblich steigern.
Friedland in Mecklenburg.
Alfred Werner.
I. Huizinga, Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen
des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden. Deutsch
von T. Jolles Mönckeberg. Mit 14 Tafeln. Drei-Masken-Verlag, München 1924.
VI, 522 S.
Den Anlaß zu diesem höchst anziehend geschriebenen und inhaltlich sehr be-
deutenden Buche gab das Studium der französisch-burgundischen Malerei des 15.
Jahrhunderts. Gewissermaßen unter den Händen erweiterte sich dem Verfasser die
Aufgabe zu einer Schilderung der Kultur jener Zeit überhaupt. Das Ergebnis ist eine
Kulturgeschichte des 14. und 15. Jahrhunderts, allerdings genau genommen, wie schon
der Untertitel erkennen läßt, nur eine Kulturgeschichte Burgunds oder des franzö-
sisch-burgundischen Kulturkreises dieser Jahrhunderte. Der Obertitel ist also zweifel-
los etwas zu weit gefaßt, was ja an und für sich nichts bedeuten würde, wenn es
nicht auch auf die Ausführung gewirkt hätte, da der Verfasser oft genug promiscue
von französisch-burgundischer und spät mittelalterlicher Kultur spricht. Darin liegt
aber eine gewisse Gefahr, weil der französisch-burgundische Kulturkreis eine Welt
für sich ist, die eine ganz einzigartige Stellung einnimmt. Nirgends sonst herrschten
das Fürstentum und der Hof so stark wie dort. Notwendigerweise hat das alle Le-
bensverhältnisse entscheidend bestimmt. Stellen wir etwa Augsburg oder Nürnberg
neben Brügge und Gent, so ist der Unterschied kaum zu verkennen. Für jenen
ehrsamen Anton Fugger, der am Ende des 14. Jahrhunderts die Grundlage zur Größe
seines Hauses legte, hatten weder das Ideal des Rittertums noch die Formen höfi-
scher Courtoisie eine besondere Bedeutung. Der Patrizier der oberdeutschen Han-
delsstädte besaß keineswegs jene Herbststimmung, die Huizinga für den französisch-
burgundischen Kulturkreis feststellen zu müssen glaubt, wobei man ruhig zugeben
kann, daß auch der Patrizier dort vom Ritterideal nicht ganz unberührt blieb. In dem