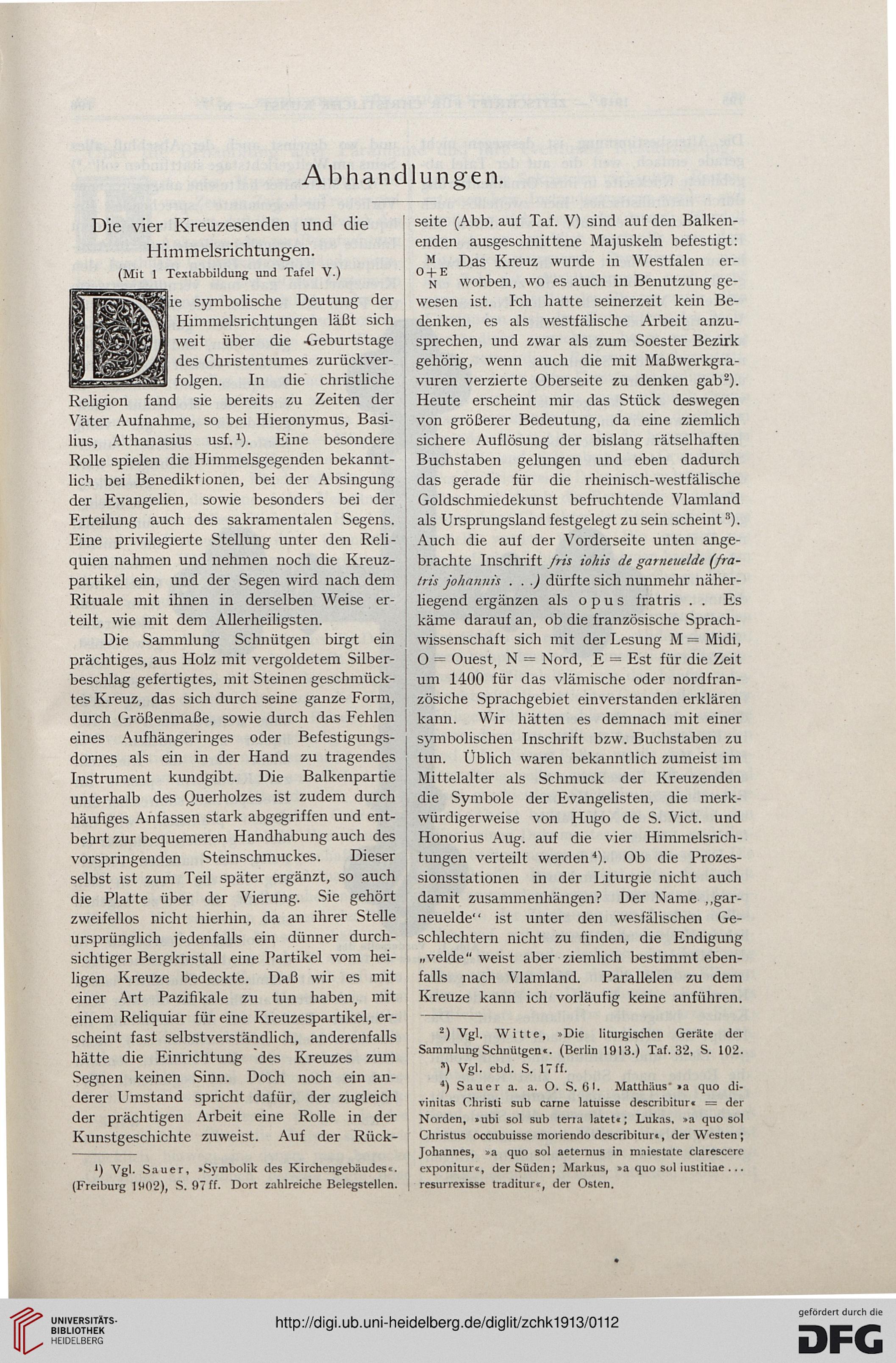Abhandlungen.
Die vier Kreuzesenden und die
H i m m elsrichtungen.
(Mit 1 Texlabbildung und Tafel V.)
jie symbolische Deutung der
Himmelsrichtungen läßt sich
weit über die .Geburtstage
des Christentumes zurückver-
folgen. In die christliche
Religion fand sie bereits zu Zeiten der
Väter Aufnahme, so bei Hieronymus, Basi-
lius, Athanasius usf.1). Eine besondere
Rolle spielen die Himmelsgegenden bekannt-
lich bei Benedikt ionen, bei der Absingung
der Evangelien, sowie besonders bei der
Erteilung auch des sakramentalen Segens.
Eine privilegierte Stellung unter den Reli-
quien nahmen und nehmen noch die Kreuz-
partikel ein, und der Segen wird nach dem
Rituale mit ihnen in derselben Weise er-
teilt, wie mit dem Allerheiligsten.
Die Sammlung Schnütgen birgt ein
prächtiges, aus Holz mit vergoldetem Silber-
beschlag gefertigtes, mit Steinen geschmück-
tes Kreuz, das sich durch seine ganze Form,
durch Größenmaße, sowie durch das Fehlen
eines Aufhängeringes oder Befestigungs-
dornes als ein in der Hand zu tragendes
Instrument kundgibt. Die Balkenpartie
unterhalb des Querholzes ist zudem durch
häufiges Anfassen stark abgegriffen und ent-
behrt zur bequemeren Handhabung auch des
vorspringenden Steinschmuckes. Dieser
selbst ist zum Teil später ergänzt, so auch
die Platte über der Vierung. Sie gehört
zweifellos nicht hierhin, da an ihrer Stelle
ursprünglich jedenfalls ein dünner durch-
sichtiger Bergkristall eine Partikel vom hei-
ligen Kreuze bedeckte. Daß wir es mit
einer Art Pazifikale zu tun haben, mit
einem Reliquiar für eine Kreuzespartikel, er-
scheint fast selbstverständlich, anderenfalls
hätte die Einrichtung des Kreuzes zum
Segnen keinen Sinn. Doch noch ein an-
derer Umstand spricht dafür, der zugleich
der prächtigen Arbeit eine Rolle in der
Kunstgeschichte zuweist. Auf der Rück-
') Vgl. Sauer, »Symbolik des Kirchengebäudes«.
(Freiburg ] 902), S. 97 ff. Dort zahlreiche Belegstellen.
seite (Abb. auf Taf. V) sind auf den Balken-
enden ausgeschnittene Majuskeln befestigt:
M Das Kreuz wurde in Westfalen er-
Q r p
n worben, wo es auch in Benutzung ge-
wesen ist. Ich hatte seinerzeit kein Be-
denken, es als westfälische Arbeit anzu-
sprechen, und zwar als zum Soester Bezirk
gehörig, wenn auch die mit Maßwerkgra-
vuren verzierte Oberseite zu denken gab2).
Heute erscheint mir das Stück deswegen
von größerer Bedeutung, da eine ziemlich
sichere Auflösung der bislang rätselhaften
Buchstaben gelungen und eben dadurch
das gerade für die rheinisch-westfälische
Goldschmiedekunst befruchtende Vlamland
als Ursprungsland festgelegt zu sein scheint3).
Auch die auf der Vorderseite unten ange-
brachte Inschrift fris iohis de gameuelde (fra-
tris johannfs . . .) dürfte sich nunmehr näher-
liegend ergänzen als opus fratris . . Es
käme darauf an, ob die französische Sprach-
wissenschaft sich mit der Lesung M = Midi,
O = Ouest, N = Nord, E = Est für die Zeit
um 1400 für das vlämische oder nordfran-
zösiche Sprachgebiet einverstanden erklären
kann. Wir hätten es demnach mit einer
symbolischen Inschrift bzw. Buchstaben zu
tun. Üblich waren bekanntlich zumeist im
Mittelalter als Schmuck der Kreuzenden
die Symbole der Evangelisten, die merk-
würdigerweise von Hugo de S. Vict. und
Honorius Aug. auf die vier Himmelsrich-
tungen verteilt werden4). Ob die Prozes-
sionsstationen in der Liturgie nicht auch
damit zusammenhängen? Der Name „gar-
neuelde" ist unter den wesfälischen Ge-
schlechtern nicht zu finden, die Endigung
„velde" weist aber ziemlich bestimmt eben-
falls nach Vlamland. Parallelen zu dem
Kreuze kann ich vorläufig keine anführen.
2) Vgl. Witte, »Die liturgischen Geräte der
Sammlung Schnütgen«. (Berlin 1913.) Taf. 32, S. 102.
") Vgl. ebd. S. 17 ff.
4) Sauer a. a. O. S. 61. Matthäus" »a quo di-
vinitas Christi sub carne latuisse describitur« = der
Norden, »ubi sol sub teria latet«; Lukas, »a quo sol
Christus occubuisse moriendo describitur«, der Westen ;
Johannes, »a quo sol aetemus in maiestate clarescere
exponitur«, der Süden; Markus, »a quo sol iustitiae ...
resurrexisse traditur«, der Osten.
Die vier Kreuzesenden und die
H i m m elsrichtungen.
(Mit 1 Texlabbildung und Tafel V.)
jie symbolische Deutung der
Himmelsrichtungen läßt sich
weit über die .Geburtstage
des Christentumes zurückver-
folgen. In die christliche
Religion fand sie bereits zu Zeiten der
Väter Aufnahme, so bei Hieronymus, Basi-
lius, Athanasius usf.1). Eine besondere
Rolle spielen die Himmelsgegenden bekannt-
lich bei Benedikt ionen, bei der Absingung
der Evangelien, sowie besonders bei der
Erteilung auch des sakramentalen Segens.
Eine privilegierte Stellung unter den Reli-
quien nahmen und nehmen noch die Kreuz-
partikel ein, und der Segen wird nach dem
Rituale mit ihnen in derselben Weise er-
teilt, wie mit dem Allerheiligsten.
Die Sammlung Schnütgen birgt ein
prächtiges, aus Holz mit vergoldetem Silber-
beschlag gefertigtes, mit Steinen geschmück-
tes Kreuz, das sich durch seine ganze Form,
durch Größenmaße, sowie durch das Fehlen
eines Aufhängeringes oder Befestigungs-
dornes als ein in der Hand zu tragendes
Instrument kundgibt. Die Balkenpartie
unterhalb des Querholzes ist zudem durch
häufiges Anfassen stark abgegriffen und ent-
behrt zur bequemeren Handhabung auch des
vorspringenden Steinschmuckes. Dieser
selbst ist zum Teil später ergänzt, so auch
die Platte über der Vierung. Sie gehört
zweifellos nicht hierhin, da an ihrer Stelle
ursprünglich jedenfalls ein dünner durch-
sichtiger Bergkristall eine Partikel vom hei-
ligen Kreuze bedeckte. Daß wir es mit
einer Art Pazifikale zu tun haben, mit
einem Reliquiar für eine Kreuzespartikel, er-
scheint fast selbstverständlich, anderenfalls
hätte die Einrichtung des Kreuzes zum
Segnen keinen Sinn. Doch noch ein an-
derer Umstand spricht dafür, der zugleich
der prächtigen Arbeit eine Rolle in der
Kunstgeschichte zuweist. Auf der Rück-
') Vgl. Sauer, »Symbolik des Kirchengebäudes«.
(Freiburg ] 902), S. 97 ff. Dort zahlreiche Belegstellen.
seite (Abb. auf Taf. V) sind auf den Balken-
enden ausgeschnittene Majuskeln befestigt:
M Das Kreuz wurde in Westfalen er-
Q r p
n worben, wo es auch in Benutzung ge-
wesen ist. Ich hatte seinerzeit kein Be-
denken, es als westfälische Arbeit anzu-
sprechen, und zwar als zum Soester Bezirk
gehörig, wenn auch die mit Maßwerkgra-
vuren verzierte Oberseite zu denken gab2).
Heute erscheint mir das Stück deswegen
von größerer Bedeutung, da eine ziemlich
sichere Auflösung der bislang rätselhaften
Buchstaben gelungen und eben dadurch
das gerade für die rheinisch-westfälische
Goldschmiedekunst befruchtende Vlamland
als Ursprungsland festgelegt zu sein scheint3).
Auch die auf der Vorderseite unten ange-
brachte Inschrift fris iohis de gameuelde (fra-
tris johannfs . . .) dürfte sich nunmehr näher-
liegend ergänzen als opus fratris . . Es
käme darauf an, ob die französische Sprach-
wissenschaft sich mit der Lesung M = Midi,
O = Ouest, N = Nord, E = Est für die Zeit
um 1400 für das vlämische oder nordfran-
zösiche Sprachgebiet einverstanden erklären
kann. Wir hätten es demnach mit einer
symbolischen Inschrift bzw. Buchstaben zu
tun. Üblich waren bekanntlich zumeist im
Mittelalter als Schmuck der Kreuzenden
die Symbole der Evangelisten, die merk-
würdigerweise von Hugo de S. Vict. und
Honorius Aug. auf die vier Himmelsrich-
tungen verteilt werden4). Ob die Prozes-
sionsstationen in der Liturgie nicht auch
damit zusammenhängen? Der Name „gar-
neuelde" ist unter den wesfälischen Ge-
schlechtern nicht zu finden, die Endigung
„velde" weist aber ziemlich bestimmt eben-
falls nach Vlamland. Parallelen zu dem
Kreuze kann ich vorläufig keine anführen.
2) Vgl. Witte, »Die liturgischen Geräte der
Sammlung Schnütgen«. (Berlin 1913.) Taf. 32, S. 102.
") Vgl. ebd. S. 17 ff.
4) Sauer a. a. O. S. 61. Matthäus" »a quo di-
vinitas Christi sub carne latuisse describitur« = der
Norden, »ubi sol sub teria latet«; Lukas, »a quo sol
Christus occubuisse moriendo describitur«, der Westen ;
Johannes, »a quo sol aetemus in maiestate clarescere
exponitur«, der Süden; Markus, »a quo sol iustitiae ...
resurrexisse traditur«, der Osten.