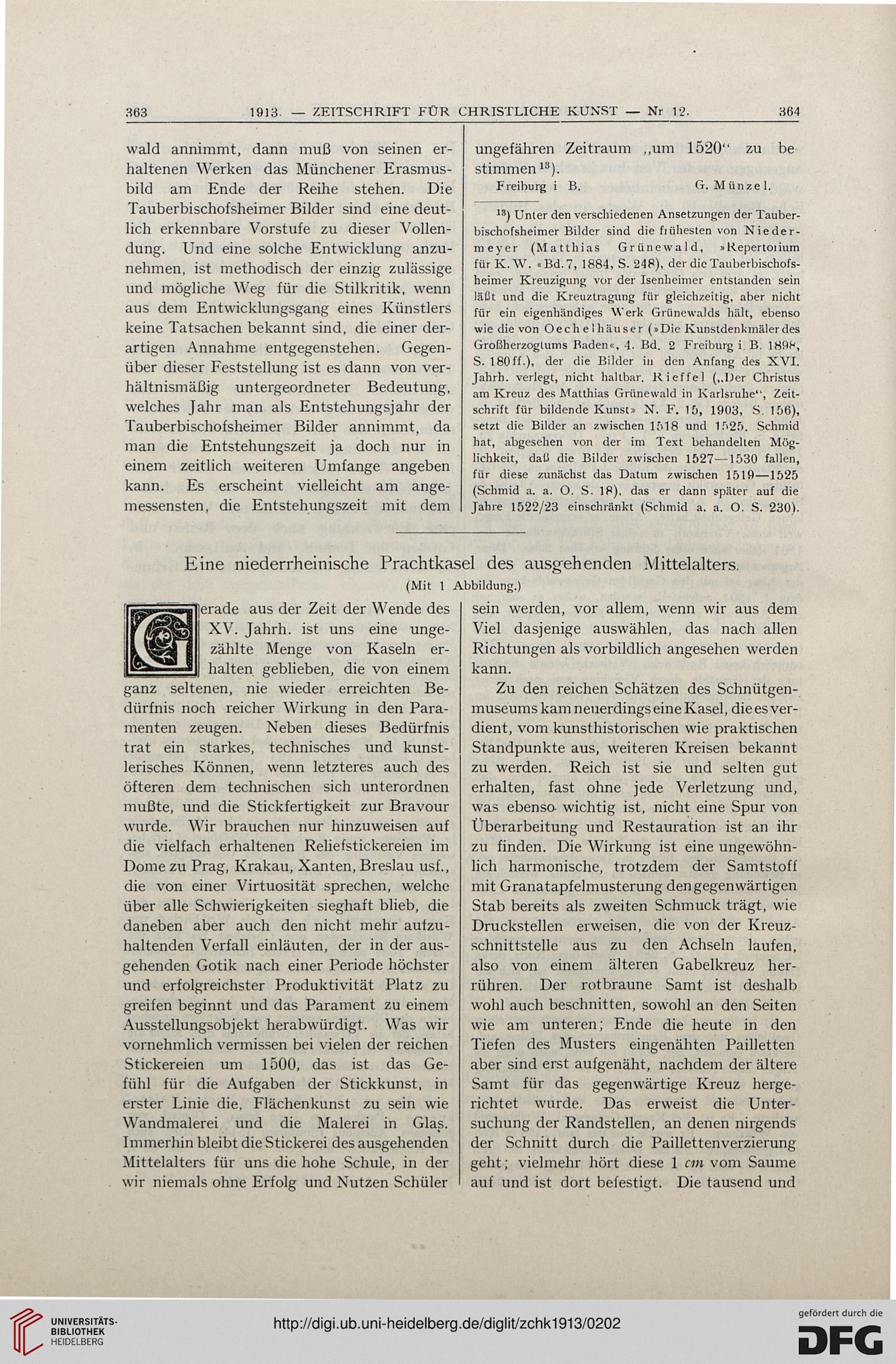363
19)3-
ZETTSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 12.
364
wald annimmt, dann muß von seinen er-
haltenen Werken das Münchener Erasmus-
bild am Ende der Reihe stehen. Die
Tauberbischofsheimer Bilder sind eine deut-
lich erkennbare Vorstufe zu dieser Vollen-
dung. Und eine solche Entwicklung anzu-
nehmen, ist methodisch der einzig zulässige
und mögliche Weg für die Stilkritik, wenn
aus dem Entwicklungsgang eines Künstlers
keine Tatsachen bekannt sind, die einer der-
artigen Annahme entgegenstehen. Gegen-
über dieser Feststellung ist es dann von ver-
hältnismäßig untergeordneter Bedeutung,
welches Jahr man als Entstehungsjahr der
Tauberbischofsheimer Bilder annimmt, da
man die Entstehungszeit ja doch nur in
einem zeitlich weiteren Umfange angeben
kann. Es erscheint vielleicht am ange-
messensten, die Entstehungszeit mit dem
ungefähren Zeitraum
stimmen13).
Freiburg i B.
,um 1520" zu be
G. Münze I.
13) Unter den verschiedenen Ansetzungen der Tauber-
bischofsheimer Bilder sind die frühesten von Nieder-
meyer (Matthias Grünewald, »Repertoiium
für K.W. «Bd. 7, 1884, S. 248), der die Tauberbischof s-
heimer Kreuzigung vor der Isenheimer entstanden sein
laut und die Kreuztragung für gleichzeitig, aber nicht
für ein eigenhändiges Werk Grunewalds hält, ebenso
wie die von Oech elhäuser (»Die Kunstdenkmäler des
Großherzogtums Baden«, 4. Bd. 2 Freiburg i B. 189H,
S. 180 ff.), der die Bilder in den Anfang des XVI.
Jahrh. verlegt, nicht haltbar. Rieffei (,.IJer Christus
am Kreuz des Matthias Grünewald in Karlsruhe", Zeit-
schrift für bildende Kunst» N. F. 15, 1903, S. 156),
setzt die Bilder an zwischen 1518 und 1.52.5. Schmid
hat, abgesehen von der im Text behandelten Mög-
lichkeit, daß die Bilder zwischen 1527—1530 fallen,
für diese zunächst das Datum zwischen 1519—1525
(Schmid a. a. O. S. 18), das er dann später auf die
Jahre 1522/23 einschränkt (Schmid a. a. O. S. 230).
Eine niederrheinische Prachtkasel des ausgehenden Mittelalters.
(Mit 1 Abbildung.)
erade aus der Zeit der Wende des
XV. Jahrh. ist uns eine unge-
zählte Menge von Kasein er-
halten geblieben, die von einem
ganz seltenen, nie wieder erreichten Be-
dürfnis noch reicher Wirkung in den Para-
menten zeugen. Neben dieses Bedürfnis
trat ein starkes, technisches und künst-
lerisches Können, wenn letzteres auch des
öfteren dem technischen sich unterordnen
mußte, und die Stickfertigkeit zur Bravour
wurde. Wir brauchen nur hinzuweisen auf
die vielfach erhaltenen Reliefstickereien im
Dome zu Prag, Krakau, Xanten, Breslau usf.,
die von einer Virtuosität sprechen, welche
über alle Schwierigkeiten sieghaft blieb, die
daneben aber auch den nicht mehr autzu-
haltenden Verfall einläuten, der in der aus-
gehenden Gotik nach einer Periode höchster
und erfolgreichster Produktivität Platz zu
greifen beginnt und das Parament zu einem
Ausstellungsobjekt herabwürdigt. Was wir
vornehmlich vermissen bei vielen der reichen
Stickereien um 1500, das ist das Ge-
fühl für die Aufgaben der Stickkunst, in
erster Linie die, Flächenkunst zu sein wie
Wandmalerei und die Malerei in Glas.
Immerhin bleibt die Stickerei des ausgehenden
Mittelalters für uns die hohe Schule, in der
wir niemals ohne Erfolg und Nutzen Schüler
sein werden, vor allem, wenn wir aus dem
Viel dasjenige auswählen, das nach allen
Richtungen als vorbildlich angesehen werden
kann.
Zu den reichen Schätzen des Schnütgen-
museums kam neuerdings eine Kasel, die es ver-
dient, vom kunsthistorischen wie praktischen
Standpunkte aus, weiteren Kreisen bekannt
zu werden. Reich ist sie und selten gut
erhalten, fast ohne jede Verletzung und,
was ebenso wichtig ist, nicht eine Spur von
Überarbeitung und Restauration ist an ihr
zu finden. Die Wirkung ist eine ungewöhn-
lich harmonische, trotzdem der Samtstoff
mit Granatapfelmusterung den gegenwärtigen
Stab bereits als zweiten Schmuck trägt, wie
Druckstellen erweisen, die von der Kreuz-
schnittstelle aus zu den Achseln laufen,
also von einem älteren Gabelkreuz her-
rühren. Der rotbraune Samt ist deshalb
wohl auch beschnitten, sowohl an den Seiten
wie am unteren; Ende die heute in den
Tiefen des Musters eingenähten Pailletten
aber sind erst aufgenäht, nachdem der ältere
Samt für das gegenwärtige Kreuz herge-
richtet wurde. Das erweist die Unter-
suchung der Randstellen, an denen nirgends
der Schnitt durch die Paillettenverzierung
geht; vielmehr hört diese 1 cm vom Saume
auf und ist dort befestigt. Die tausend und
19)3-
ZETTSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 12.
364
wald annimmt, dann muß von seinen er-
haltenen Werken das Münchener Erasmus-
bild am Ende der Reihe stehen. Die
Tauberbischofsheimer Bilder sind eine deut-
lich erkennbare Vorstufe zu dieser Vollen-
dung. Und eine solche Entwicklung anzu-
nehmen, ist methodisch der einzig zulässige
und mögliche Weg für die Stilkritik, wenn
aus dem Entwicklungsgang eines Künstlers
keine Tatsachen bekannt sind, die einer der-
artigen Annahme entgegenstehen. Gegen-
über dieser Feststellung ist es dann von ver-
hältnismäßig untergeordneter Bedeutung,
welches Jahr man als Entstehungsjahr der
Tauberbischofsheimer Bilder annimmt, da
man die Entstehungszeit ja doch nur in
einem zeitlich weiteren Umfange angeben
kann. Es erscheint vielleicht am ange-
messensten, die Entstehungszeit mit dem
ungefähren Zeitraum
stimmen13).
Freiburg i B.
,um 1520" zu be
G. Münze I.
13) Unter den verschiedenen Ansetzungen der Tauber-
bischofsheimer Bilder sind die frühesten von Nieder-
meyer (Matthias Grünewald, »Repertoiium
für K.W. «Bd. 7, 1884, S. 248), der die Tauberbischof s-
heimer Kreuzigung vor der Isenheimer entstanden sein
laut und die Kreuztragung für gleichzeitig, aber nicht
für ein eigenhändiges Werk Grunewalds hält, ebenso
wie die von Oech elhäuser (»Die Kunstdenkmäler des
Großherzogtums Baden«, 4. Bd. 2 Freiburg i B. 189H,
S. 180 ff.), der die Bilder in den Anfang des XVI.
Jahrh. verlegt, nicht haltbar. Rieffei (,.IJer Christus
am Kreuz des Matthias Grünewald in Karlsruhe", Zeit-
schrift für bildende Kunst» N. F. 15, 1903, S. 156),
setzt die Bilder an zwischen 1518 und 1.52.5. Schmid
hat, abgesehen von der im Text behandelten Mög-
lichkeit, daß die Bilder zwischen 1527—1530 fallen,
für diese zunächst das Datum zwischen 1519—1525
(Schmid a. a. O. S. 18), das er dann später auf die
Jahre 1522/23 einschränkt (Schmid a. a. O. S. 230).
Eine niederrheinische Prachtkasel des ausgehenden Mittelalters.
(Mit 1 Abbildung.)
erade aus der Zeit der Wende des
XV. Jahrh. ist uns eine unge-
zählte Menge von Kasein er-
halten geblieben, die von einem
ganz seltenen, nie wieder erreichten Be-
dürfnis noch reicher Wirkung in den Para-
menten zeugen. Neben dieses Bedürfnis
trat ein starkes, technisches und künst-
lerisches Können, wenn letzteres auch des
öfteren dem technischen sich unterordnen
mußte, und die Stickfertigkeit zur Bravour
wurde. Wir brauchen nur hinzuweisen auf
die vielfach erhaltenen Reliefstickereien im
Dome zu Prag, Krakau, Xanten, Breslau usf.,
die von einer Virtuosität sprechen, welche
über alle Schwierigkeiten sieghaft blieb, die
daneben aber auch den nicht mehr autzu-
haltenden Verfall einläuten, der in der aus-
gehenden Gotik nach einer Periode höchster
und erfolgreichster Produktivität Platz zu
greifen beginnt und das Parament zu einem
Ausstellungsobjekt herabwürdigt. Was wir
vornehmlich vermissen bei vielen der reichen
Stickereien um 1500, das ist das Ge-
fühl für die Aufgaben der Stickkunst, in
erster Linie die, Flächenkunst zu sein wie
Wandmalerei und die Malerei in Glas.
Immerhin bleibt die Stickerei des ausgehenden
Mittelalters für uns die hohe Schule, in der
wir niemals ohne Erfolg und Nutzen Schüler
sein werden, vor allem, wenn wir aus dem
Viel dasjenige auswählen, das nach allen
Richtungen als vorbildlich angesehen werden
kann.
Zu den reichen Schätzen des Schnütgen-
museums kam neuerdings eine Kasel, die es ver-
dient, vom kunsthistorischen wie praktischen
Standpunkte aus, weiteren Kreisen bekannt
zu werden. Reich ist sie und selten gut
erhalten, fast ohne jede Verletzung und,
was ebenso wichtig ist, nicht eine Spur von
Überarbeitung und Restauration ist an ihr
zu finden. Die Wirkung ist eine ungewöhn-
lich harmonische, trotzdem der Samtstoff
mit Granatapfelmusterung den gegenwärtigen
Stab bereits als zweiten Schmuck trägt, wie
Druckstellen erweisen, die von der Kreuz-
schnittstelle aus zu den Achseln laufen,
also von einem älteren Gabelkreuz her-
rühren. Der rotbraune Samt ist deshalb
wohl auch beschnitten, sowohl an den Seiten
wie am unteren; Ende die heute in den
Tiefen des Musters eingenähten Pailletten
aber sind erst aufgenäht, nachdem der ältere
Samt für das gegenwärtige Kreuz herge-
richtet wurde. Das erweist die Unter-
suchung der Randstellen, an denen nirgends
der Schnitt durch die Paillettenverzierung
geht; vielmehr hört diese 1 cm vom Saume
auf und ist dort befestigt. Die tausend und