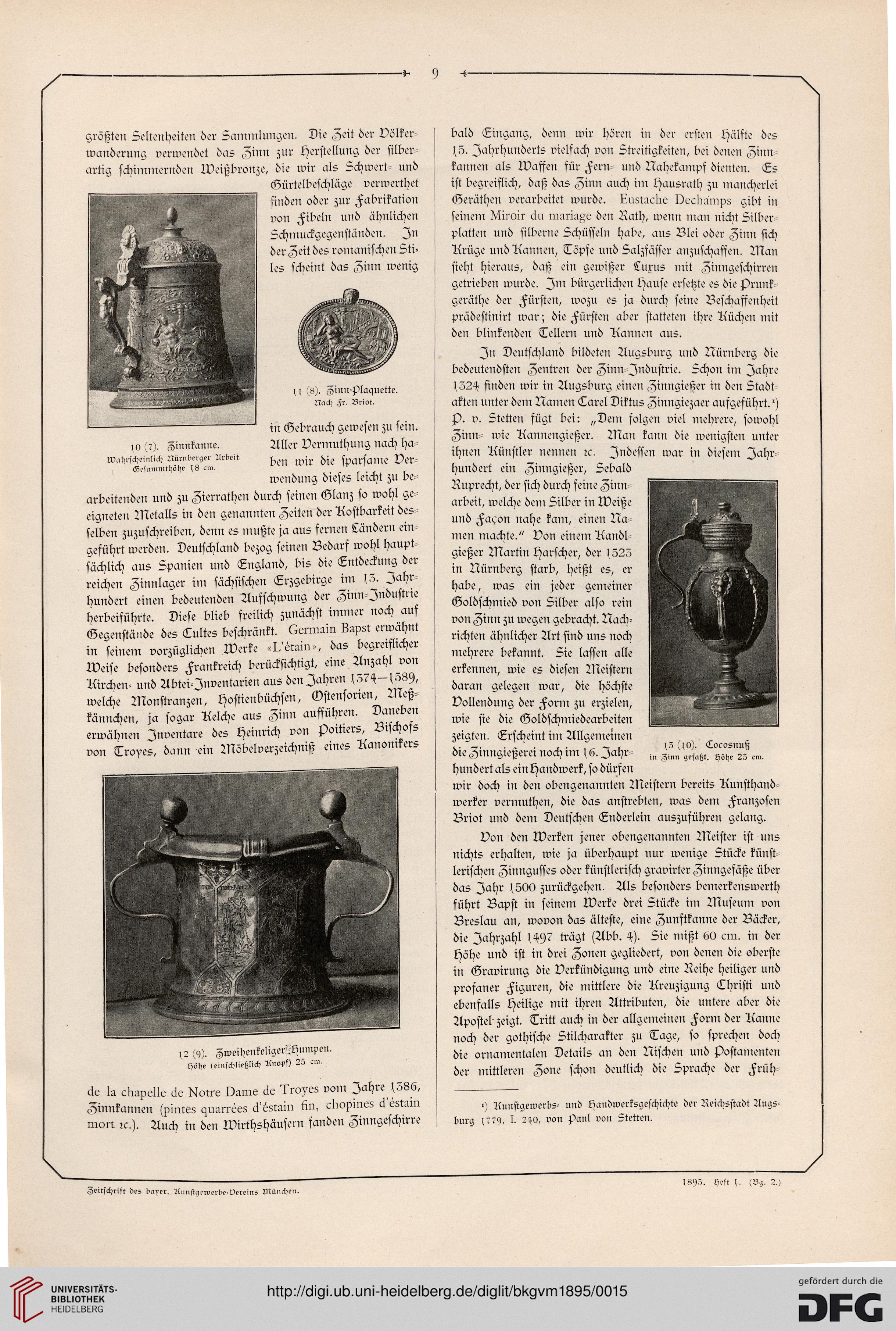/
9
größten Seltenheiten der Sammlungen. Die Zeit der Völker
Wanderung verwendet das Zinn zur Herstellung der silber
artig schimmernden Weißbronze, die wir als Schwert und
Gürtelbeschläge verwerthet
finden oder zur Fabrikation
von Fibeln und ähnlichen
Schmuckgegenständen. In
der Zeit des romanischen Sti-
les scheint das Zinn wenig
! 1 (8). Zinn-Plaquette.
Nach Fr. Briot.
in Gebrauch gewesen zu sein.
Aller Vermuthung nach ha
ben wir die sparsame Ver-
wendung dieses leicht zu be-
arbeitenden und zu Zierrathen durch seinen Glanz so wohl ge-
eigneten Metalls in den genannten Zeiten der Kostbarkeit des-
selben zuzuschreiben, denn es mußte ja aus fernen Ländern ein-
geführt werden. Deutschland bezog seinen Bedarf wohl Haupt
sächlich aus Spanien und England, bis die Entdeckung der
reichen Zinnlager im sächsischen Erzgebirge im \5. Jahr-
hundert einen bedeutenden Aufschwung der Zinn-Industrie
herbeiführte. Diese blieb freilich zunächst immer noch auf
Gegenstände des Lultes beschränkt. Gennain Bapst erwähnt
in seinem vorzüglichen Werke «L’etain», das begreiflicher
Weise besonders Frankreich berücksichtigt, eine Anzahl von
Rirchen- und Abtei-Invcntarien aus den Jahren s37H—\58ty,
welche Monstranzen, Hostienbüchsen, Ostensorien, Meß-
kännchen, ja sogar Reiche aus Zinn aufführen. Daneben
erwähnen Inventars des Heinrich von poitiers, Bischofs
von Troyes, dann ein Möbelverzeichniß eines Ranonikers
\0 (7). Ainnkanne.
Wahrscheinlich Nürnberger Arbeit.
Gesammthöhe J8 cm.
\ 2 (9). Zweihenkeliger^Humpen.
Höhe <einschließlich Anopf) 25 cm.
de la chapelle de Notre Dame de Troyes vom Jahre J586,
Zinnkannen (pintes quarrees d’6stain fin, chopines d'estain
nun t ic.). Auch in den Wirthshäusein fanden Zinngeschirre
bald Eingang, denn wir hören in der ersten Hälfte des
sä. Jahrhunderts vielfach von Streitigkeiten, bei denen Zinn-
kannen als Waffen für Fern- und Nahekampf dienten. Es
ist begreiflich, daß das Zinn auch im Hausrath zu mancherlei
Geräthen verarbeitet wurde. Eustache Dechämps gibt in
seinem Miroir du mariage den Rath, wenn man nicht Silber-
platten und silberne Schüsseln habe, aus Blei oder Zinn sich
Rrüge und Rannen, Töpfe und Salzfässer anzuschaffen. Man
sieht hieraus, daß ein gewißer Luxus mit Zinngeschirren
getrieben wurde. Im bürgerlichen Hause ersetzte es die Prunk
geräthe der Fürsten, wozu es ja durch feine Beschaffenheit
prädestinirt war; die Fürsten aber statteten ihre Rüchen mit
den blinkenden Tellern und Rannen aus.
In Deutschland bildeten Augsburg und Nürnberg die
bedeutendsten Zentren der Zinn-Industrie. Schon im Jahre
s32H finden wir in Augsburg einen Zinngießer in den Stadt
akten unter dem Namen Larel Diktus Zinngiezaer aufgeführt.■)
p. v. Stetten fügt bei: „Dem folgen viel mehrere, sowohl
Zinn- wie Rannengießer. Man kann die wenigsten unter
ihnen Rünstler nennen ic. Indessen war in diesem Jahr-
hundert ein Zinngießer, Sebald
Ruprecht, der sich durch feine Zinn
arbeit, welche dem Silber in Weiße
und Fai^on nahe kam, einen Na-
men machte." Von einem Randl-
gießer Martin Harscher, der \52o
in Nürnberg starb, heißt es, er
habe, was ein jeder gemeiner
Goldschmied von Silber also rein
von Zinn zu wegen gebracht. Nach-
richten ähnlicher Art sind uns noch
mehrere bekannt. Sie lassen alle
erkennen, wie es diesen Meistern
daran gelegen war, die höchste
Vollendung der Form zu erzielen,
wie sie die Goldschmiedearbeiten
zeigten. Erscheint im Allgemeinen
die Zinngießerei noch im J6. Jahr
hundert als ein Handwerk, so dürfen
wir doch in den obengenannten Meistern bereits Runsthand
werter vermuthen, die das anstrebten, was dem Franzosen
Briot und dem Deutschen Enderlein auszuführen gelang.
Von den Werken jener obengenannten Meister ist uns
nichts erhalten, wie ja überhaupt nur wenige Stücke künst-
lerischen Zinngusses oder künstlerisch gravirter Zinngefäße über
das Jahr 1300 zurückgehen. Als besonders bemerkenswerth
führt Bapst in seinem Werke drei Stücke im Museum von
Breslau an, wovon das älteste, eine Zunftkanne der Bäcker,
die Iahrzahl \^7 trägt (Abb. qch Sie mißt 60 cm. in der
Höhe und ist in drei Zonen gegliedert, von denen die oberste
in Gravirung die Verkündigung und eine Reihe heiliger und
profaner Figuren, die mittlere die Rreuzigung Lhristi und
ebenfalls Heilige mit ihren Attributen, die untere aber die
Apostel zeigt. Tritt auch in der allgemeinen Form der Ranne
noch der gothische Stilcharakter zu Tage, so sprechen doch
die ornamentalen Details an den Nischen und Postamenten
der mittleren Zone schon deutlich die Sprache der Früh
') Kunstgewerbs- und Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augs-
burg (779, I. 2-m, von Paul von Stetten.
V
Zeitschrift des bnyer. Aunstgenierhe-Vereins München.
1895. Heft (Bg. 2.)
9
größten Seltenheiten der Sammlungen. Die Zeit der Völker
Wanderung verwendet das Zinn zur Herstellung der silber
artig schimmernden Weißbronze, die wir als Schwert und
Gürtelbeschläge verwerthet
finden oder zur Fabrikation
von Fibeln und ähnlichen
Schmuckgegenständen. In
der Zeit des romanischen Sti-
les scheint das Zinn wenig
! 1 (8). Zinn-Plaquette.
Nach Fr. Briot.
in Gebrauch gewesen zu sein.
Aller Vermuthung nach ha
ben wir die sparsame Ver-
wendung dieses leicht zu be-
arbeitenden und zu Zierrathen durch seinen Glanz so wohl ge-
eigneten Metalls in den genannten Zeiten der Kostbarkeit des-
selben zuzuschreiben, denn es mußte ja aus fernen Ländern ein-
geführt werden. Deutschland bezog seinen Bedarf wohl Haupt
sächlich aus Spanien und England, bis die Entdeckung der
reichen Zinnlager im sächsischen Erzgebirge im \5. Jahr-
hundert einen bedeutenden Aufschwung der Zinn-Industrie
herbeiführte. Diese blieb freilich zunächst immer noch auf
Gegenstände des Lultes beschränkt. Gennain Bapst erwähnt
in seinem vorzüglichen Werke «L’etain», das begreiflicher
Weise besonders Frankreich berücksichtigt, eine Anzahl von
Rirchen- und Abtei-Invcntarien aus den Jahren s37H—\58ty,
welche Monstranzen, Hostienbüchsen, Ostensorien, Meß-
kännchen, ja sogar Reiche aus Zinn aufführen. Daneben
erwähnen Inventars des Heinrich von poitiers, Bischofs
von Troyes, dann ein Möbelverzeichniß eines Ranonikers
\0 (7). Ainnkanne.
Wahrscheinlich Nürnberger Arbeit.
Gesammthöhe J8 cm.
\ 2 (9). Zweihenkeliger^Humpen.
Höhe <einschließlich Anopf) 25 cm.
de la chapelle de Notre Dame de Troyes vom Jahre J586,
Zinnkannen (pintes quarrees d’6stain fin, chopines d'estain
nun t ic.). Auch in den Wirthshäusein fanden Zinngeschirre
bald Eingang, denn wir hören in der ersten Hälfte des
sä. Jahrhunderts vielfach von Streitigkeiten, bei denen Zinn-
kannen als Waffen für Fern- und Nahekampf dienten. Es
ist begreiflich, daß das Zinn auch im Hausrath zu mancherlei
Geräthen verarbeitet wurde. Eustache Dechämps gibt in
seinem Miroir du mariage den Rath, wenn man nicht Silber-
platten und silberne Schüsseln habe, aus Blei oder Zinn sich
Rrüge und Rannen, Töpfe und Salzfässer anzuschaffen. Man
sieht hieraus, daß ein gewißer Luxus mit Zinngeschirren
getrieben wurde. Im bürgerlichen Hause ersetzte es die Prunk
geräthe der Fürsten, wozu es ja durch feine Beschaffenheit
prädestinirt war; die Fürsten aber statteten ihre Rüchen mit
den blinkenden Tellern und Rannen aus.
In Deutschland bildeten Augsburg und Nürnberg die
bedeutendsten Zentren der Zinn-Industrie. Schon im Jahre
s32H finden wir in Augsburg einen Zinngießer in den Stadt
akten unter dem Namen Larel Diktus Zinngiezaer aufgeführt.■)
p. v. Stetten fügt bei: „Dem folgen viel mehrere, sowohl
Zinn- wie Rannengießer. Man kann die wenigsten unter
ihnen Rünstler nennen ic. Indessen war in diesem Jahr-
hundert ein Zinngießer, Sebald
Ruprecht, der sich durch feine Zinn
arbeit, welche dem Silber in Weiße
und Fai^on nahe kam, einen Na-
men machte." Von einem Randl-
gießer Martin Harscher, der \52o
in Nürnberg starb, heißt es, er
habe, was ein jeder gemeiner
Goldschmied von Silber also rein
von Zinn zu wegen gebracht. Nach-
richten ähnlicher Art sind uns noch
mehrere bekannt. Sie lassen alle
erkennen, wie es diesen Meistern
daran gelegen war, die höchste
Vollendung der Form zu erzielen,
wie sie die Goldschmiedearbeiten
zeigten. Erscheint im Allgemeinen
die Zinngießerei noch im J6. Jahr
hundert als ein Handwerk, so dürfen
wir doch in den obengenannten Meistern bereits Runsthand
werter vermuthen, die das anstrebten, was dem Franzosen
Briot und dem Deutschen Enderlein auszuführen gelang.
Von den Werken jener obengenannten Meister ist uns
nichts erhalten, wie ja überhaupt nur wenige Stücke künst-
lerischen Zinngusses oder künstlerisch gravirter Zinngefäße über
das Jahr 1300 zurückgehen. Als besonders bemerkenswerth
führt Bapst in seinem Werke drei Stücke im Museum von
Breslau an, wovon das älteste, eine Zunftkanne der Bäcker,
die Iahrzahl \^7 trägt (Abb. qch Sie mißt 60 cm. in der
Höhe und ist in drei Zonen gegliedert, von denen die oberste
in Gravirung die Verkündigung und eine Reihe heiliger und
profaner Figuren, die mittlere die Rreuzigung Lhristi und
ebenfalls Heilige mit ihren Attributen, die untere aber die
Apostel zeigt. Tritt auch in der allgemeinen Form der Ranne
noch der gothische Stilcharakter zu Tage, so sprechen doch
die ornamentalen Details an den Nischen und Postamenten
der mittleren Zone schon deutlich die Sprache der Früh
') Kunstgewerbs- und Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augs-
burg (779, I. 2-m, von Paul von Stetten.
V
Zeitschrift des bnyer. Aunstgenierhe-Vereins München.
1895. Heft (Bg. 2.)