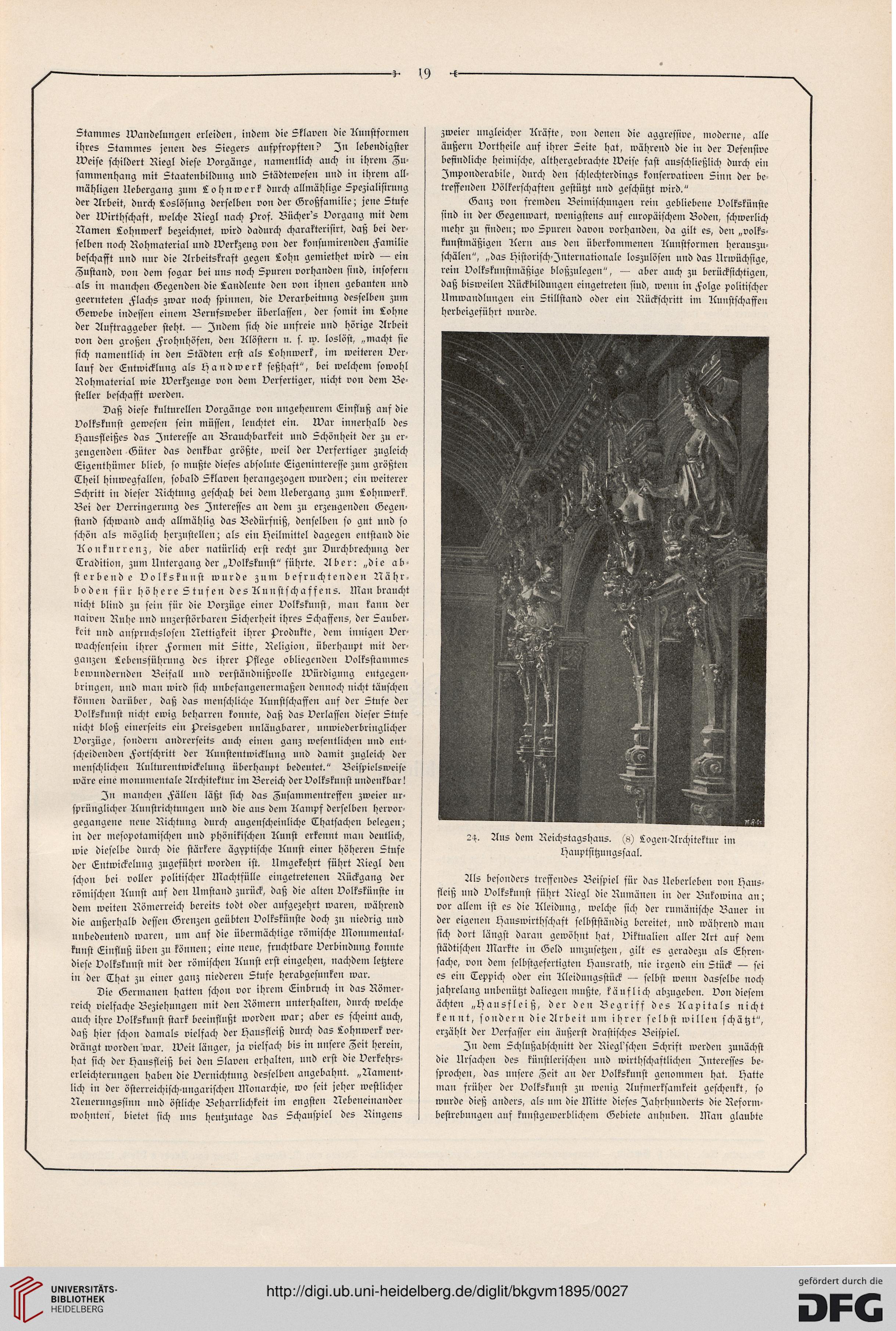Stammes Wandelungen erleiden, indem die Sklaven die Kunstsorinen
ihres Stammes jenen des Siegers aufpfropften? In lebendigster
Weife schildert Riegl diese Vorgänge, namentlich auch in ihrem Au-
sammenhang mit Staatenbildung und Städtewesen und in ihrem all-
mähligen Uebergang zum Lohnwerk durch allmählige Spezialistrung
der Arbeit, durch Loslösung derselben von der Großfamilie; jene Stufe
der wirthschaft, welche Riegl nach Prof. Bücher's Vorgang mit dem
Namen Lohnwerk bezeichnet, wird dadurch charakterisirt, daß bei der-
selben noch Rohmaterial und Werkzeug von der konsumirenden Familie
beschafft und nur die Arbeitskraft gegen Lohn gemiethet wird - ein
Zustand, von dem sogar bei uns noch Spuren vorhanden find, insofern
als in manchen Gegenden die Landleute den von ihnen gebauten und
geernteten Flachs zwar noch spinnen, die Verarbeitung desselben zum
Gewebe indessen einem Berufsweber überlasten, der somit im Lohne
der Auftraggeber steht. — Indem sich die unfreie und hörige Arbeit
von den großen Frohnhofen, den Klöstern u. s. w. loslöst, „macht sie
sich namentlich in den Städten erst als Lohnwerk, im weiteren Ver-
lauf der Entwicklung als Handwerk seßhaft", bei welchem sowohl
Rohmaterial wie Werkzeuge von dem Verfertiger, nicht von dem Be-
steller beschafft werden.
Daß diese kulturellen Vorgänge von ungeheurem Einfluß auf die
Volkskunst gewesen sein müssen, leuchtet ein. war innerhalb des
kjausfleißes das Interesse an Brauchbarkeit und Schönheit der zu er-
zeugenden Güter das denkbar größte, weil der Verfertiger zugleich
Eigenthümer blieb, so mußte dieses absolute Eigeninteresse zum größten
Theil hinwegfallen, sobald Sklaven herangezogen wurden; ein weiterer
Schritt in dieser Richtung geschah bei dem Uebergang zum Lohnwerk.
Bei der Verringerung des Interesses an dem zu erzeugenden Gegen-
stand schwand auch allmählig das Bedürfniß, denselben so gut und so
schön als möglich herzustellen; als ein Heilmittel dagegen entstand die
Konkurrenz, die aber natürlich erst recht zur Durchbrechung der
Tradition, zum Untergang der „Volkskunst" führte. Aber: „die ab-
sterbende Volkskunst wurde zum befruchtenden Nähr-
boden für höhere Stufen des Kunstschaffens. Ulan braucht
nicht blind zu sein für die Vorzüge einer Volkskunst, man kann der
naiven Ruhe und unzerstörbaren Sicherheit ihres Schaffens, der Sauber-
keit und anspruchslosen Nettigkeit ihrer Produkte, dem innigen Ver-
wachsensein ihrer Formen mit Sitte, Religion, überhaupt mit der-
ganzen Lebensführung des ihrer pstege obliegenden Volksstammes
bewundernden Beifall und verständnißvolle Würdigung entgegen-
bringen, und man wird sich unbefangenermaßen dennoch nicht täuschen
können darüber, daß das menschliche Kunstschaffen auf der Stufe der
Volkskunst nicht ewig beharren konnte, daß das verlassen dieser Stufe
nicht bloß einerseits ein Preisgeben unläugbarer, unwiederbringlicher
Vorzüge, sondern andrerseits auch einen ganz wesentlichen und ent-
scheidenden Fortschritt der Kunstentwicklung und damit zugleich der
menschlichen Kulturentwickelung überhaupt bedeutet." Beispielsweise
wäre eine monumentale Architektur im Bereich der Volkskunst undenkbar!
In manchen Fällen läßt sich das Zusammentreffen zweier ur-
sprünglicher Kunstrichtungen und die aus dem Kampf derselben hervor-
gegangene neue Richtung durch augenscheinliche Thatsachen belegen;
in der mesopotamischen und phönikischen Kunst erkennt man deutlich,
wie dieselbe durch die stärkere ägyptische Kunst einer höheren Stufe
der Entwickelung zugeführt worden ist. Umgekehrt führt Riegl den
schon bei voller politischer Machtfülle eingetretenen Rückgang der
römischen Kunst aus den Umstand zurück, daß die alten Volkskünste in
dem weiten Römerreich bereits tobt oder aufgezehrt waren, während
die außerhalb dessen Grenzen geübten Volkskünste doch zu niedrig und
unbedeutend waren, um auf die übermächtige römische Monumental-
kunst Einfluß üben zu können; eine neue, fruchtbare Verbindung konnte
diese Volkskunst mit der römischen Kunst erst eingehen, nachdem letztere
in der That zu einer ganz niederen Stufe herabgesunken war.
Die Germanen hatten schon vor ihrem Einbruch in das Römer-
reich vielfache Beziehungen mit den Römern unterhalten, durch welche
auch ihre Volkskunst stark beeinflußt worden war; aber es scheint auch,
daß hier schon damals vielfach der vausfleiß durch das Lohnwerk ver-
drängt worden war. weit länger, ja vielfach bis in unsere Zeit herein,
hat sich der lhausfleiß bei den Slaven erhalten, und erst die Verkehrs-
erleichterungen haben die Vernichtung desselben angebahnt. „Nament-
lich in der österreichisch-ungarischen Monarchie, wo seit jeher westlicher
Neuerungssinn und östliche Beharrlichkeit im engsten Nebeneinander
wohnten, bietet sich uns heutzutage das Schauspiel des Ringens
Zweier ungleicher Kräfte, von denen die aggressive, moderne, alle
äußern vortheile aus ihrer Seite hat, während die in der Defensive
befindliche heimische, althergebrachte weise fast ausschließlich durch ein
Imponderabile, durch den schlechterdings konservativen Sinn der be-
treffenden Völkerschaften gestützt und geschützt wird."
Ganz von fremden Beimischungen rein gebliebene Volkskünste
sind in der Gegenwart, wenigstens auf europäischem Boden, schwerlich
mehr zu finden; wo Spuren davon vorhanden, da gilt es, den „volks-
kunstmäßigen Kern aus den überkommenen Kunstformen herauszu-
schälen", „das Historisch-Internationale loszulösen und das Urwüchsige,
rein volkskunstmäßige bloßzulegen", — aber auch zu berücksichtigen,
daß bisweilen Rückbildungen eingetreten sind, wenn in Folge politischer
Umwandlungen ein Stillstand oder ein Rückschritt im Kunstschaffen
herbeigeführt wurde.
2y. Aus dem Reichstagshaus. (8) Logen-Architektnr im
lfauptsitzungssaal.
Als besonders treffendes Beispiel für das Ueberleben von kjaus-
fleiß und Volkskunst führt Riegl die Rumänen in der Bukowina an;
vor allem ist es die Kleidung, welche sich der rumänische Bauer in
der eigenen vauswirthschast selbstständig bereitet, und während man
sich dort längst daran gewöhnt hat, viktualien aller Art auf dem
städtischen Markte in Geld umzusetzen, gilt es geradezu als Ehren-
sache, von dem selbstgefertigten lsausrath, nie irgend ein Stück — sei
es ein Teppich oder ein Kleidungsstück — selbst wenn dasselbe noch
jahrelang unbenützt daliegen mußte, käuflich abzugeben, von diesem
ächten „kfausfleiß, der den Begriff des Kapitals nicht
kennt, sondern dieArbeit um ihrer selbst willen schätzt",
erzählt der Verfasser ein äußerst drastisches Beispiel.
In dem Schlußabschnitt der Riegl'schen Schrift werden zunächst
die Ursachen des künstlerischen und wirthschaftlichen Interesses be-
sprochen, das unsere Zeit an der Volkskunst genommen hat. Hatte
man früher der Volkskunst zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, so
wurde dieß anders, als um die Mitte dieses Jahrhunderts die Reform-
bestrebungen auf kunstgewerblichem Gebiete anhnben. Man glaubte
ihres Stammes jenen des Siegers aufpfropften? In lebendigster
Weife schildert Riegl diese Vorgänge, namentlich auch in ihrem Au-
sammenhang mit Staatenbildung und Städtewesen und in ihrem all-
mähligen Uebergang zum Lohnwerk durch allmählige Spezialistrung
der Arbeit, durch Loslösung derselben von der Großfamilie; jene Stufe
der wirthschaft, welche Riegl nach Prof. Bücher's Vorgang mit dem
Namen Lohnwerk bezeichnet, wird dadurch charakterisirt, daß bei der-
selben noch Rohmaterial und Werkzeug von der konsumirenden Familie
beschafft und nur die Arbeitskraft gegen Lohn gemiethet wird - ein
Zustand, von dem sogar bei uns noch Spuren vorhanden find, insofern
als in manchen Gegenden die Landleute den von ihnen gebauten und
geernteten Flachs zwar noch spinnen, die Verarbeitung desselben zum
Gewebe indessen einem Berufsweber überlasten, der somit im Lohne
der Auftraggeber steht. — Indem sich die unfreie und hörige Arbeit
von den großen Frohnhofen, den Klöstern u. s. w. loslöst, „macht sie
sich namentlich in den Städten erst als Lohnwerk, im weiteren Ver-
lauf der Entwicklung als Handwerk seßhaft", bei welchem sowohl
Rohmaterial wie Werkzeuge von dem Verfertiger, nicht von dem Be-
steller beschafft werden.
Daß diese kulturellen Vorgänge von ungeheurem Einfluß auf die
Volkskunst gewesen sein müssen, leuchtet ein. war innerhalb des
kjausfleißes das Interesse an Brauchbarkeit und Schönheit der zu er-
zeugenden Güter das denkbar größte, weil der Verfertiger zugleich
Eigenthümer blieb, so mußte dieses absolute Eigeninteresse zum größten
Theil hinwegfallen, sobald Sklaven herangezogen wurden; ein weiterer
Schritt in dieser Richtung geschah bei dem Uebergang zum Lohnwerk.
Bei der Verringerung des Interesses an dem zu erzeugenden Gegen-
stand schwand auch allmählig das Bedürfniß, denselben so gut und so
schön als möglich herzustellen; als ein Heilmittel dagegen entstand die
Konkurrenz, die aber natürlich erst recht zur Durchbrechung der
Tradition, zum Untergang der „Volkskunst" führte. Aber: „die ab-
sterbende Volkskunst wurde zum befruchtenden Nähr-
boden für höhere Stufen des Kunstschaffens. Ulan braucht
nicht blind zu sein für die Vorzüge einer Volkskunst, man kann der
naiven Ruhe und unzerstörbaren Sicherheit ihres Schaffens, der Sauber-
keit und anspruchslosen Nettigkeit ihrer Produkte, dem innigen Ver-
wachsensein ihrer Formen mit Sitte, Religion, überhaupt mit der-
ganzen Lebensführung des ihrer pstege obliegenden Volksstammes
bewundernden Beifall und verständnißvolle Würdigung entgegen-
bringen, und man wird sich unbefangenermaßen dennoch nicht täuschen
können darüber, daß das menschliche Kunstschaffen auf der Stufe der
Volkskunst nicht ewig beharren konnte, daß das verlassen dieser Stufe
nicht bloß einerseits ein Preisgeben unläugbarer, unwiederbringlicher
Vorzüge, sondern andrerseits auch einen ganz wesentlichen und ent-
scheidenden Fortschritt der Kunstentwicklung und damit zugleich der
menschlichen Kulturentwickelung überhaupt bedeutet." Beispielsweise
wäre eine monumentale Architektur im Bereich der Volkskunst undenkbar!
In manchen Fällen läßt sich das Zusammentreffen zweier ur-
sprünglicher Kunstrichtungen und die aus dem Kampf derselben hervor-
gegangene neue Richtung durch augenscheinliche Thatsachen belegen;
in der mesopotamischen und phönikischen Kunst erkennt man deutlich,
wie dieselbe durch die stärkere ägyptische Kunst einer höheren Stufe
der Entwickelung zugeführt worden ist. Umgekehrt führt Riegl den
schon bei voller politischer Machtfülle eingetretenen Rückgang der
römischen Kunst aus den Umstand zurück, daß die alten Volkskünste in
dem weiten Römerreich bereits tobt oder aufgezehrt waren, während
die außerhalb dessen Grenzen geübten Volkskünste doch zu niedrig und
unbedeutend waren, um auf die übermächtige römische Monumental-
kunst Einfluß üben zu können; eine neue, fruchtbare Verbindung konnte
diese Volkskunst mit der römischen Kunst erst eingehen, nachdem letztere
in der That zu einer ganz niederen Stufe herabgesunken war.
Die Germanen hatten schon vor ihrem Einbruch in das Römer-
reich vielfache Beziehungen mit den Römern unterhalten, durch welche
auch ihre Volkskunst stark beeinflußt worden war; aber es scheint auch,
daß hier schon damals vielfach der vausfleiß durch das Lohnwerk ver-
drängt worden war. weit länger, ja vielfach bis in unsere Zeit herein,
hat sich der lhausfleiß bei den Slaven erhalten, und erst die Verkehrs-
erleichterungen haben die Vernichtung desselben angebahnt. „Nament-
lich in der österreichisch-ungarischen Monarchie, wo seit jeher westlicher
Neuerungssinn und östliche Beharrlichkeit im engsten Nebeneinander
wohnten, bietet sich uns heutzutage das Schauspiel des Ringens
Zweier ungleicher Kräfte, von denen die aggressive, moderne, alle
äußern vortheile aus ihrer Seite hat, während die in der Defensive
befindliche heimische, althergebrachte weise fast ausschließlich durch ein
Imponderabile, durch den schlechterdings konservativen Sinn der be-
treffenden Völkerschaften gestützt und geschützt wird."
Ganz von fremden Beimischungen rein gebliebene Volkskünste
sind in der Gegenwart, wenigstens auf europäischem Boden, schwerlich
mehr zu finden; wo Spuren davon vorhanden, da gilt es, den „volks-
kunstmäßigen Kern aus den überkommenen Kunstformen herauszu-
schälen", „das Historisch-Internationale loszulösen und das Urwüchsige,
rein volkskunstmäßige bloßzulegen", — aber auch zu berücksichtigen,
daß bisweilen Rückbildungen eingetreten sind, wenn in Folge politischer
Umwandlungen ein Stillstand oder ein Rückschritt im Kunstschaffen
herbeigeführt wurde.
2y. Aus dem Reichstagshaus. (8) Logen-Architektnr im
lfauptsitzungssaal.
Als besonders treffendes Beispiel für das Ueberleben von kjaus-
fleiß und Volkskunst führt Riegl die Rumänen in der Bukowina an;
vor allem ist es die Kleidung, welche sich der rumänische Bauer in
der eigenen vauswirthschast selbstständig bereitet, und während man
sich dort längst daran gewöhnt hat, viktualien aller Art auf dem
städtischen Markte in Geld umzusetzen, gilt es geradezu als Ehren-
sache, von dem selbstgefertigten lsausrath, nie irgend ein Stück — sei
es ein Teppich oder ein Kleidungsstück — selbst wenn dasselbe noch
jahrelang unbenützt daliegen mußte, käuflich abzugeben, von diesem
ächten „kfausfleiß, der den Begriff des Kapitals nicht
kennt, sondern dieArbeit um ihrer selbst willen schätzt",
erzählt der Verfasser ein äußerst drastisches Beispiel.
In dem Schlußabschnitt der Riegl'schen Schrift werden zunächst
die Ursachen des künstlerischen und wirthschaftlichen Interesses be-
sprochen, das unsere Zeit an der Volkskunst genommen hat. Hatte
man früher der Volkskunst zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, so
wurde dieß anders, als um die Mitte dieses Jahrhunderts die Reform-
bestrebungen auf kunstgewerblichem Gebiete anhnben. Man glaubte