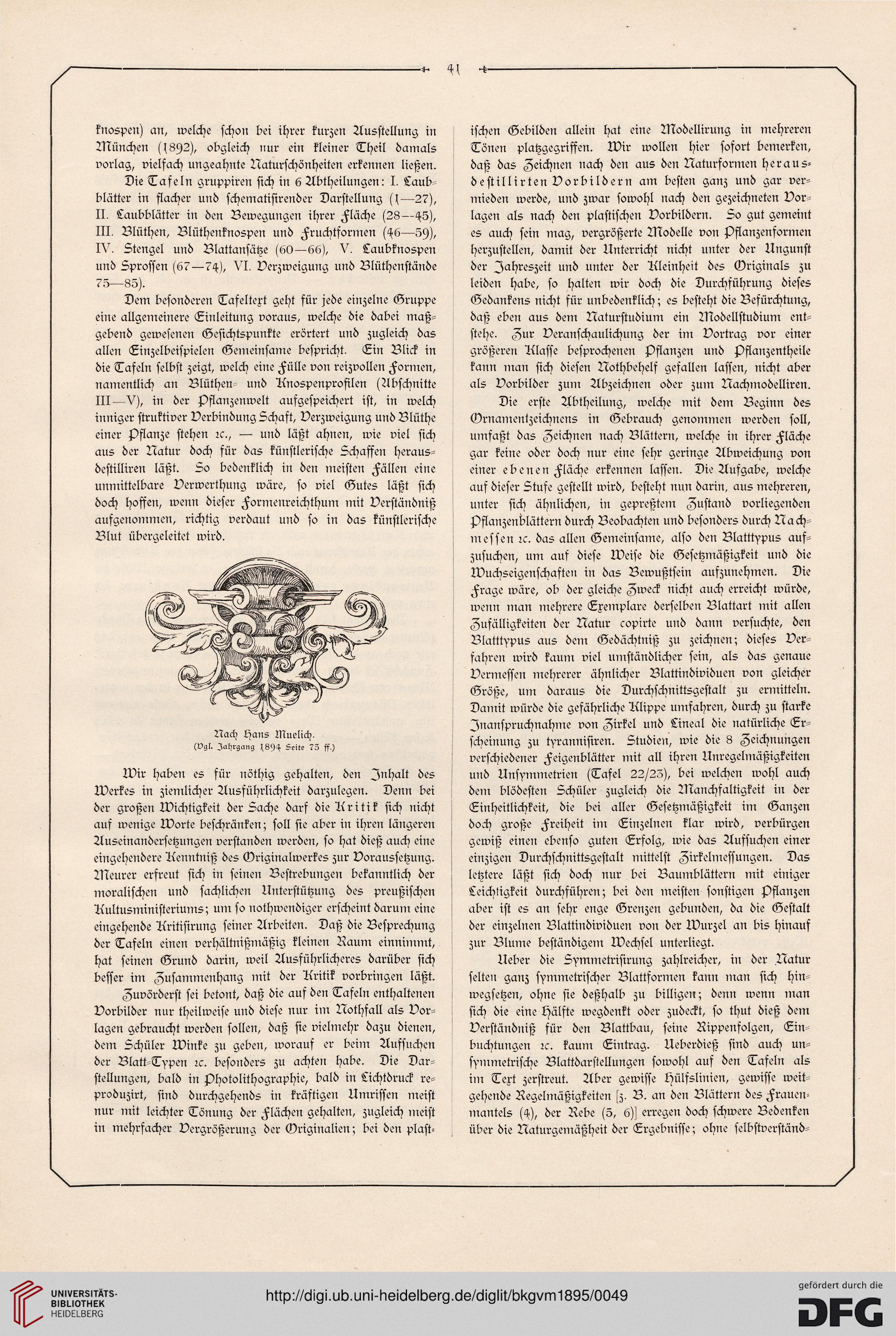knospen) an, welche schon bei ihrer kurzen Ausstellung in
München (1892), obgleich nur ein kleiner Theil damals
vorlag, vielfach ungeahnte Naturschönheiten erkennen ließen.
Die Tafeln gruppiren sich in 6 Abtheilungen: I. Laub-
blätter in flacher und schematisirender Darstellung (I—27),
II. Laubblätter in den Bewegungen ihrer Flüche (28—45),
III. Blüthen, Blüthenknospen und Fruchtformen (46—59),
IV. Stengel und Blattansätze (60—66), V. Laubknospen
und Sprossen (67—74), VI. Verzweigung und Blüthenstände
75—85).
Dem besonderen Taseltext geht für jede einzelne Gruppe
eine allgemeinere Einleitung voraus, welche die dabei maß-
gebend gewesenen Gesichtspunkte erörtert und zugleich das
allen Einzelbeispielen Gemeinsame bespricht. Gin Blick in
die Tafeln selbst zeigt, welch eine Fülle von reizvollen Formen,
namentlich an Blüthen- und Knospenprofilen (Abschnitte
III—V), in der Pflanzenwelt aufgespeichert ist, in welch
inniger struktiver Verbindung Schaft, Verzweigung und Blüthe
einer Pflanze stehen ic., — und läßt ahnen, wie viel sich
aus der Natur doch für das künstlerische Schaffen heraus-
destilliren läßt. So bedenklich in den meisten Fällen eine
unmittelbare Verwerthung wäre, so viel Gutes läßt sich
doch hoffen, wenn dieser Formenreichthum mit Verstündniß
ausgenommen, richtig verdaut und so in das künstlerische
Blut übergeleitet wird.
Nach Hans Muelich.
(vgl. Jahrgang Seite 73 ff.)
Wir haben es für nöthig gehalten, den Inhalt des
Werkes in ziemlicher Ausführlichkeit darzulegen. Denn bei
der großen Wichtigkeit der Sache darf die K r i t i k sich nicht
auf wenige Worte beschränken; soll sie aber in ihren längeren
Auseinandersetzungen verstanden werden, so hat dieß auch eine
eingehendere Kenntniß des Griginalwerkes zur Voraussetzung.
Meurer erfreut sich in seinen Bestrebungen bekanntlich der
moralischen und sachlichen Unterstützung des preußischen
Kultusministeriums; um so nothwendiger erscheint darum eine
eingehende Kritisirung seiner Arbeiten. Daß die Besprechung
der Tafeln einen verhältnißmäßig kleinen Raum einnimmt,
hat seinen Grund darin, weil Ausführlicheres darüber sich
bester in: Zusammenhang mit der Kritik Vorbringen läßt.
Zuvörderst sei betont, daß die auf den Tafeln enthaltenen
Vorbilder nur theilweise und diese nur im Nothfall als Vor-
lagen gebraucht werden sollen, daß sie vielmehr dazu dienen,
dem Schüler Winke zu geben, worauf er beim Aufsuchen
der Blatt-Typen rc. besonders zu achten habe. Die Dar-
stellungen, bald in Photolithographie, bald in Lichtdruck re-
produzirt, sind durchgehends in kräftigen Umrissen meist
nur mit leichter Tönung der Flächen gehalten, zugleich meist
in mehrfacher Vergrößerung der Vriginalien; bei den plast-
ischen Gebilden allein hat eine Modellirung in mehreren
Tönen platzgegriffen, wir wollen hier sofort bemerken,
daß das Zeichnen nach den aus den Naturformen heraus-
destillirten Vorbildern am besten ganz und gar ver-
mieden werde, und zwar sowohl nach den gezeichneten Vor-
lagen als nach den plastischen Vorbildern. So gut gemeint
es auch sein mag, vergrößerte Modelle von Pflanzenformen
herzustellen, damit der Unterricht nicht unter der Ungunst
der Jahreszeit und unter der Kleinheit des Originals zu
leiden habe, so halten wir doch die Durchführung dieses
Gedankens nicht für unbedenklich; es besteht die Befürchtung,
daß eben aus dem Naturstudium ein Modellstudium ent-
stehe. Zur Veranschaulichung der im Vortrag vor einer
größeren Klasse besprochenen Pflanzen und pflanzentheile
kann man sich diesen Nothbehelf gefallen lassen, nicht aber
als Vorbilder zum Abzeichnen oder zum Nachmodelliren.
Die erste Abtheilung, welche mit dem Beginn des
Vrnamentzeichnens in Gebrauch genommen werden soll,
umfaßt das Zeichnen nach Blättern, welche in ihrer Fläche
gar keine oder doch nur eine sehr geringe Abweichung von
einer ebenen Fläche erkennen lassen. Die Aufgabe, welche
auf dieser Stufe gestellt wird, besteht nun darin, aus mehreren,
unter sich ähnlichen, in gepreßtem Zustand vorliegenden
Pflanzenblättern durch Beobachten und besonders durch Nach
»ressen rc. das allen Genreinsame, also den Blatttypus auf-
zusuchen, um auf diese weise die Gesetzmäßigkeit und die
Wuchseigenschaften in das Bewußtsein aufzunehmen. Die
Frage wäre, ob der gleiche Zweck nicht auch erreicht würde,
wenn man rnehrere Exemplare derselben Blattart mit allen
Zufälligkeiten der Natur copirte und dann versuchte, den
Blatttypus aus dem Gedächtniß zu zeichnen; dieses Ver
fahren wird kaum viel umständlicher sein, als das genaue
Vermessen mehrerer ähnlicher Blattindividuen von gleicher
Größe, um daraus die Durchschnittsgestalt zu ermitteln.
Darnit würde die gefährliche Klippe umfahren, durch zu starke
Inanspruchnahme von Zirkel und Lineal die natürliche Er-
scheinung zu tyrannisiren. Studien, wie die 8 Zeichnungen
verschiedener Feigenblätter mit all ihrerr Unregelmäßigkeiten
und Unsymmetrien (Tafel 22/25), bei welchen wohl auch
dem blödesten Schüler zugleich die Manchfaltigkeit in der
Einheitlichkeit, die bei aller Gesetzmäßigkeit im Ganzen
doch große Freiheit im Einzelnen klar wird, verbürgen
gewiß einen ebenso guten Erfolg, wie das Aufsuchen einer
einzigen Durchschnittsgestalt mittelst Zirkelmessungen. Das
letztere läßt sich doch nur bei Baumblättern mit einiger
Leichtigkeit durchführen; bei den meisten sonstigen Pflanzen
aber ist es an sehr enge Grenzen gebunden, da die Gestalt
der einzelnen Blattindividuen von der Wurzel an bis hinauf
zur Blume beständigem Wechsel unterliegt.
Ueber die Symmetrisirung zahlreicher, in der Natur
selten ganz symmetrischer Blattformen kann man sich hin-
wegsetzen, ohne sie deßhalb zu billigen; denn wenn man
sich die eine pälfte wegdenkt oder zudeckt, so thut dieß dem
Verständniß für den Blattbau, seine Rippenfolgen, Ein
buchtungen rc. kaum Eintrag. Ueberdieß sind auch un-
synrmetrische Blattdarstellungen sowohl aus den Tafeln als
im Text zerstreut. Aber gewisse pülfslinien, gewisse weit
gehende Regelmäßigkeiten (z. B. an den Blättern des Frauen-
mantels (4), der Rebe (5, 6)) erregen doch schwere Bedenken
über die Naturgemäßheit der Ergebnisse; ohne selbstverständ-
München (1892), obgleich nur ein kleiner Theil damals
vorlag, vielfach ungeahnte Naturschönheiten erkennen ließen.
Die Tafeln gruppiren sich in 6 Abtheilungen: I. Laub-
blätter in flacher und schematisirender Darstellung (I—27),
II. Laubblätter in den Bewegungen ihrer Flüche (28—45),
III. Blüthen, Blüthenknospen und Fruchtformen (46—59),
IV. Stengel und Blattansätze (60—66), V. Laubknospen
und Sprossen (67—74), VI. Verzweigung und Blüthenstände
75—85).
Dem besonderen Taseltext geht für jede einzelne Gruppe
eine allgemeinere Einleitung voraus, welche die dabei maß-
gebend gewesenen Gesichtspunkte erörtert und zugleich das
allen Einzelbeispielen Gemeinsame bespricht. Gin Blick in
die Tafeln selbst zeigt, welch eine Fülle von reizvollen Formen,
namentlich an Blüthen- und Knospenprofilen (Abschnitte
III—V), in der Pflanzenwelt aufgespeichert ist, in welch
inniger struktiver Verbindung Schaft, Verzweigung und Blüthe
einer Pflanze stehen ic., — und läßt ahnen, wie viel sich
aus der Natur doch für das künstlerische Schaffen heraus-
destilliren läßt. So bedenklich in den meisten Fällen eine
unmittelbare Verwerthung wäre, so viel Gutes läßt sich
doch hoffen, wenn dieser Formenreichthum mit Verstündniß
ausgenommen, richtig verdaut und so in das künstlerische
Blut übergeleitet wird.
Nach Hans Muelich.
(vgl. Jahrgang Seite 73 ff.)
Wir haben es für nöthig gehalten, den Inhalt des
Werkes in ziemlicher Ausführlichkeit darzulegen. Denn bei
der großen Wichtigkeit der Sache darf die K r i t i k sich nicht
auf wenige Worte beschränken; soll sie aber in ihren längeren
Auseinandersetzungen verstanden werden, so hat dieß auch eine
eingehendere Kenntniß des Griginalwerkes zur Voraussetzung.
Meurer erfreut sich in seinen Bestrebungen bekanntlich der
moralischen und sachlichen Unterstützung des preußischen
Kultusministeriums; um so nothwendiger erscheint darum eine
eingehende Kritisirung seiner Arbeiten. Daß die Besprechung
der Tafeln einen verhältnißmäßig kleinen Raum einnimmt,
hat seinen Grund darin, weil Ausführlicheres darüber sich
bester in: Zusammenhang mit der Kritik Vorbringen läßt.
Zuvörderst sei betont, daß die auf den Tafeln enthaltenen
Vorbilder nur theilweise und diese nur im Nothfall als Vor-
lagen gebraucht werden sollen, daß sie vielmehr dazu dienen,
dem Schüler Winke zu geben, worauf er beim Aufsuchen
der Blatt-Typen rc. besonders zu achten habe. Die Dar-
stellungen, bald in Photolithographie, bald in Lichtdruck re-
produzirt, sind durchgehends in kräftigen Umrissen meist
nur mit leichter Tönung der Flächen gehalten, zugleich meist
in mehrfacher Vergrößerung der Vriginalien; bei den plast-
ischen Gebilden allein hat eine Modellirung in mehreren
Tönen platzgegriffen, wir wollen hier sofort bemerken,
daß das Zeichnen nach den aus den Naturformen heraus-
destillirten Vorbildern am besten ganz und gar ver-
mieden werde, und zwar sowohl nach den gezeichneten Vor-
lagen als nach den plastischen Vorbildern. So gut gemeint
es auch sein mag, vergrößerte Modelle von Pflanzenformen
herzustellen, damit der Unterricht nicht unter der Ungunst
der Jahreszeit und unter der Kleinheit des Originals zu
leiden habe, so halten wir doch die Durchführung dieses
Gedankens nicht für unbedenklich; es besteht die Befürchtung,
daß eben aus dem Naturstudium ein Modellstudium ent-
stehe. Zur Veranschaulichung der im Vortrag vor einer
größeren Klasse besprochenen Pflanzen und pflanzentheile
kann man sich diesen Nothbehelf gefallen lassen, nicht aber
als Vorbilder zum Abzeichnen oder zum Nachmodelliren.
Die erste Abtheilung, welche mit dem Beginn des
Vrnamentzeichnens in Gebrauch genommen werden soll,
umfaßt das Zeichnen nach Blättern, welche in ihrer Fläche
gar keine oder doch nur eine sehr geringe Abweichung von
einer ebenen Fläche erkennen lassen. Die Aufgabe, welche
auf dieser Stufe gestellt wird, besteht nun darin, aus mehreren,
unter sich ähnlichen, in gepreßtem Zustand vorliegenden
Pflanzenblättern durch Beobachten und besonders durch Nach
»ressen rc. das allen Genreinsame, also den Blatttypus auf-
zusuchen, um auf diese weise die Gesetzmäßigkeit und die
Wuchseigenschaften in das Bewußtsein aufzunehmen. Die
Frage wäre, ob der gleiche Zweck nicht auch erreicht würde,
wenn man rnehrere Exemplare derselben Blattart mit allen
Zufälligkeiten der Natur copirte und dann versuchte, den
Blatttypus aus dem Gedächtniß zu zeichnen; dieses Ver
fahren wird kaum viel umständlicher sein, als das genaue
Vermessen mehrerer ähnlicher Blattindividuen von gleicher
Größe, um daraus die Durchschnittsgestalt zu ermitteln.
Darnit würde die gefährliche Klippe umfahren, durch zu starke
Inanspruchnahme von Zirkel und Lineal die natürliche Er-
scheinung zu tyrannisiren. Studien, wie die 8 Zeichnungen
verschiedener Feigenblätter mit all ihrerr Unregelmäßigkeiten
und Unsymmetrien (Tafel 22/25), bei welchen wohl auch
dem blödesten Schüler zugleich die Manchfaltigkeit in der
Einheitlichkeit, die bei aller Gesetzmäßigkeit im Ganzen
doch große Freiheit im Einzelnen klar wird, verbürgen
gewiß einen ebenso guten Erfolg, wie das Aufsuchen einer
einzigen Durchschnittsgestalt mittelst Zirkelmessungen. Das
letztere läßt sich doch nur bei Baumblättern mit einiger
Leichtigkeit durchführen; bei den meisten sonstigen Pflanzen
aber ist es an sehr enge Grenzen gebunden, da die Gestalt
der einzelnen Blattindividuen von der Wurzel an bis hinauf
zur Blume beständigem Wechsel unterliegt.
Ueber die Symmetrisirung zahlreicher, in der Natur
selten ganz symmetrischer Blattformen kann man sich hin-
wegsetzen, ohne sie deßhalb zu billigen; denn wenn man
sich die eine pälfte wegdenkt oder zudeckt, so thut dieß dem
Verständniß für den Blattbau, seine Rippenfolgen, Ein
buchtungen rc. kaum Eintrag. Ueberdieß sind auch un-
synrmetrische Blattdarstellungen sowohl aus den Tafeln als
im Text zerstreut. Aber gewisse pülfslinien, gewisse weit
gehende Regelmäßigkeiten (z. B. an den Blättern des Frauen-
mantels (4), der Rebe (5, 6)) erregen doch schwere Bedenken
über die Naturgemäßheit der Ergebnisse; ohne selbstverständ-