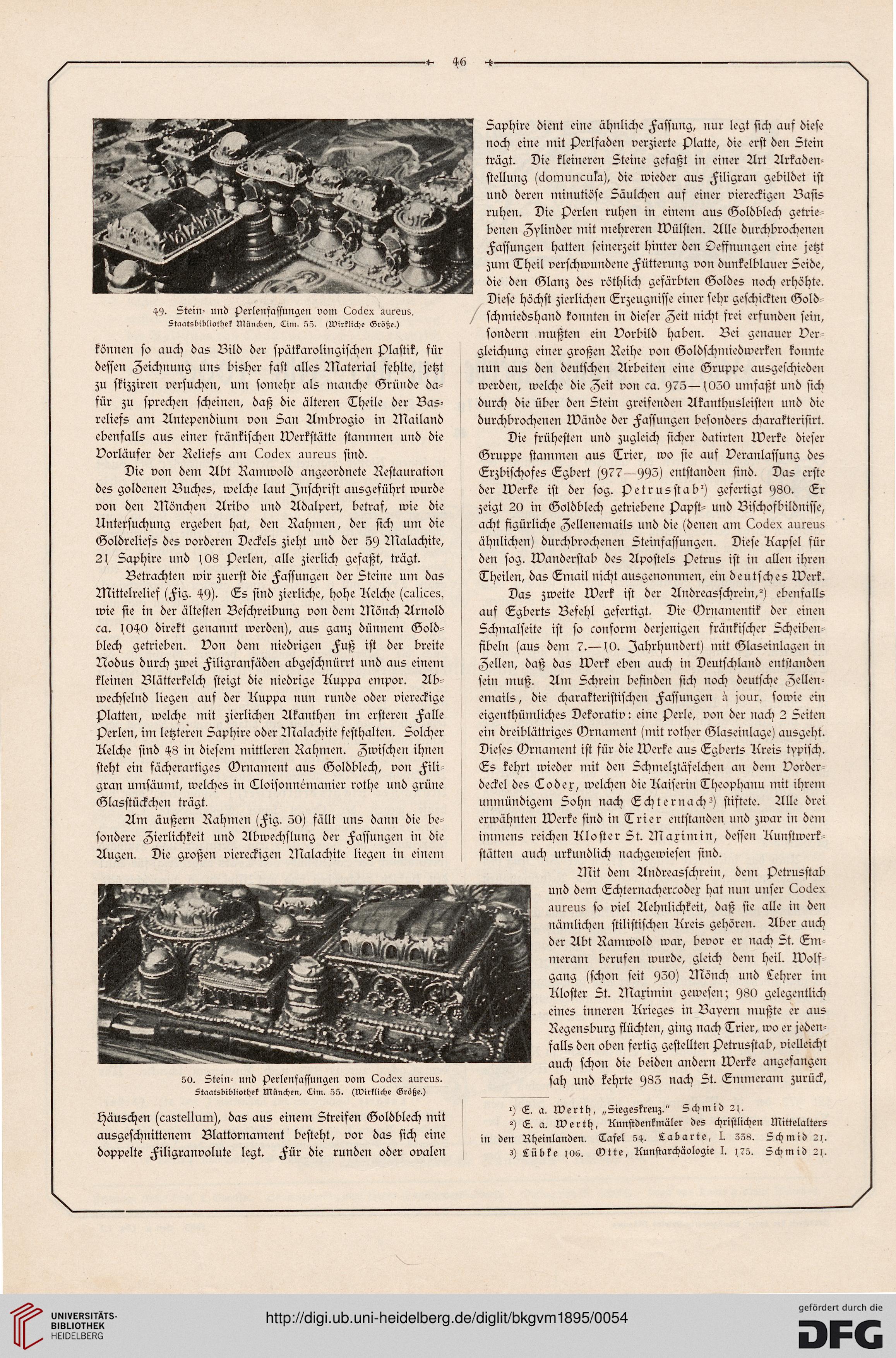•4- ^6
^9* Stein* und Perlenfassungen vom Loctex aureus.
Staatsbibliothek München, <£im. 55. (wirkliche Größe.)
können so auch das Bild der spätkarolingischen Plastik, für
dessen Zeichnung uns bisher fast alles Material fehlte, jetzt
zu skizziren versuchen, um somehr als nianche Gründe da-
für zu sprechen scheinen, daß die älteren Theile der Bas-
reliefs am Antependium von San Ambrogio in Mailand
ebenfalls aus einer fränkischen Werkstätte stammen und die
Vorläufer der Reliefs an: Codex aureus sind.
Die von dem Abt Rainwold angeordnete Restauration
des goldenen Buches, welche laut Zuschrift ausgeführt wurde
von den Mönchen Aribo und Adalpert, betraf, wie die
Untersuchung ergeben hat, den Rahmen, der sich um die
Goldreliefs des vorderen Deckels zieht und der 59 Malachite,
2\ Saphire und \08 perlen, alle zierlich gefaßt, trägt.
Betrachten wir zuerst die Fassungen der Steine mu das
Mittelrelief (Fig. ^9)- Es sind zierliche, hohe Reiche (calices,
wie sie in der ältesten Beschreibung von deni Mönch Arnold
ca. sOcsO direkt genannt werden), aus ganz dünnem Gold-
blech getrieben, von dem niedrigen Fuß ist der breite
Nodus durch zwei Filigranfäden abgeschnürrt und aus einem
kleinen Blätterkelch steigt die niedrige Ruppa empor. Ab-
wechselnd liegen auf der Ruppa nun runde oder viereckige
Platten, welche mit zierlichen Akanthen ini ersteren Falle
perlen, im letzteren Saphire oder Malachite festhalten. Solcher
Reiche sind ^8 in diesem mittleren Rahmen. Zwischen ihnen
steht ein fächerartiges Ornament aus Goldblech, von Fili-
gran umsäumt, welches in Eloisonnemanier rothe und grüne
Glasstückchen trägt.
Am äußern Rahmen (Fig. 50) fällt uns dann die be-
sondere Zierlichkeit und Abwechslung der Fassungen in die
Augen. Die großen viereckigen Malachite liegen in einem
50. Stein- und Perlenfassungen vom Codex aureus.
Staatsbibliothek München, Lim. 55. (wirkliche Größe.)
Häuschen (castellum), das aus einem Streifen Goldblech mit
ausgeschnittenein Blattornament besteht, vor das sich eine
doppelte Filigranvolute legt. Für die runden oder ovalen
Saphire dient eine ähnliche Fassung, nur legt sich auf diese
noch eine mit perlfaden verzierte Platte, die erst den Stein
trägt. Die kleineren Steine gefaßt in einer Art Arkaden-
stellung (doirmucula), die wieder ans Filigran gebildet ist
und deren minutiöse Säulchen aus einer viereckigen Basis
ruhen. Die Perlen ruhen in einem aus Goldblech getrie-
benen Zylinder mit mehreren Wülsten. Alle durchbrochenen
Fassungen hatten seinerzeit hinter den Deffnungen eine jetzt
zum Theil verschwundene Fütterung von dunkelblauer Seide,
die den Glanz des röthlich gefärbten Goldes noch erhöhte.
Diese höchst zierlichen Erzeugnisse einer sehr geschickten Gold
schmiedshand konnten in dieser Zeit nicht frei erfunden sein,
sondern inußten ein Vorbild haben. Bei genauer ver
gleichung einer großen Reihe von Goldschmiedwerken konnte
nun aus den deutschen Arbeiten eine Gruppe ausgeschieden
werden, welche die Zeit von ca. 975—1050 umfaßt und sich
durch die über den Stein greifenden Akanthusleisten und die
durchbrochenen Wände der Fassungen besonders charakterisirt.
Die frühesten und zugleich sicher datirten Werke dieser
Gruppe stammen aus Trier, wo sie auf Veranlassung des
Erzbischofes Egbert (977—993) entstanden sind. Das erste
der Werke ist der sog. Petrus st ab') gefertigt 980. Er
zeigt 20 in Goldblech getriebene Papst- und Bischosbildnisse,
acht figürliche Zellenemails und die (denen am Codex aureus
ähnlichen) durchbrochenen Steinfassungen. Diese Rapse! für
den sog. Wanderstab des Apostels Petrus ist in allen ihren
Theilen, das Email nicht ausgenommen, ein deutsches Werk.
Das zweite Werk ist der Andreasschrein,9 ebenfalls
auf Egberts Befehl gefertigt. Die Ornamentik der einen
Schmalseite ist so conform derjenigen fränkischer Scheiben-
fibeln (aus dein 7.— (0. Jahrhundert) mit Glaseinlagen in
Zellen, daß das Werk eben auch in Deutschland entstanden
sein nruß. Am Schrein befinden sich noch deutsche Zellen-
emails, die charakteristischen Fassungen a jour, sowie ein
eigenthümliches Dekorativ: eine perle, von der nach 2 Seiten
ein dreiblättriges Ornament (mit rother Glaseinlage) ausgeht.
Dieses Ornainent ist für die Werke aus Egberts Rreis typisch.
Es kehrt wieder mit den Schmelztäfelchen an dem Vorder
decket des Tod ex, welchen die Raiserin Theophanu mit ihrem
unmündigem Sohn nach Echternachs stiftete. Alle drei
erwähnten Werke sind in Trier entstanden und zwar in dem
immens reichen Rloster St. Maximin, dessen Runstwerk-
stätten auch urkundlich nachgewiesen sind.
Mit dem Andreasschrein, dem Petrusstab
und dem Echternachercodex hat nun unser Codex
aureus so viel Aehnlichkeit, daß sie alle in den
nämlichen stilistischen Rreis gehören. Aber auch
der Abt Ramwold war, bevor er nach St. En:
meram berufen wurde, gleich dein heil. Wolf-
gang (schon seit 930) Mönch und §ehrer im
Rloster St. Maximin gewesen; 98O gelegentlich
eines inneren Rrieges in Bayern mußte er aus
Regensburg flüchten, ging nach Trier, wo er jeden-
falls den oben fertig gestellten Petrusstab, vielleicht
auch schon die beiden andern Werke angefangen
sah und kehrte 980 nach St. Emmeram zurück,
9 L. a. Werth, „Siegeskreuz." Schmid 2;.
9 €. a. Werth, Kunstdenkmäler des christlichen Mittelalters
in den Rheinlanden. Tafel 54. Labarte, I. 338. Schmid 2j.
3) Lübke ;o6. Gtte, Kunstarchäologie I. ;75. Schmid 2;.
^9* Stein* und Perlenfassungen vom Loctex aureus.
Staatsbibliothek München, <£im. 55. (wirkliche Größe.)
können so auch das Bild der spätkarolingischen Plastik, für
dessen Zeichnung uns bisher fast alles Material fehlte, jetzt
zu skizziren versuchen, um somehr als nianche Gründe da-
für zu sprechen scheinen, daß die älteren Theile der Bas-
reliefs am Antependium von San Ambrogio in Mailand
ebenfalls aus einer fränkischen Werkstätte stammen und die
Vorläufer der Reliefs an: Codex aureus sind.
Die von dem Abt Rainwold angeordnete Restauration
des goldenen Buches, welche laut Zuschrift ausgeführt wurde
von den Mönchen Aribo und Adalpert, betraf, wie die
Untersuchung ergeben hat, den Rahmen, der sich um die
Goldreliefs des vorderen Deckels zieht und der 59 Malachite,
2\ Saphire und \08 perlen, alle zierlich gefaßt, trägt.
Betrachten wir zuerst die Fassungen der Steine mu das
Mittelrelief (Fig. ^9)- Es sind zierliche, hohe Reiche (calices,
wie sie in der ältesten Beschreibung von deni Mönch Arnold
ca. sOcsO direkt genannt werden), aus ganz dünnem Gold-
blech getrieben, von dem niedrigen Fuß ist der breite
Nodus durch zwei Filigranfäden abgeschnürrt und aus einem
kleinen Blätterkelch steigt die niedrige Ruppa empor. Ab-
wechselnd liegen auf der Ruppa nun runde oder viereckige
Platten, welche mit zierlichen Akanthen ini ersteren Falle
perlen, im letzteren Saphire oder Malachite festhalten. Solcher
Reiche sind ^8 in diesem mittleren Rahmen. Zwischen ihnen
steht ein fächerartiges Ornament aus Goldblech, von Fili-
gran umsäumt, welches in Eloisonnemanier rothe und grüne
Glasstückchen trägt.
Am äußern Rahmen (Fig. 50) fällt uns dann die be-
sondere Zierlichkeit und Abwechslung der Fassungen in die
Augen. Die großen viereckigen Malachite liegen in einem
50. Stein- und Perlenfassungen vom Codex aureus.
Staatsbibliothek München, Lim. 55. (wirkliche Größe.)
Häuschen (castellum), das aus einem Streifen Goldblech mit
ausgeschnittenein Blattornament besteht, vor das sich eine
doppelte Filigranvolute legt. Für die runden oder ovalen
Saphire dient eine ähnliche Fassung, nur legt sich auf diese
noch eine mit perlfaden verzierte Platte, die erst den Stein
trägt. Die kleineren Steine gefaßt in einer Art Arkaden-
stellung (doirmucula), die wieder ans Filigran gebildet ist
und deren minutiöse Säulchen aus einer viereckigen Basis
ruhen. Die Perlen ruhen in einem aus Goldblech getrie-
benen Zylinder mit mehreren Wülsten. Alle durchbrochenen
Fassungen hatten seinerzeit hinter den Deffnungen eine jetzt
zum Theil verschwundene Fütterung von dunkelblauer Seide,
die den Glanz des röthlich gefärbten Goldes noch erhöhte.
Diese höchst zierlichen Erzeugnisse einer sehr geschickten Gold
schmiedshand konnten in dieser Zeit nicht frei erfunden sein,
sondern inußten ein Vorbild haben. Bei genauer ver
gleichung einer großen Reihe von Goldschmiedwerken konnte
nun aus den deutschen Arbeiten eine Gruppe ausgeschieden
werden, welche die Zeit von ca. 975—1050 umfaßt und sich
durch die über den Stein greifenden Akanthusleisten und die
durchbrochenen Wände der Fassungen besonders charakterisirt.
Die frühesten und zugleich sicher datirten Werke dieser
Gruppe stammen aus Trier, wo sie auf Veranlassung des
Erzbischofes Egbert (977—993) entstanden sind. Das erste
der Werke ist der sog. Petrus st ab') gefertigt 980. Er
zeigt 20 in Goldblech getriebene Papst- und Bischosbildnisse,
acht figürliche Zellenemails und die (denen am Codex aureus
ähnlichen) durchbrochenen Steinfassungen. Diese Rapse! für
den sog. Wanderstab des Apostels Petrus ist in allen ihren
Theilen, das Email nicht ausgenommen, ein deutsches Werk.
Das zweite Werk ist der Andreasschrein,9 ebenfalls
auf Egberts Befehl gefertigt. Die Ornamentik der einen
Schmalseite ist so conform derjenigen fränkischer Scheiben-
fibeln (aus dein 7.— (0. Jahrhundert) mit Glaseinlagen in
Zellen, daß das Werk eben auch in Deutschland entstanden
sein nruß. Am Schrein befinden sich noch deutsche Zellen-
emails, die charakteristischen Fassungen a jour, sowie ein
eigenthümliches Dekorativ: eine perle, von der nach 2 Seiten
ein dreiblättriges Ornament (mit rother Glaseinlage) ausgeht.
Dieses Ornainent ist für die Werke aus Egberts Rreis typisch.
Es kehrt wieder mit den Schmelztäfelchen an dem Vorder
decket des Tod ex, welchen die Raiserin Theophanu mit ihrem
unmündigem Sohn nach Echternachs stiftete. Alle drei
erwähnten Werke sind in Trier entstanden und zwar in dem
immens reichen Rloster St. Maximin, dessen Runstwerk-
stätten auch urkundlich nachgewiesen sind.
Mit dem Andreasschrein, dem Petrusstab
und dem Echternachercodex hat nun unser Codex
aureus so viel Aehnlichkeit, daß sie alle in den
nämlichen stilistischen Rreis gehören. Aber auch
der Abt Ramwold war, bevor er nach St. En:
meram berufen wurde, gleich dein heil. Wolf-
gang (schon seit 930) Mönch und §ehrer im
Rloster St. Maximin gewesen; 98O gelegentlich
eines inneren Rrieges in Bayern mußte er aus
Regensburg flüchten, ging nach Trier, wo er jeden-
falls den oben fertig gestellten Petrusstab, vielleicht
auch schon die beiden andern Werke angefangen
sah und kehrte 980 nach St. Emmeram zurück,
9 L. a. Werth, „Siegeskreuz." Schmid 2;.
9 €. a. Werth, Kunstdenkmäler des christlichen Mittelalters
in den Rheinlanden. Tafel 54. Labarte, I. 338. Schmid 2j.
3) Lübke ;o6. Gtte, Kunstarchäologie I. ;75. Schmid 2;.