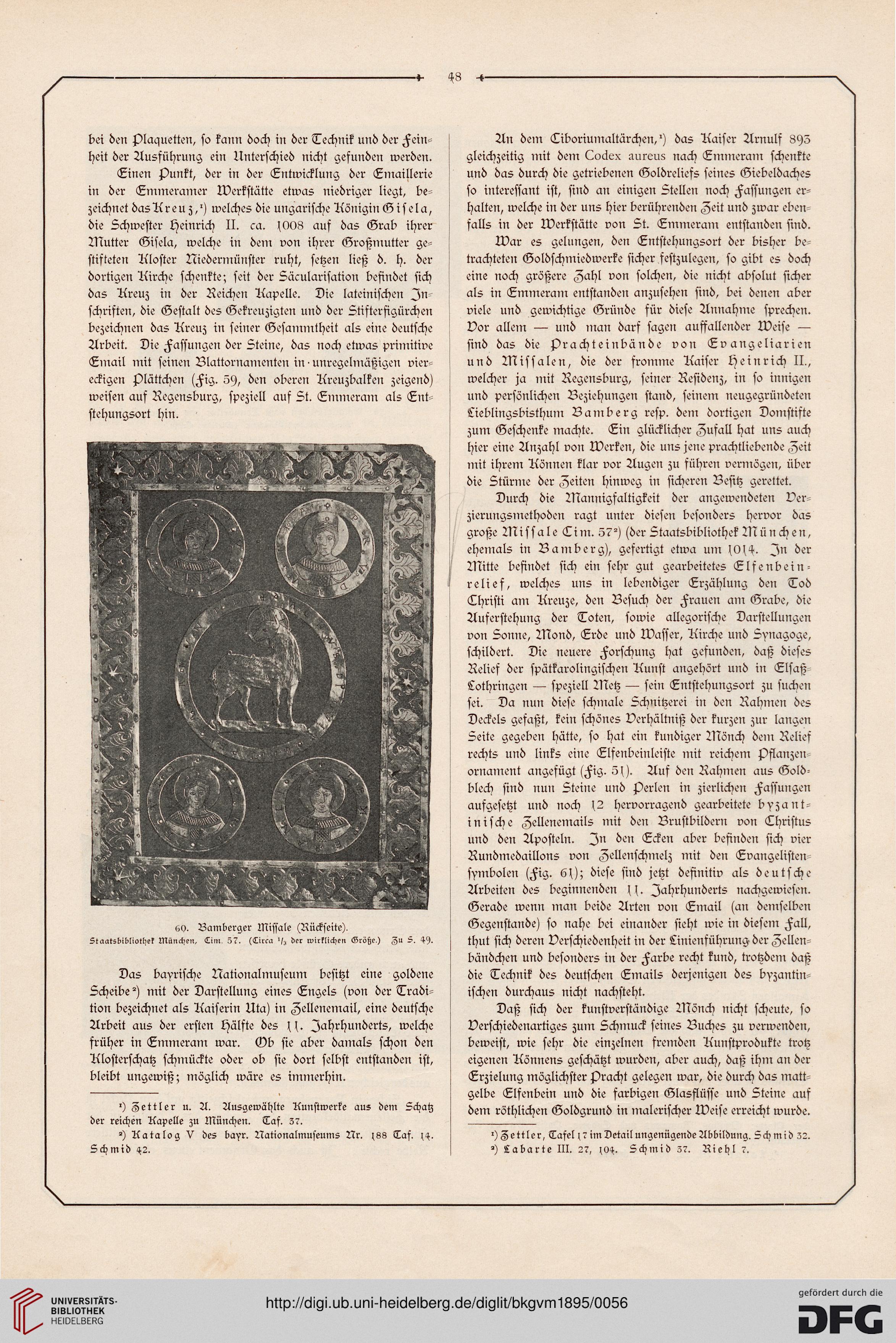bei den plaquetten, so kann doch in der Technik und der Fein-
heit der Ausführung ein Unterschied nicht gefunden werden.
Tinen punft, der in der Entwicklung der Emaillerie
in der Emmeramer Werkstätte etwas niedriger liegt, be-
zeichnet das Aren 3,1) welches die ungarische Aönigin Gisela,
die Schwester Heinrich II. ca. (008 auf das Grab ihrer
Mutter Gisela, welche in dein von ihrer Großmutter ge-
stifteten Aloster Niedermünster ruht, setzen ließ d. h. der
dortigen Airche schenkte; seit der Säcularisation befindet sich
das Areuz in der Reichen Aapelle. Die lateinischen In-
schriften, die Gestalt des Gekreuzigten und der Stifterfigürchen
bezeichnen das Areuz in seiner Gesammtheit als eine deutsche
Arbeit. Die Fassungen der Steine, das noch etwas primitive
Email mit seinen Blattornamenten in - unregelmäßigen vier-
eckigen Plättchen (Fig. 5Y, den oberen Areuzbalken zeigend)
weisen auf Regensburg, speziell auf Et. Emmeram als Ent
ftehungsort hin.
6l). Bamberger Miffale (Rückseite).
Staatsbibliothek München, Lim. 57. (Lirca ‘/u der wirklichen Größe.) Zu S. 49*
Das bayrische Nationalmuseum besitzt eine goldene
Scheibe2) mit der Darstellung eines Engels (von der Tradi-
tion bezeichnet als Aaiserin Uta) in Zellenemail, eine deutsche
Arbeit aus der ersten fjälfte des \ (. Jahrhunderts, welche
früher in Emmeram war. Mb sie aber damals schon den
Alosterschatz schmückte oder ob sie dort selbst entstanden ist,
bleibt ungewiß; möglich wäre es immerhin.
') Zeltler u. A. Ausgewählte Kunstwerke aus dem Schatz
der reichen Kapelle zu München. Taf. 37.
°>) Katalog V des bayr. Nationalmuseums Nr. (88 Taf. (-(.
Schmid 42.
An dem Tiboriumaltärchen,') das Aaifer Arnulf 8Y5
gleichzeitig mit dem Codex aureus nach Emmeram schenkte
und das durch die getriebenen Goldreliefs seines Giebeldaches
so interessant ist, sind an einigen Stellen noch Fassungen er-
halten, welche in der uns hier berührenden Zeit und zwar eben
falls in der Werkstätte von St. Emmeram entstanden sind.
U)ar es gelungen, den Entstehungsort der bisher be-
trachteten Goldschmiedwerke sicher festzulegen, so gibt es doch
eine noch größere Zahl von solchen, die nicht absolut sicher
als in Emmeram entstanden anzusehen sind, bei denen aber
viele und gewichtige Gründe für diese Annahme sprechen.
Bor allem — und man darf sagen auffallender Weise —
sind das die Prachteinbände von Ev angeliarien
und Missalen, die der fromme Aaiser Heinrich II.,
welcher ja mit Regensburg, seiner Residenz, in so innigen
und persönlichen Beziehungen stand, seinem neugegründeten
Lieblingsbisthum Bamberg resp. dem dortigen Domstifte
zum Geschenke machte. Ein glücklicher Zufall hat uns auch
hier eine Anzahl von Werken, die uns jene prachtliebende Zeit
mit ihrem Aönnen klar vor Augen zu führen vermögen, über
die Stürnte der Zeiten hinweg in sicheren Besitz gerettet.
Durch die Mannigfaltigkeit der angewendeten Ver
zierungsmethoden ragt unter diesen besonders hervor das
große Miffale Tim. 573) (der Staatsbibliothek München,
eheinals in Bamberg), gefertigt etwa um (0(^. In der
Mitte befindet sich ein sehr gut gearbeitetes Elfenbein-
j relief, welches uns in lebendiger Erzählung den Tod
Thristi am Areuze, den Besuch der Frauen am Grabe, die
Auferstehung der Toten, sowie allegorische Darstellungen
von Sonne, Mond, Erde und Wasser, Airche und Synagoge,
schildert. Die neuere Forschung hat gefunden, daß dieses
Relief der spätkarolingischen Aunst angehört und in Elsaß
Lothringen — speziell Metz — sein Lntstehungsort zu suchen
sei. Da nun diese schmale Schnitzerei in den Rahmen des
Deckels gefaßt, kein schönes Verhältniß der kurzen zur langen
Seite gegeben hätte, so hat ein kundiger Mönch dein Relief
rechts und links eine Elfenbein leiste mit reichem Pflanzen
Ornament angefügt (Fig. 51). Auf den Rahmen aus Gold-
blech sind nun Steine und perlen in zierlichen Fassungen
aufgesetzt und noch 12 hervorragend gearbeitete byzant-
inische Zellenemails mit den Brustbildern von Thristus
und den Aposteln. In den Ecken aber befinden sich vier
Rundntedaillons von Zellenschmelz mit den Evangelisten
symbolen (Fig. 6s); diese sind jetzt definitiv als deutsche
Arbeiten des beginnenden l l. Jahrhunderts nachgewiesen.
Gerade wenn man beide Arten von Email (an demselben
Gegenstände) so nahe bei einander sicht wie in diesem Fall,
thut sich deren Verschiedenheit in der Linienführung der Zellen-
bändchen und besonders in der Farbe recht kund, trotzdem daß
die Technik des deutschen Emails derjenigen des byzantin-
ischen durchaus nicht nachsteht.
Daß sich der kunstverständige Mönch nicht scheute, so
Verschiedenartiges zum Schmuck seines Buches zu verwenden,
beweist, wie sehr die einzelnen fremden Aunstprodukte trotz
eigenen Aönnens geschätzt wurden, aber auch, daß ihm an der
Erzielung möglichster Pracht gelegen war, die durch das matt
gelbe Elfenbein und die farbigen Glasflüsse und Steine auf
dem röthlichen Goldgrund in malerischer Weise erreicht wurde. *)
') Zeltler, Tafel (7 im Detail ungenügende Abbildung. Schmid 32.
*) Labarte III. 27, (Oq. Schmid 37. Riehl 7.
heit der Ausführung ein Unterschied nicht gefunden werden.
Tinen punft, der in der Entwicklung der Emaillerie
in der Emmeramer Werkstätte etwas niedriger liegt, be-
zeichnet das Aren 3,1) welches die ungarische Aönigin Gisela,
die Schwester Heinrich II. ca. (008 auf das Grab ihrer
Mutter Gisela, welche in dein von ihrer Großmutter ge-
stifteten Aloster Niedermünster ruht, setzen ließ d. h. der
dortigen Airche schenkte; seit der Säcularisation befindet sich
das Areuz in der Reichen Aapelle. Die lateinischen In-
schriften, die Gestalt des Gekreuzigten und der Stifterfigürchen
bezeichnen das Areuz in seiner Gesammtheit als eine deutsche
Arbeit. Die Fassungen der Steine, das noch etwas primitive
Email mit seinen Blattornamenten in - unregelmäßigen vier-
eckigen Plättchen (Fig. 5Y, den oberen Areuzbalken zeigend)
weisen auf Regensburg, speziell auf Et. Emmeram als Ent
ftehungsort hin.
6l). Bamberger Miffale (Rückseite).
Staatsbibliothek München, Lim. 57. (Lirca ‘/u der wirklichen Größe.) Zu S. 49*
Das bayrische Nationalmuseum besitzt eine goldene
Scheibe2) mit der Darstellung eines Engels (von der Tradi-
tion bezeichnet als Aaiserin Uta) in Zellenemail, eine deutsche
Arbeit aus der ersten fjälfte des \ (. Jahrhunderts, welche
früher in Emmeram war. Mb sie aber damals schon den
Alosterschatz schmückte oder ob sie dort selbst entstanden ist,
bleibt ungewiß; möglich wäre es immerhin.
') Zeltler u. A. Ausgewählte Kunstwerke aus dem Schatz
der reichen Kapelle zu München. Taf. 37.
°>) Katalog V des bayr. Nationalmuseums Nr. (88 Taf. (-(.
Schmid 42.
An dem Tiboriumaltärchen,') das Aaifer Arnulf 8Y5
gleichzeitig mit dem Codex aureus nach Emmeram schenkte
und das durch die getriebenen Goldreliefs seines Giebeldaches
so interessant ist, sind an einigen Stellen noch Fassungen er-
halten, welche in der uns hier berührenden Zeit und zwar eben
falls in der Werkstätte von St. Emmeram entstanden sind.
U)ar es gelungen, den Entstehungsort der bisher be-
trachteten Goldschmiedwerke sicher festzulegen, so gibt es doch
eine noch größere Zahl von solchen, die nicht absolut sicher
als in Emmeram entstanden anzusehen sind, bei denen aber
viele und gewichtige Gründe für diese Annahme sprechen.
Bor allem — und man darf sagen auffallender Weise —
sind das die Prachteinbände von Ev angeliarien
und Missalen, die der fromme Aaiser Heinrich II.,
welcher ja mit Regensburg, seiner Residenz, in so innigen
und persönlichen Beziehungen stand, seinem neugegründeten
Lieblingsbisthum Bamberg resp. dem dortigen Domstifte
zum Geschenke machte. Ein glücklicher Zufall hat uns auch
hier eine Anzahl von Werken, die uns jene prachtliebende Zeit
mit ihrem Aönnen klar vor Augen zu führen vermögen, über
die Stürnte der Zeiten hinweg in sicheren Besitz gerettet.
Durch die Mannigfaltigkeit der angewendeten Ver
zierungsmethoden ragt unter diesen besonders hervor das
große Miffale Tim. 573) (der Staatsbibliothek München,
eheinals in Bamberg), gefertigt etwa um (0(^. In der
Mitte befindet sich ein sehr gut gearbeitetes Elfenbein-
j relief, welches uns in lebendiger Erzählung den Tod
Thristi am Areuze, den Besuch der Frauen am Grabe, die
Auferstehung der Toten, sowie allegorische Darstellungen
von Sonne, Mond, Erde und Wasser, Airche und Synagoge,
schildert. Die neuere Forschung hat gefunden, daß dieses
Relief der spätkarolingischen Aunst angehört und in Elsaß
Lothringen — speziell Metz — sein Lntstehungsort zu suchen
sei. Da nun diese schmale Schnitzerei in den Rahmen des
Deckels gefaßt, kein schönes Verhältniß der kurzen zur langen
Seite gegeben hätte, so hat ein kundiger Mönch dein Relief
rechts und links eine Elfenbein leiste mit reichem Pflanzen
Ornament angefügt (Fig. 51). Auf den Rahmen aus Gold-
blech sind nun Steine und perlen in zierlichen Fassungen
aufgesetzt und noch 12 hervorragend gearbeitete byzant-
inische Zellenemails mit den Brustbildern von Thristus
und den Aposteln. In den Ecken aber befinden sich vier
Rundntedaillons von Zellenschmelz mit den Evangelisten
symbolen (Fig. 6s); diese sind jetzt definitiv als deutsche
Arbeiten des beginnenden l l. Jahrhunderts nachgewiesen.
Gerade wenn man beide Arten von Email (an demselben
Gegenstände) so nahe bei einander sicht wie in diesem Fall,
thut sich deren Verschiedenheit in der Linienführung der Zellen-
bändchen und besonders in der Farbe recht kund, trotzdem daß
die Technik des deutschen Emails derjenigen des byzantin-
ischen durchaus nicht nachsteht.
Daß sich der kunstverständige Mönch nicht scheute, so
Verschiedenartiges zum Schmuck seines Buches zu verwenden,
beweist, wie sehr die einzelnen fremden Aunstprodukte trotz
eigenen Aönnens geschätzt wurden, aber auch, daß ihm an der
Erzielung möglichster Pracht gelegen war, die durch das matt
gelbe Elfenbein und die farbigen Glasflüsse und Steine auf
dem röthlichen Goldgrund in malerischer Weise erreicht wurde. *)
') Zeltler, Tafel (7 im Detail ungenügende Abbildung. Schmid 32.
*) Labarte III. 27, (Oq. Schmid 37. Riehl 7.