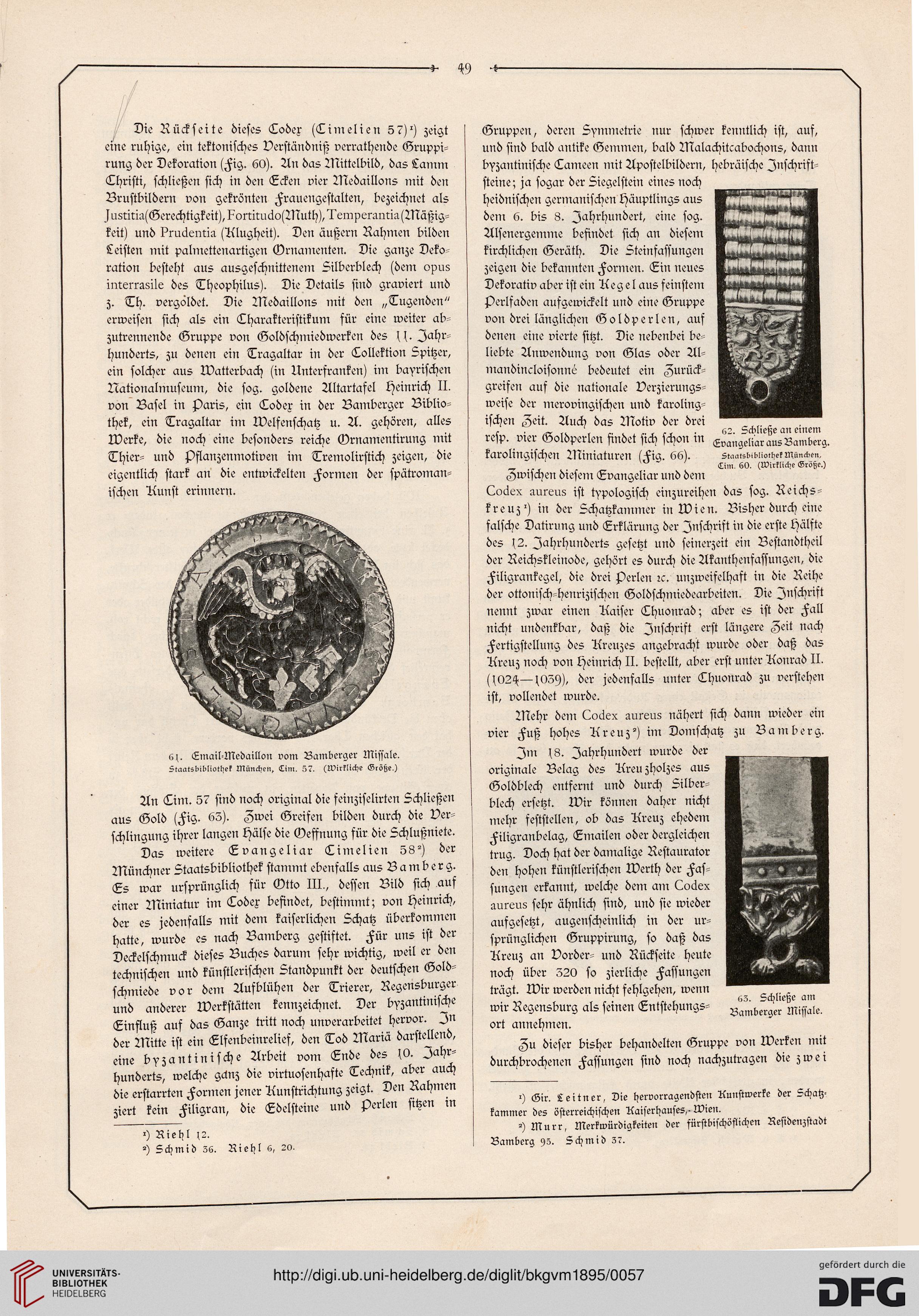Die Rückseite dieses Codex (Cimelien 5 7)') zeigt
eine ruhige, ein tektonisches Verständniß verrathende Gruppi-
rung der Dekoration (Fig. 60). An das Mittelbild, das Lamm
Thristi, schließen sich in den Ecken vier Medaillons mit den
Brustbildern von gekrönten Frauengestalten, bezeichnet als
^ustiria(Gerechtigkeit),Porrirudo(Muth),1emperauria(Mäßig-
keit) und Prudentia (Klugheit). Den äußern Rahmen bilden
Leisten mit palmettenartigen Ornamenten. Die ganze Deko-
ration besteht aus ausgeschnittenem Silberblech (den: opus
iinerrasile des Theophilus). Die Details sind graviert und
z. Th. vergoldet. Die Medaillons mit den „Tugenden"
erweisen sich als ein Charakteristikum für eine weiter ab
zutrennende Gruppe von Goldschmiedwerken des ff. Jahr-
hunderts, zu denen ein Tragaltar in der Lollektion Spitzer,
ein solcher aus Watterbach sin Unterfranken) im bayrischen
Nationalmuseum, die sog. goldene Altartafel Heinrich II.
von Basel in Paris, ein Codex in der Bamberger Biblio-
thek, ein Tragaltar im welfenschatz u. A. gehören, alles
Werke, die noch eine besonders reiche Ornamentirung mit
Thier- und Pflanzenmotiven im Tremolirstich zeigen, die
eigentlich stark an die entwickelten Formen der spätroman-
ischen Kunst erinnern.
6 p Lmail-Medaillon vom Bamberger Missale.
Staatsbibliothek München, Lim. 57. (wirkliche Größe.)
An Cim. 57 sind noch original die feinziselirten Schließen
aus Gold (Fig. 63). Zwei Greifen bilden durch die Ver-
schlingung ihrer langen Hälse die Geffnung für die Schlußniete.
Das weitere Evangeliar Limelien 58°) der
Münchner Staatsbibliothek stammt ebenfalls aus Bamberg.
Es war ursprünglich für Otto III., dessen Bild sich auf
einer Miniatur im Codex befindet, bestimmt; von Heinrich,
der es jedenfalls mit dem kaiserlichen Schatz überkommen
hatte, wurde es nach Bamberg gestiftet. Für uns ist der
Deckelschmuck dieses Buches darum sehr wichtig, weil er den
technischen und künstlerischen Standpunkt der deutschen Gold-
schmiede vor dem Aufblühen der Trierer, Regensburger
und anderer Werkstätten kennzeichnet. Der byzantinische
Einfluß auf das Ganze tritt noch unverarbeitet hervor. In
der Butte ist ein Elfenbeinrelief, den Tod Mariä darstellend,
eine byzantinische Arbeit vom Ende des s0. Jahr-
hunderts, welche gänz die virtuosen hafte Technik, aber auch
die erstarrten Formen jener Kunstrichtung zeigt. Den Rahmen
ziert kein Filigran, die Edelsteine und Perlen sitzen in
-) Riehl \2.
2) Sdjtnib 36. Riehl 6, 20.
Gruppen, deren Symmetrie nur schwer kenntlich ist, auf,
und sind bald antike Gemmen, bald Malachiteabochons, dann
byzantinische Cameen mit Apostelbildern,
steine; ja sogar der Siegelstein eines noch
heidnischen germanischen Häuptlings aus
dem 6. bis 3. Jahrhundert, eine sog.
Alsenergemme befindet sich an diesem
kirchlichen Geräth. Die Steinfassungen
zeigen die bekannten Formen. Ein neues
Dekorativ aber ist ein Kegel aus feinstem
perlfaden aufgewickelt und eine Gruppe
von drei länglichen Goldperlen, auf
denen eine vierte sitzt. Die nebenbei be-
liebte Anwendung von Glas oder AI-
mandincloisonns bedeutet ein Zurück-
greifen auf die nationale Verzierungs-
weise der merovingischen und karoling-
ischen Zeit. Auch das Motiv der drei
resp. vier Goldperlen findet sich schon in
karolingischen Miniaturen (Fig. 66).
zwischen diesem Evangeliar und dem
Codex aureus ist typologisch einzureihen das sog. Reichs-
kreuz') in der Schatzkammer in Wien. Bisher durch eine
falsche Datirung und Erklärung der Inschrift in die erste Hälfte
des {2. Jahrhunderts gesetzt und seinerzeit ein Bestandtheil
der Reichskleinode, gehört es durch die Akanthenfassungen, die
Filigrankegel, die drei perlen ic. unzweifelhaft in die Reihe
der ottonisch-henrizischen Goldschmiedearbeiten. Die Inschrift
nennt zwar einen Kaiser Lhuonrad; aber es ist der Fall
nicht undenkbar, daß die Inschrift erst längere Zeit nach
Fertigstellung des Kreuzes angebracht wurde oder daß das
Kreuz noch von Heinrich II. bestellt, aber erst unter Konrad II.
(H)2^—p>39), der jedenfalls unter Lhuonrad zu verstehen
ist, vollendet wurde.
Mehr dem Codex aureus nähert sich dann wieder ein
vier Fuß hohes Kreuz°) im Domschatz zu Bamberg.
Jm \8. Jahrhundert wurde der
originale Belag des Kreuzholzes aus
Goldblech entfernt und durch Silber-
blech ersetzt, wir können daher nicht
mehr feststellen, ob das Kreuz ehedem
Filigranbelag, Emailen oder dergleichen
trug. Doch hat der damalige Restaurator
den hohen künstlerischen Werth der Fas-
sungen erkannt, welche dem am Codex
aureus sehr ähnlich sind, und sie wieder
aufgesetzt, augenscheinlich in der ur-
sprünglichen Gruppirung, so daß das
Kreuz an Vorder- und Rückseite heute
noch über 320 so zierliche Fassungen
trägt, wir werden nicht fehlgehen, wenn
wir Regensburg als seinen Entstehungs-
ort annehmen.
Zu dieser bisher behandelten Gruppe von Werken mit
durchbrochenen Fassungen sind noch nachzutragen die zwei
') Gir. Leitner, Die hervorragendsten Kunstwerke der Schatz-
kammer des österreichischen Kaiserhauses,- Men.
-) Murr, Merkwürdigkeiten der sürstbischöflichen Residenzstadt
Bamberg 95. Schmid 37.
63. Schließe am
Bamberger Missale
hebräische Jnschrift-
62. Schließe an einein
Lvangeliar aus Bamberg.
Staatsbibliothek Müncben,
Lim. 60. (wirkliche Größe.)
eine ruhige, ein tektonisches Verständniß verrathende Gruppi-
rung der Dekoration (Fig. 60). An das Mittelbild, das Lamm
Thristi, schließen sich in den Ecken vier Medaillons mit den
Brustbildern von gekrönten Frauengestalten, bezeichnet als
^ustiria(Gerechtigkeit),Porrirudo(Muth),1emperauria(Mäßig-
keit) und Prudentia (Klugheit). Den äußern Rahmen bilden
Leisten mit palmettenartigen Ornamenten. Die ganze Deko-
ration besteht aus ausgeschnittenem Silberblech (den: opus
iinerrasile des Theophilus). Die Details sind graviert und
z. Th. vergoldet. Die Medaillons mit den „Tugenden"
erweisen sich als ein Charakteristikum für eine weiter ab
zutrennende Gruppe von Goldschmiedwerken des ff. Jahr-
hunderts, zu denen ein Tragaltar in der Lollektion Spitzer,
ein solcher aus Watterbach sin Unterfranken) im bayrischen
Nationalmuseum, die sog. goldene Altartafel Heinrich II.
von Basel in Paris, ein Codex in der Bamberger Biblio-
thek, ein Tragaltar im welfenschatz u. A. gehören, alles
Werke, die noch eine besonders reiche Ornamentirung mit
Thier- und Pflanzenmotiven im Tremolirstich zeigen, die
eigentlich stark an die entwickelten Formen der spätroman-
ischen Kunst erinnern.
6 p Lmail-Medaillon vom Bamberger Missale.
Staatsbibliothek München, Lim. 57. (wirkliche Größe.)
An Cim. 57 sind noch original die feinziselirten Schließen
aus Gold (Fig. 63). Zwei Greifen bilden durch die Ver-
schlingung ihrer langen Hälse die Geffnung für die Schlußniete.
Das weitere Evangeliar Limelien 58°) der
Münchner Staatsbibliothek stammt ebenfalls aus Bamberg.
Es war ursprünglich für Otto III., dessen Bild sich auf
einer Miniatur im Codex befindet, bestimmt; von Heinrich,
der es jedenfalls mit dem kaiserlichen Schatz überkommen
hatte, wurde es nach Bamberg gestiftet. Für uns ist der
Deckelschmuck dieses Buches darum sehr wichtig, weil er den
technischen und künstlerischen Standpunkt der deutschen Gold-
schmiede vor dem Aufblühen der Trierer, Regensburger
und anderer Werkstätten kennzeichnet. Der byzantinische
Einfluß auf das Ganze tritt noch unverarbeitet hervor. In
der Butte ist ein Elfenbeinrelief, den Tod Mariä darstellend,
eine byzantinische Arbeit vom Ende des s0. Jahr-
hunderts, welche gänz die virtuosen hafte Technik, aber auch
die erstarrten Formen jener Kunstrichtung zeigt. Den Rahmen
ziert kein Filigran, die Edelsteine und Perlen sitzen in
-) Riehl \2.
2) Sdjtnib 36. Riehl 6, 20.
Gruppen, deren Symmetrie nur schwer kenntlich ist, auf,
und sind bald antike Gemmen, bald Malachiteabochons, dann
byzantinische Cameen mit Apostelbildern,
steine; ja sogar der Siegelstein eines noch
heidnischen germanischen Häuptlings aus
dem 6. bis 3. Jahrhundert, eine sog.
Alsenergemme befindet sich an diesem
kirchlichen Geräth. Die Steinfassungen
zeigen die bekannten Formen. Ein neues
Dekorativ aber ist ein Kegel aus feinstem
perlfaden aufgewickelt und eine Gruppe
von drei länglichen Goldperlen, auf
denen eine vierte sitzt. Die nebenbei be-
liebte Anwendung von Glas oder AI-
mandincloisonns bedeutet ein Zurück-
greifen auf die nationale Verzierungs-
weise der merovingischen und karoling-
ischen Zeit. Auch das Motiv der drei
resp. vier Goldperlen findet sich schon in
karolingischen Miniaturen (Fig. 66).
zwischen diesem Evangeliar und dem
Codex aureus ist typologisch einzureihen das sog. Reichs-
kreuz') in der Schatzkammer in Wien. Bisher durch eine
falsche Datirung und Erklärung der Inschrift in die erste Hälfte
des {2. Jahrhunderts gesetzt und seinerzeit ein Bestandtheil
der Reichskleinode, gehört es durch die Akanthenfassungen, die
Filigrankegel, die drei perlen ic. unzweifelhaft in die Reihe
der ottonisch-henrizischen Goldschmiedearbeiten. Die Inschrift
nennt zwar einen Kaiser Lhuonrad; aber es ist der Fall
nicht undenkbar, daß die Inschrift erst längere Zeit nach
Fertigstellung des Kreuzes angebracht wurde oder daß das
Kreuz noch von Heinrich II. bestellt, aber erst unter Konrad II.
(H)2^—p>39), der jedenfalls unter Lhuonrad zu verstehen
ist, vollendet wurde.
Mehr dem Codex aureus nähert sich dann wieder ein
vier Fuß hohes Kreuz°) im Domschatz zu Bamberg.
Jm \8. Jahrhundert wurde der
originale Belag des Kreuzholzes aus
Goldblech entfernt und durch Silber-
blech ersetzt, wir können daher nicht
mehr feststellen, ob das Kreuz ehedem
Filigranbelag, Emailen oder dergleichen
trug. Doch hat der damalige Restaurator
den hohen künstlerischen Werth der Fas-
sungen erkannt, welche dem am Codex
aureus sehr ähnlich sind, und sie wieder
aufgesetzt, augenscheinlich in der ur-
sprünglichen Gruppirung, so daß das
Kreuz an Vorder- und Rückseite heute
noch über 320 so zierliche Fassungen
trägt, wir werden nicht fehlgehen, wenn
wir Regensburg als seinen Entstehungs-
ort annehmen.
Zu dieser bisher behandelten Gruppe von Werken mit
durchbrochenen Fassungen sind noch nachzutragen die zwei
') Gir. Leitner, Die hervorragendsten Kunstwerke der Schatz-
kammer des österreichischen Kaiserhauses,- Men.
-) Murr, Merkwürdigkeiten der sürstbischöflichen Residenzstadt
Bamberg 95. Schmid 37.
63. Schließe am
Bamberger Missale
hebräische Jnschrift-
62. Schließe an einein
Lvangeliar aus Bamberg.
Staatsbibliothek Müncben,
Lim. 60. (wirkliche Größe.)