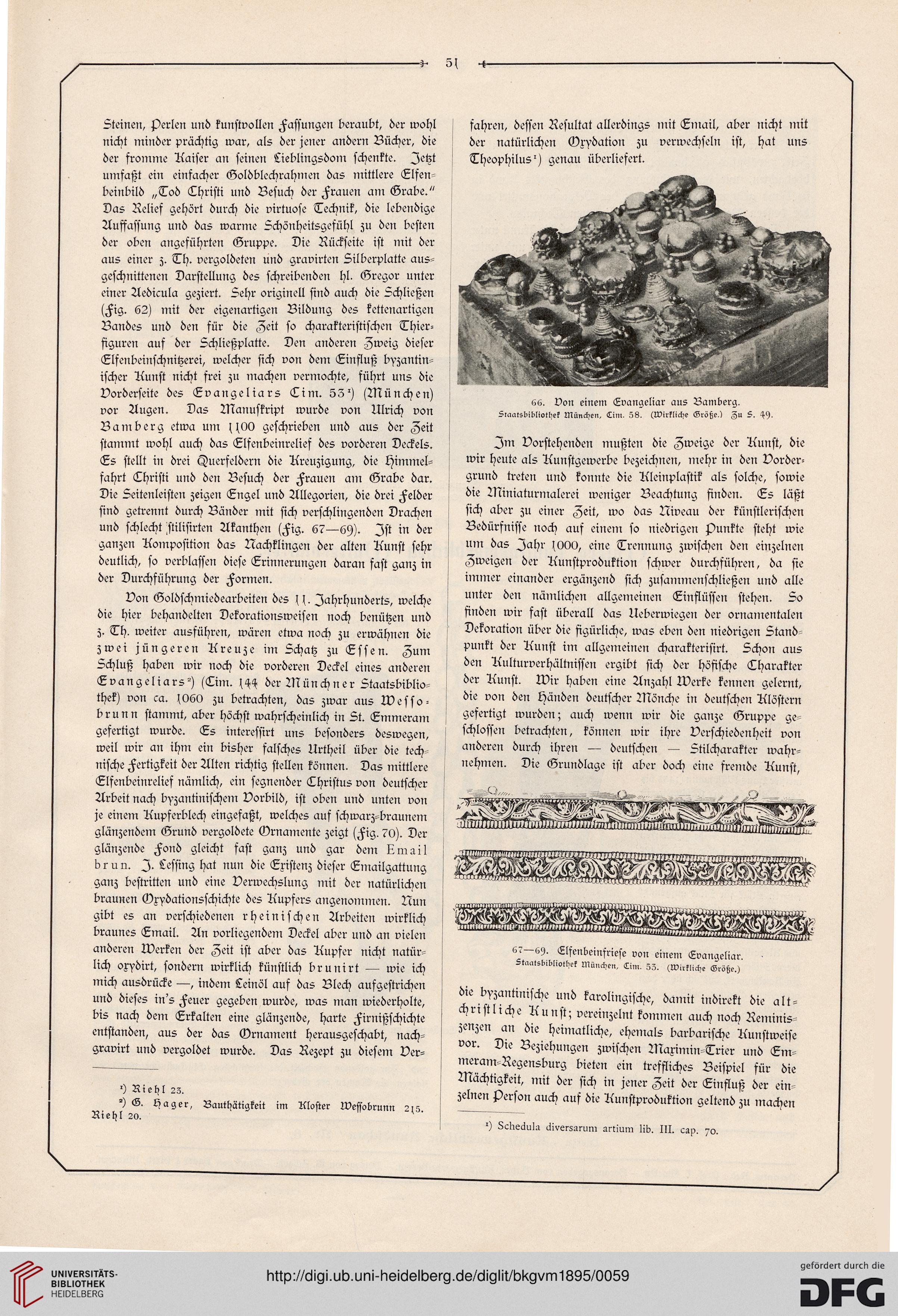Steinen, perlen und kunstvollen Fassungen beraubt, der wohl
nicht minder prächtig war, als der jener andern Bücher, die
der fromme Kaiser an seinen Lieblingsdom schenkte. Jetzt
umfaßt ein einfacher Goldblechrahmen das mittlere Elfen
beinbild „Tod Thristi und Besuch der Frauen am Grabe."
Das Relief gehört durch die virtuose Technik, die lebendige
Auffassung und das warme Schönheitsgefühl zu den besten
der oben angeführten Gruppe. Die Rückseite ist mit der
aus einer z. Th. vergoldeten und gravirten Silberplatte aus-
geschnittenen Darstellung des schreibenden hl. Gregor unter
einer Aedicula geziert. Sehr originell sind auch die schließen
(Fig. 62) mit der eigenartigen Bildung des kettenartigen
Bandes und den für die Zeit so charakteristischen Thier-
figuren auf der Schließplatte. Den anderen Zweig dieser
Elfenbeinschnitzerei, welcher sich von dem Einfluß byzantin-
ischer Kunft nicht frei zu machen vermochte, führt uns die
Vorderseite des Evangeliars Tim. 53*) )München)
vor Augen. Das Manuskript wurde von Ulrich von
Bamberg etwa um poo geschrieben und aus der Zeit
stammt wohl auch das Elfenbeinrelief des vorderen Deckels.
Es stellt in drei tzfuerfeldern die Kreuzigung, die pimmel-
fahrt Thristi und den Besuch der Frauen am Grabe dar.
Die Seitenleisten zeigen Engel und Allegorien, die drei Felder
sind getrennt durch Bänder mit sich verschlingenden Drachen
und schlecht stilisirten Akanthen (Fig. 67—69). Ist in der
ganzen Komposition das Nachklingen der alten Kunst sehr
deutlich, so verblassen diese Erinnerungen daran fast ganz in
der Durchführung der Formen.
Von Goldschmiedearbeiten des ff. Jahrhunderts, welche
die hier behandelten Dekorationsweisen noch benützen und
z. Th. weiter ausführen, wären etwa noch zu erwähnen die
zwei jüngeren Kreuze im Schatz zu Essen. Zum
Schluß haben wir noch die vorderen Deckel eines anderen
Evangeliars*) (Tim. der Münchner Staatsbiblio-
thek) von ca. 1060 jU betrachten, das zwar aus Wesso-
brunn stammt, aber höchst wahrscheinlich in St. Emmeram
gefertigt wurde. Es interessirt uns besonders deswegen,
weil wir an ihm ei» bisher falsches Urtheil über die tech
nische Fertigkeit der Alten richtig stellen können. Das mittlere
Elfenbeinrelief nämlich, ein segnender Lhristus von deutscher
Arbeit nach byzantinischem Vorbild, ist oben und unten von
je einem Kupferblech eingefaßt, welches auf schwarz-braunem
glänzendem Grund vergoldete ©rnamentc zeigt (Fig. 70). Der
glänzende Fond gleicht fast ganz und gar dem Email
b r u n. 3- Messing hat nun die Existenz dieser Emailgattung
ganz bestritten und eine Verwechslung mit der natürlichen
braunen Oxydationsschichte des Kupfers angenommen. Nun
gibt es an verschiedenen rheinischen Arbeiten wirklich
braunes Email. An vorliegendem Deckel aber und an vielen
anderen Werken der Zeit ist aber das Kupfer nicht natür-
lich oxydirt, sondern wirklich künstlich brunirt — wie ich
mich ausdrücke —, indem Leinöl auf das Blech aufgestrichen
und dieses in's Feuer gegeben wurde, was man wiederholte,
bis nach dem Erkalten eine glänzende, harte Firnißschichte
entstanden, aus der das Ornament herausgeschabt, nach-
gravirt und vergoldet wurde. Das Rezept zu diesem Ver-
■) Riehl 23.
2) Bager, Bauthätigkeit im Klafter Wessobrunn 215.
Riehl 20.
fahren, dessen Resultat allerdings mit Email, aber nicht mit
der natürlichen Oxydation zu verwechseln ist, hat uns
Theophilus') genau überliefert.
66. von einem Evangeliar aus Bamberg.
Staatsbibliotbef München, Lim. 58. (wirkliche Größe.) Zu S. 4Y.
Im Vorstehenden mußten die Zweige der Kunst, die
wir heute als Kunstgewerbe bezeichnen, mehr in den Vorder-
grund trete» und konnte die Kleinplastik als solche, sowie
die Miniaturmalerei weniger Beachtung finden. Es läßt
sich aber zu einer Zeit, wo das Niveau der künstlerischen
Bedürfnisse noch auf einem so niedrigen punkte steht wie
um das Jahr f000, eine Trennung zwischen den einzelnen
Zweigen der Kunstproduktion schwer durchführen, da sie
immer einander ergänzend sich zusammenschließen und alle
unter den nämlichen allgemeinen Einflüssen stehen. So
finden wir fast überall das Ueberwiegen der ornamentalen
Dekoration über die figürliche, was eben den niedrigen Stand
punkt der Kunst im allgemeinen charakterisirt. Schon aus
den Kulturverhältnissen ergibt sich der höfische Tharakter
der Kunst. Wir haben eine Anzahl Werke kennen gelernt,
die von den pänden deutscher Mönche in deutschen Klöstern
gefertigt wurden; auch wenn wir die ganze Gruppe ge-
schlossen betrachten, können wir ihre Verschiedenheit von
anderen durch ihren — deutschen — Stilcharakter wahr-
nehmen. Die Grundlage ist aber doch eine fremde Kunst,
67—69. Llsenbeinfriese von einem Evangeliar.
Slaalsbiblioibek München, Lim. 53. (wirklich- Grüße.)
die byzantinische und karolingische, damit indirekt die alt-
christliche Kunst; vereinzelnt kommen auch noch Reminis-
zenzen an die heimatliche, ehemals barbarische Kunstweise
vor. Die Beziehungen zwischen Maximin Trier und Em-
meram Regensburg bieten ein treffliches Beispiel für die
Mächtigkeit, mit der sich in jener Zeit der Einfluß der ein
Zelnen Person auch auf die Kunstproduktion geltend zu »rachen
x) Schedula diversarum artium lib. III.
cap. 70.
nicht minder prächtig war, als der jener andern Bücher, die
der fromme Kaiser an seinen Lieblingsdom schenkte. Jetzt
umfaßt ein einfacher Goldblechrahmen das mittlere Elfen
beinbild „Tod Thristi und Besuch der Frauen am Grabe."
Das Relief gehört durch die virtuose Technik, die lebendige
Auffassung und das warme Schönheitsgefühl zu den besten
der oben angeführten Gruppe. Die Rückseite ist mit der
aus einer z. Th. vergoldeten und gravirten Silberplatte aus-
geschnittenen Darstellung des schreibenden hl. Gregor unter
einer Aedicula geziert. Sehr originell sind auch die schließen
(Fig. 62) mit der eigenartigen Bildung des kettenartigen
Bandes und den für die Zeit so charakteristischen Thier-
figuren auf der Schließplatte. Den anderen Zweig dieser
Elfenbeinschnitzerei, welcher sich von dem Einfluß byzantin-
ischer Kunft nicht frei zu machen vermochte, führt uns die
Vorderseite des Evangeliars Tim. 53*) )München)
vor Augen. Das Manuskript wurde von Ulrich von
Bamberg etwa um poo geschrieben und aus der Zeit
stammt wohl auch das Elfenbeinrelief des vorderen Deckels.
Es stellt in drei tzfuerfeldern die Kreuzigung, die pimmel-
fahrt Thristi und den Besuch der Frauen am Grabe dar.
Die Seitenleisten zeigen Engel und Allegorien, die drei Felder
sind getrennt durch Bänder mit sich verschlingenden Drachen
und schlecht stilisirten Akanthen (Fig. 67—69). Ist in der
ganzen Komposition das Nachklingen der alten Kunst sehr
deutlich, so verblassen diese Erinnerungen daran fast ganz in
der Durchführung der Formen.
Von Goldschmiedearbeiten des ff. Jahrhunderts, welche
die hier behandelten Dekorationsweisen noch benützen und
z. Th. weiter ausführen, wären etwa noch zu erwähnen die
zwei jüngeren Kreuze im Schatz zu Essen. Zum
Schluß haben wir noch die vorderen Deckel eines anderen
Evangeliars*) (Tim. der Münchner Staatsbiblio-
thek) von ca. 1060 jU betrachten, das zwar aus Wesso-
brunn stammt, aber höchst wahrscheinlich in St. Emmeram
gefertigt wurde. Es interessirt uns besonders deswegen,
weil wir an ihm ei» bisher falsches Urtheil über die tech
nische Fertigkeit der Alten richtig stellen können. Das mittlere
Elfenbeinrelief nämlich, ein segnender Lhristus von deutscher
Arbeit nach byzantinischem Vorbild, ist oben und unten von
je einem Kupferblech eingefaßt, welches auf schwarz-braunem
glänzendem Grund vergoldete ©rnamentc zeigt (Fig. 70). Der
glänzende Fond gleicht fast ganz und gar dem Email
b r u n. 3- Messing hat nun die Existenz dieser Emailgattung
ganz bestritten und eine Verwechslung mit der natürlichen
braunen Oxydationsschichte des Kupfers angenommen. Nun
gibt es an verschiedenen rheinischen Arbeiten wirklich
braunes Email. An vorliegendem Deckel aber und an vielen
anderen Werken der Zeit ist aber das Kupfer nicht natür-
lich oxydirt, sondern wirklich künstlich brunirt — wie ich
mich ausdrücke —, indem Leinöl auf das Blech aufgestrichen
und dieses in's Feuer gegeben wurde, was man wiederholte,
bis nach dem Erkalten eine glänzende, harte Firnißschichte
entstanden, aus der das Ornament herausgeschabt, nach-
gravirt und vergoldet wurde. Das Rezept zu diesem Ver-
■) Riehl 23.
2) Bager, Bauthätigkeit im Klafter Wessobrunn 215.
Riehl 20.
fahren, dessen Resultat allerdings mit Email, aber nicht mit
der natürlichen Oxydation zu verwechseln ist, hat uns
Theophilus') genau überliefert.
66. von einem Evangeliar aus Bamberg.
Staatsbibliotbef München, Lim. 58. (wirkliche Größe.) Zu S. 4Y.
Im Vorstehenden mußten die Zweige der Kunst, die
wir heute als Kunstgewerbe bezeichnen, mehr in den Vorder-
grund trete» und konnte die Kleinplastik als solche, sowie
die Miniaturmalerei weniger Beachtung finden. Es läßt
sich aber zu einer Zeit, wo das Niveau der künstlerischen
Bedürfnisse noch auf einem so niedrigen punkte steht wie
um das Jahr f000, eine Trennung zwischen den einzelnen
Zweigen der Kunstproduktion schwer durchführen, da sie
immer einander ergänzend sich zusammenschließen und alle
unter den nämlichen allgemeinen Einflüssen stehen. So
finden wir fast überall das Ueberwiegen der ornamentalen
Dekoration über die figürliche, was eben den niedrigen Stand
punkt der Kunst im allgemeinen charakterisirt. Schon aus
den Kulturverhältnissen ergibt sich der höfische Tharakter
der Kunst. Wir haben eine Anzahl Werke kennen gelernt,
die von den pänden deutscher Mönche in deutschen Klöstern
gefertigt wurden; auch wenn wir die ganze Gruppe ge-
schlossen betrachten, können wir ihre Verschiedenheit von
anderen durch ihren — deutschen — Stilcharakter wahr-
nehmen. Die Grundlage ist aber doch eine fremde Kunst,
67—69. Llsenbeinfriese von einem Evangeliar.
Slaalsbiblioibek München, Lim. 53. (wirklich- Grüße.)
die byzantinische und karolingische, damit indirekt die alt-
christliche Kunst; vereinzelnt kommen auch noch Reminis-
zenzen an die heimatliche, ehemals barbarische Kunstweise
vor. Die Beziehungen zwischen Maximin Trier und Em-
meram Regensburg bieten ein treffliches Beispiel für die
Mächtigkeit, mit der sich in jener Zeit der Einfluß der ein
Zelnen Person auch auf die Kunstproduktion geltend zu »rachen
x) Schedula diversarum artium lib. III.
cap. 70.