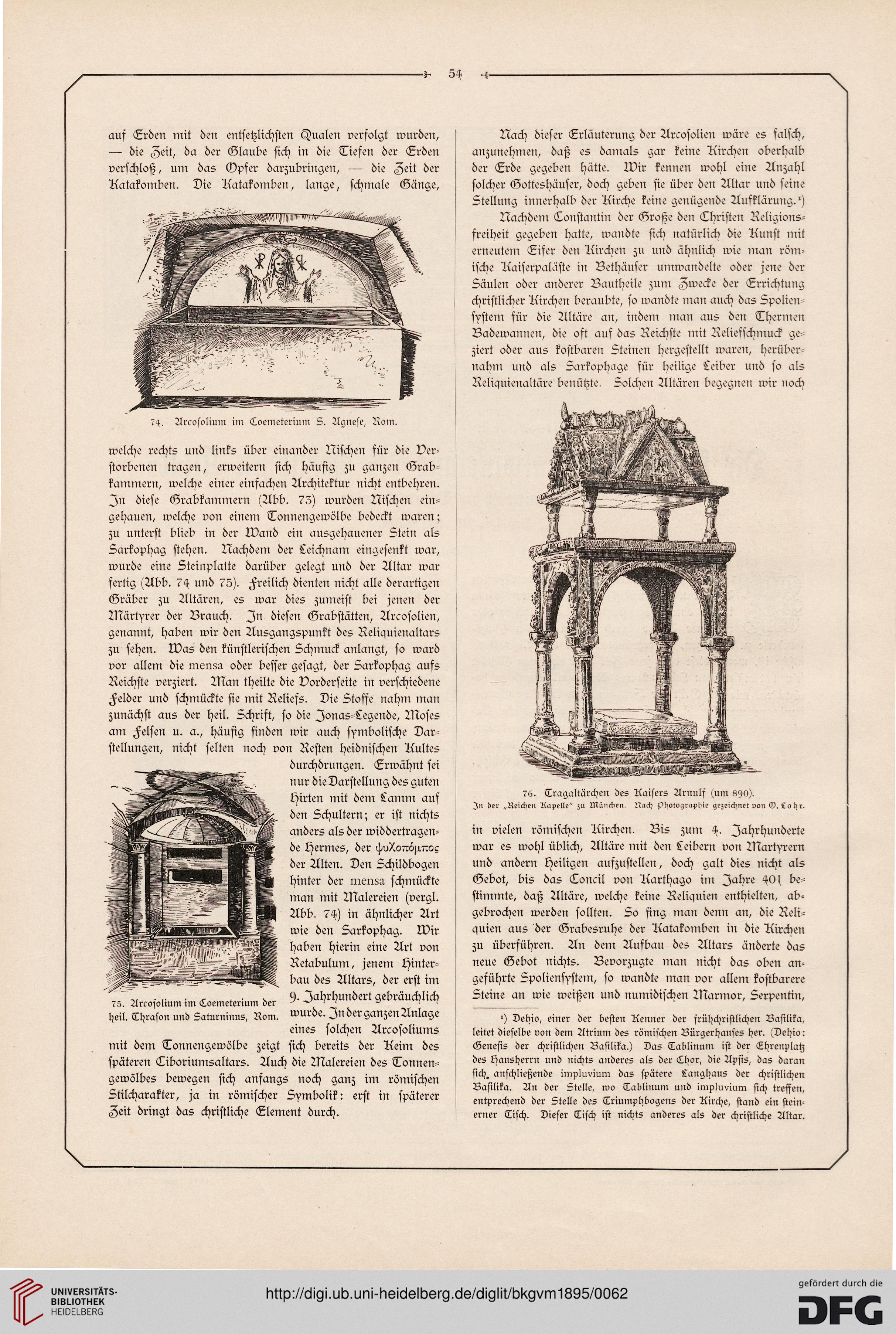h 5^ -§■
/
\
auf Erden mit den entsetzlichsten Dualen verfolgt wurden,
— die Zeit, da der Glaube sich in die Tiefen der Erden
verschloß, um das Opfer darzubringen, — die Zeit der
Katakomben. Die Katakomben, lange, schmale Gänge,
74. Arcosolium im Loemeterium S. Agnese, Kom.
welche rechts und links über einander Nischen für die Ver-
storbenen tragen, erweitern sich häufig zu ganzen Grab-
kammern, welche einer einfachen Architektur nicht entbehren.
Zn diese Grabkammern (Abb. 73) wurden Nischen ein-
gehauen, welche von einem Tonnengewölbe bedeckt waren;
zu unterst blieb in der A)and ein ausgehauener Stein als
Sarkophag stehen. Nachdem der Leichnam eingesenkt war,
wurde eine Steinplatte darüber gelegt und der Altar war
fertig (Abb. 7^ und 75). Freilich dienten nicht alle derartigen
Gräber zu Altären, es war dies zumeist bei jenen der
Märtyrer der Brauch. Zn diesen Grabstätten, Arcosolien,
genannt, haben wir den Ausgangspunkt des Reliquienaltars
zu sehen. Was den künstlerischen Schmuck anlangt, so ward
vor allem die mensa oder besser gesagt, der Sarkophag aufs
Reichste verziert. Man theilte die Vorderseite in verschiedene
Felder und schmückte sie mit Reliefs. Die Stoffe nahm man
zunächst aus der heil. Schrift, so die Zonas-Legende, Moses
am Felsen u. a., häufig finden wir auch symbolische Dar
stellungen, nicht selten noch von Resten heidnischen Kultes
durchdrungen. Erwähnt sei
nur die Darstellung des guten
Birten mit dem Lamm auf
den Schultern; er ist nichts
anders als der widdertragen-
de Hermes, der dju7.0776[i.~cg
der Alten. Den Schildbogen
hinter der mensa schmückte
man mit Malereien (vergl.
Abb. 7^) in ähnlicher Art
wie den Sarkophag. Wir
haben hierin eine Art von
Retabulum, jenem Binter
bau des Altars, der erst im
st. Zahrhundert gebräuchlich
wurde. Zn der ganzen Anlage
eines solchen Arcosoliums
sich bereits der Reim des
späteren Tiboriumsaltars. Auch die Malereien des Tonnen-
gewölbes bewegen sich anfangs noch ganz im römischen
Stilcharakter, ja in römischer Symbolik: erst in späterer
Zeit dringt das christliche Element durch.
Nach dieser Erläuterung der Arcosolien wäre es falsch,
anzunehmen, daß es damals gar keine Kirchen oberhalb
der Erde gegeben hätte. Wir kennen wohl eine Anzahl
solcher Gotteshäuser, doch geben sie über den Altar und seine
Stellung innerhalb der Kirche keine genügende Aufklärung.')
Nachdem Tonstantin der Große den Thristen Religions-
freiheit gegeben hatte, wandte sich natürlich die Kunst mit
erneutem Eifer den Kirchen zu und ähnlich wie man röm-
ische Kaiserpaläste in Bethäuser umwandelte oder jene der
Säulen oder anderer Bautheile zum Zwecke der Errichtung
| christlicher Kirchen beraubte, so wandte man auch das Spolien-
fystem für die Altäre an, indem man aus den Thermen
Badewannen, die oft auf das Reichste mit Reliefschmuck ge-
ziert oder aus kostbaren Steinen hergestellt waren, herüber-
nahm und als Sarkophage für heilige Leiber und so als
Reliquienaltäre benützte. Solchen Altären begegnen wir noch
76. Tragaltärchen des Kaisers Arnulf (um 890).
Zn der „Reichen Rapelle" zu München. Nach Photographie gezeichnet von V. Lohr.
in vielen römischen Kirchen. Bis zun: ch Zahrhunderte
war es wohl üblich, Altäre mit den Leibern von Märtyrern
und andern heiligen aufzustellen, doch galt dies nicht als
Gebot, bis das Toncil von Karthago im Zahre qof be-
stimmte, daß Altäre, welche keine Reliquien enthielten, ab-
gebrochen werden sollten. So fing man denn an, die Reli-
quien aus der Grabesruhe der Katakomben in die Kirchen
zu überführen. An dem Aufbau des Altars änderte das
neue Gebot nichts. Bevorzugte inan nicht das oben an-
geführte Spoliensystem, so wandte man vor allem kostbarere
Steine an wie weißen und numidischen Marmor, Serpentin,
st Dehio, einer der besten Kenner der frühchristlichen Basilika,
leitet dieselbe von dem Atrium des römischen Bürgerhauses her. (Dehio:
Genesis der christlichen Basilika.) Das Tablinum ist der Ehrenplatz
des Hausherrn und nichts anderes als der Eher, die Apsis, das daran
sich, anschließende impluvium das spätere Langhaus der christlichen
Basilika. An der Stelle, wo Tablinum und impluvium sich treffen,
entprechend der Stelle des Triumphbogens der Kirche, stand ein stein-
erner Tisch. Dieser Tisch ist nichts anderes als der christliche Altar.
75. Arcosolium im Loemeterium der
heil. Thrason und Saturninus, Rom.
mit dem Tonnengewölbe zeigt
X
/
\
auf Erden mit den entsetzlichsten Dualen verfolgt wurden,
— die Zeit, da der Glaube sich in die Tiefen der Erden
verschloß, um das Opfer darzubringen, — die Zeit der
Katakomben. Die Katakomben, lange, schmale Gänge,
74. Arcosolium im Loemeterium S. Agnese, Kom.
welche rechts und links über einander Nischen für die Ver-
storbenen tragen, erweitern sich häufig zu ganzen Grab-
kammern, welche einer einfachen Architektur nicht entbehren.
Zn diese Grabkammern (Abb. 73) wurden Nischen ein-
gehauen, welche von einem Tonnengewölbe bedeckt waren;
zu unterst blieb in der A)and ein ausgehauener Stein als
Sarkophag stehen. Nachdem der Leichnam eingesenkt war,
wurde eine Steinplatte darüber gelegt und der Altar war
fertig (Abb. 7^ und 75). Freilich dienten nicht alle derartigen
Gräber zu Altären, es war dies zumeist bei jenen der
Märtyrer der Brauch. Zn diesen Grabstätten, Arcosolien,
genannt, haben wir den Ausgangspunkt des Reliquienaltars
zu sehen. Was den künstlerischen Schmuck anlangt, so ward
vor allem die mensa oder besser gesagt, der Sarkophag aufs
Reichste verziert. Man theilte die Vorderseite in verschiedene
Felder und schmückte sie mit Reliefs. Die Stoffe nahm man
zunächst aus der heil. Schrift, so die Zonas-Legende, Moses
am Felsen u. a., häufig finden wir auch symbolische Dar
stellungen, nicht selten noch von Resten heidnischen Kultes
durchdrungen. Erwähnt sei
nur die Darstellung des guten
Birten mit dem Lamm auf
den Schultern; er ist nichts
anders als der widdertragen-
de Hermes, der dju7.0776[i.~cg
der Alten. Den Schildbogen
hinter der mensa schmückte
man mit Malereien (vergl.
Abb. 7^) in ähnlicher Art
wie den Sarkophag. Wir
haben hierin eine Art von
Retabulum, jenem Binter
bau des Altars, der erst im
st. Zahrhundert gebräuchlich
wurde. Zn der ganzen Anlage
eines solchen Arcosoliums
sich bereits der Reim des
späteren Tiboriumsaltars. Auch die Malereien des Tonnen-
gewölbes bewegen sich anfangs noch ganz im römischen
Stilcharakter, ja in römischer Symbolik: erst in späterer
Zeit dringt das christliche Element durch.
Nach dieser Erläuterung der Arcosolien wäre es falsch,
anzunehmen, daß es damals gar keine Kirchen oberhalb
der Erde gegeben hätte. Wir kennen wohl eine Anzahl
solcher Gotteshäuser, doch geben sie über den Altar und seine
Stellung innerhalb der Kirche keine genügende Aufklärung.')
Nachdem Tonstantin der Große den Thristen Religions-
freiheit gegeben hatte, wandte sich natürlich die Kunst mit
erneutem Eifer den Kirchen zu und ähnlich wie man röm-
ische Kaiserpaläste in Bethäuser umwandelte oder jene der
Säulen oder anderer Bautheile zum Zwecke der Errichtung
| christlicher Kirchen beraubte, so wandte man auch das Spolien-
fystem für die Altäre an, indem man aus den Thermen
Badewannen, die oft auf das Reichste mit Reliefschmuck ge-
ziert oder aus kostbaren Steinen hergestellt waren, herüber-
nahm und als Sarkophage für heilige Leiber und so als
Reliquienaltäre benützte. Solchen Altären begegnen wir noch
76. Tragaltärchen des Kaisers Arnulf (um 890).
Zn der „Reichen Rapelle" zu München. Nach Photographie gezeichnet von V. Lohr.
in vielen römischen Kirchen. Bis zun: ch Zahrhunderte
war es wohl üblich, Altäre mit den Leibern von Märtyrern
und andern heiligen aufzustellen, doch galt dies nicht als
Gebot, bis das Toncil von Karthago im Zahre qof be-
stimmte, daß Altäre, welche keine Reliquien enthielten, ab-
gebrochen werden sollten. So fing man denn an, die Reli-
quien aus der Grabesruhe der Katakomben in die Kirchen
zu überführen. An dem Aufbau des Altars änderte das
neue Gebot nichts. Bevorzugte inan nicht das oben an-
geführte Spoliensystem, so wandte man vor allem kostbarere
Steine an wie weißen und numidischen Marmor, Serpentin,
st Dehio, einer der besten Kenner der frühchristlichen Basilika,
leitet dieselbe von dem Atrium des römischen Bürgerhauses her. (Dehio:
Genesis der christlichen Basilika.) Das Tablinum ist der Ehrenplatz
des Hausherrn und nichts anderes als der Eher, die Apsis, das daran
sich, anschließende impluvium das spätere Langhaus der christlichen
Basilika. An der Stelle, wo Tablinum und impluvium sich treffen,
entprechend der Stelle des Triumphbogens der Kirche, stand ein stein-
erner Tisch. Dieser Tisch ist nichts anderes als der christliche Altar.
75. Arcosolium im Loemeterium der
heil. Thrason und Saturninus, Rom.
mit dem Tonnengewölbe zeigt
X