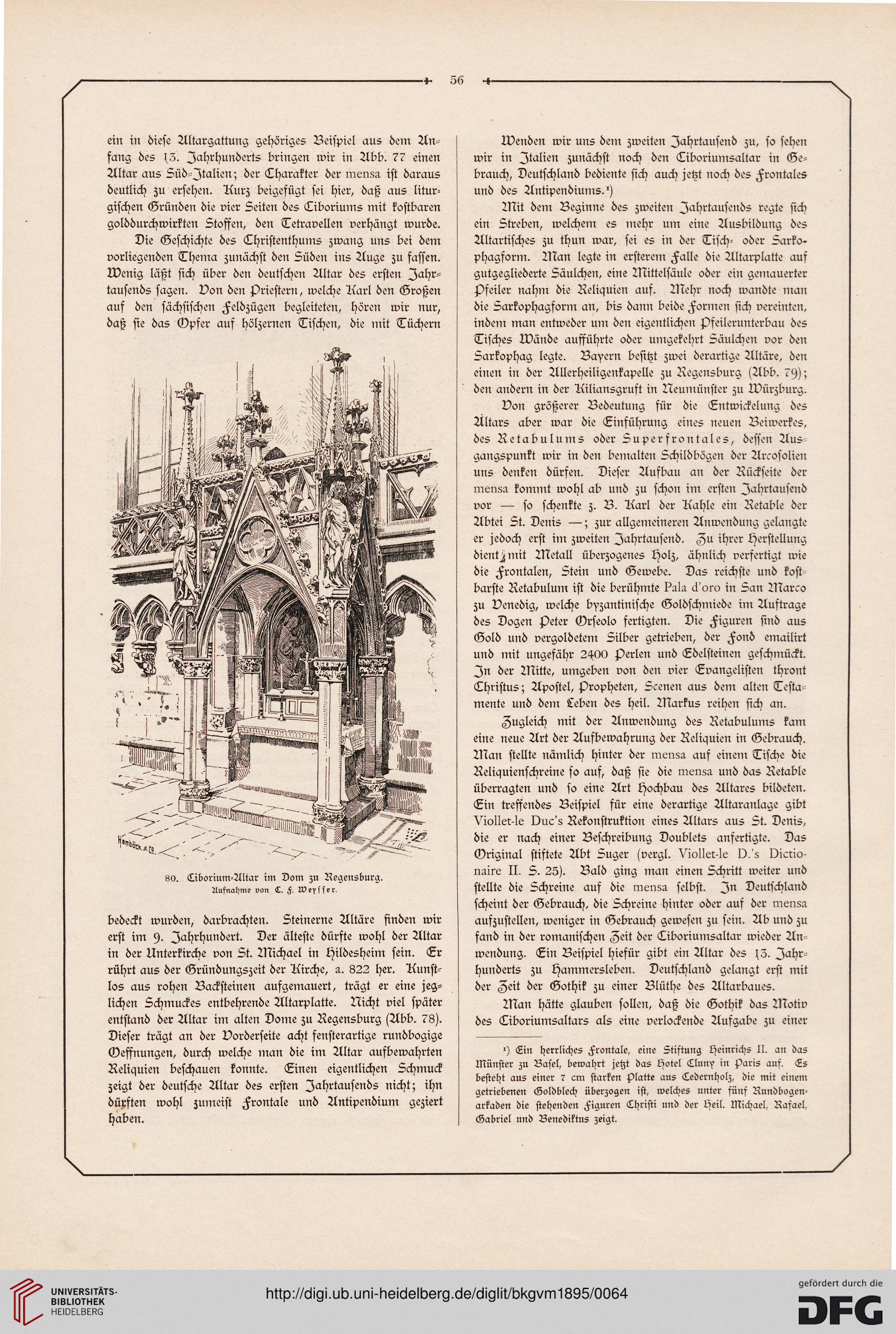ein in diese Altargattung gehöriges Beispiel aus dem An-
fang des sZ. Jahrhunderts bringen wir in Abb. 77 einen
Altar aus Süd-Italien; der Tharakter der mensa ist daraus
deutlich zu ersehen. Aurz beigefügt sei hier, daß aus litur-
gischen Gründen die vier Leiten des Tiboriums mit kostbaren
golddurchwirkten Stoffen, den Tetravellen verhängt wurde.
Die Geschichte des Thristenthums zwang uns bei dem
vorliegenden Thema zunächst den Lüden ins Auge zu fasten.
Wenig läßt sich über den deutschen Altar des ersten Jahr-
tausends sagen. Von den Priestern, welche Aarl den Großen
auf den sächsischen Feldzügen begleiteten, hören wir nur,
daß sie das Gpfer auf hölzernen Tischen, die mit Tüchern
80. Liborium-Altar im Dom zu Regensburg.
Aufnahme von <£. Z. Weysser.
bedeckt wurden, darbrachten. Lteinerne Altäre finden wir
erst im st. Jahrhundert. Der älteste dürfte wohl der Altar
in der Unterkirche von 5t. Michael in bsildesheim sein. Tr
rührt aus der Gründungszeit der Airche, a. 822 her. Aunst-
los aus rohen Backsteinen aufgemauert, trägt er eine jeg-
lichen Schmuckes entbehrende Altarplatte. Nicht viel später
entstand der Altar im alten Dome zu Regensburg (Abb. 78).
Dieser trägt an der Vorderseite acht fensterartige rundbogige
Geffnungen, durch welche man die im Altar aufbewahrten
Reliquien beschauen konnte. Tinen eigentlichen Schmuck
zeigt der deutsche Altar des ersten Jahrtausends nicht; ihn
dürften wohl zumeist Frontale und Antipendium geziert
haben.
Wenden wir uns dem zweiten Jahrtausend zu, so sehen
wir in Italien zunächst noch den Tiboriumsaltar in Ge-
brauch, Deutschland bediente sich auch jetzt noch des Frontales
und des Antipendiums.')
Mit dem Beginne des zweiten Jahrtausends regte sich
ein Streben, welchem es inehr um eine Ausbildung des
Altartisches zu thun war, sei es in der Tisch- oder Larko.
phagform. Man legte in ersterem Falle die Altarplatte aus
gutgegliederte Läulchen, eine Mittelsäule oder ein gemauerter
Pfeiler nahm die Reliquien auf. Mehr noch wandte man
die Sarkophagform an, bis dann beide Fornien sich vereinten,
indem man entweder um den eigentlichen pfeilerunterbau des
Tisches Wände aufführte oder umgekehrt Säulchen vor den
Sarkophag legte. Bayern besitzt zwei derartige Altäre, den
einen in der Allerheiligenkapelle zu Regensburg (Abb. 79);
den andern in der Ailiansgruft in Neuniünster zu Würzburg.
Von größerer Bedeutung für die Tntwickelung des
Altars aber war die Tinführung eines neuen Beiwerkes,
des Retabulums oder Superfrontales, dessen Aus
gangspunkt wir in den bemalten Schildbögen der Arcosolien
uns denken dürfen. Dieser Aufbau an der Rückseite der
mensa kommt wohl ab und zu schon im ersten Jahrtausend
vor — so schenkte z. B. Aarl der Aahle ein Retable der
Abtei 5t. Denis —; zur allgemeineren Anwendung gelangte
er jedoch erst im zweiten Jahrtausend. Zu ihrer Herstellung
Ment j mit Metall überzogenes polz, ähnlich verfertigt wie
die Frontalen, Stein und Gewebe. Das reichste und kost
barste Retabulum ist die berühmte Pala d’oro in San Marco
zu Venedig, welche byzantinische Goldschmiede im Austrage
des Dogen Peter Mrseolo fertigten. Die Figuren sind aus
Gold und vergoldetem Silber getrieben, der Fond emailirt
und mit ungefähr 2400 perlen und Tdelsteinen geschmückt.
In der Mitte, umgeben von den vier Tvangelisten thront
Thristus; Apostel, Propheten, Lcenen aus dem alten Testa-
mente und dem Leben des heil. Markus reihen sich an.
Zugleich mit der Anwendung des Retabulums kam
eine neue Art der Aufbewahrung der Reliquien in Gebrauch.
Man stellte nämlich hinter der mensa auf einen: Tische die
Reliquienschreine so auf, daß sie die mensa und das Retable
überragten und so eine Art Hochbau des Altares bildeten.
Tin treffendes Beispiel für eine derartige Altaranlage gibt
VioUer-Ie Vuc's Rekonstruktion eines Altars aus 5t. Denis,
die er nach einer Beschreibung Doublets anfertigte. Das
Original stiftete Abt Luger (vergl. Viollet-le D.’s Dictio-
naire II. 5. 25). Bald ging man einen Schritt weiter und
stellte die Schreine auf die mensa selbst. In Deutschland
scheint der Gebrauch, die Schreine hinter oder auf der mensa
auszustellen, weniger in Gebrauch gewesen zu sein. Ab und zu
fand in der romanischen Zeit der Tiboriumsaltar wieder An-
wendung. Tin Beispiel hiefür gibt ein Altar des 13. Jahr-
hunderts zu Hammersleben. Deutschland gelangt erst mit
der Zeit der Gothik zu einer Blüthe des Altarbaues.
Man hätte glauben sollen, daß die Gothik das Motiv
des Tiboriumsaltars als eine verlockende Aufgabe zu einer
») Lin herrliches Frontale, eine Stiftung lieinrichs II. an das
Münster zu Bafel, bewahrt jetzt das lhotel Lluny in Paris auf. Ls
besteht aus einer 7 crn starken Platte aus Ledernholz, die mit einem
getriebenen Goldblech überzogen ist, welches unter fünf Rundbogen-
arkaden die stehenden Figuren Lhristi und der Heil. Michael, Rafael,
Gabriel und Benediktus zeigt.
fang des sZ. Jahrhunderts bringen wir in Abb. 77 einen
Altar aus Süd-Italien; der Tharakter der mensa ist daraus
deutlich zu ersehen. Aurz beigefügt sei hier, daß aus litur-
gischen Gründen die vier Leiten des Tiboriums mit kostbaren
golddurchwirkten Stoffen, den Tetravellen verhängt wurde.
Die Geschichte des Thristenthums zwang uns bei dem
vorliegenden Thema zunächst den Lüden ins Auge zu fasten.
Wenig läßt sich über den deutschen Altar des ersten Jahr-
tausends sagen. Von den Priestern, welche Aarl den Großen
auf den sächsischen Feldzügen begleiteten, hören wir nur,
daß sie das Gpfer auf hölzernen Tischen, die mit Tüchern
80. Liborium-Altar im Dom zu Regensburg.
Aufnahme von <£. Z. Weysser.
bedeckt wurden, darbrachten. Lteinerne Altäre finden wir
erst im st. Jahrhundert. Der älteste dürfte wohl der Altar
in der Unterkirche von 5t. Michael in bsildesheim sein. Tr
rührt aus der Gründungszeit der Airche, a. 822 her. Aunst-
los aus rohen Backsteinen aufgemauert, trägt er eine jeg-
lichen Schmuckes entbehrende Altarplatte. Nicht viel später
entstand der Altar im alten Dome zu Regensburg (Abb. 78).
Dieser trägt an der Vorderseite acht fensterartige rundbogige
Geffnungen, durch welche man die im Altar aufbewahrten
Reliquien beschauen konnte. Tinen eigentlichen Schmuck
zeigt der deutsche Altar des ersten Jahrtausends nicht; ihn
dürften wohl zumeist Frontale und Antipendium geziert
haben.
Wenden wir uns dem zweiten Jahrtausend zu, so sehen
wir in Italien zunächst noch den Tiboriumsaltar in Ge-
brauch, Deutschland bediente sich auch jetzt noch des Frontales
und des Antipendiums.')
Mit dem Beginne des zweiten Jahrtausends regte sich
ein Streben, welchem es inehr um eine Ausbildung des
Altartisches zu thun war, sei es in der Tisch- oder Larko.
phagform. Man legte in ersterem Falle die Altarplatte aus
gutgegliederte Läulchen, eine Mittelsäule oder ein gemauerter
Pfeiler nahm die Reliquien auf. Mehr noch wandte man
die Sarkophagform an, bis dann beide Fornien sich vereinten,
indem man entweder um den eigentlichen pfeilerunterbau des
Tisches Wände aufführte oder umgekehrt Säulchen vor den
Sarkophag legte. Bayern besitzt zwei derartige Altäre, den
einen in der Allerheiligenkapelle zu Regensburg (Abb. 79);
den andern in der Ailiansgruft in Neuniünster zu Würzburg.
Von größerer Bedeutung für die Tntwickelung des
Altars aber war die Tinführung eines neuen Beiwerkes,
des Retabulums oder Superfrontales, dessen Aus
gangspunkt wir in den bemalten Schildbögen der Arcosolien
uns denken dürfen. Dieser Aufbau an der Rückseite der
mensa kommt wohl ab und zu schon im ersten Jahrtausend
vor — so schenkte z. B. Aarl der Aahle ein Retable der
Abtei 5t. Denis —; zur allgemeineren Anwendung gelangte
er jedoch erst im zweiten Jahrtausend. Zu ihrer Herstellung
Ment j mit Metall überzogenes polz, ähnlich verfertigt wie
die Frontalen, Stein und Gewebe. Das reichste und kost
barste Retabulum ist die berühmte Pala d’oro in San Marco
zu Venedig, welche byzantinische Goldschmiede im Austrage
des Dogen Peter Mrseolo fertigten. Die Figuren sind aus
Gold und vergoldetem Silber getrieben, der Fond emailirt
und mit ungefähr 2400 perlen und Tdelsteinen geschmückt.
In der Mitte, umgeben von den vier Tvangelisten thront
Thristus; Apostel, Propheten, Lcenen aus dem alten Testa-
mente und dem Leben des heil. Markus reihen sich an.
Zugleich mit der Anwendung des Retabulums kam
eine neue Art der Aufbewahrung der Reliquien in Gebrauch.
Man stellte nämlich hinter der mensa auf einen: Tische die
Reliquienschreine so auf, daß sie die mensa und das Retable
überragten und so eine Art Hochbau des Altares bildeten.
Tin treffendes Beispiel für eine derartige Altaranlage gibt
VioUer-Ie Vuc's Rekonstruktion eines Altars aus 5t. Denis,
die er nach einer Beschreibung Doublets anfertigte. Das
Original stiftete Abt Luger (vergl. Viollet-le D.’s Dictio-
naire II. 5. 25). Bald ging man einen Schritt weiter und
stellte die Schreine auf die mensa selbst. In Deutschland
scheint der Gebrauch, die Schreine hinter oder auf der mensa
auszustellen, weniger in Gebrauch gewesen zu sein. Ab und zu
fand in der romanischen Zeit der Tiboriumsaltar wieder An-
wendung. Tin Beispiel hiefür gibt ein Altar des 13. Jahr-
hunderts zu Hammersleben. Deutschland gelangt erst mit
der Zeit der Gothik zu einer Blüthe des Altarbaues.
Man hätte glauben sollen, daß die Gothik das Motiv
des Tiboriumsaltars als eine verlockende Aufgabe zu einer
») Lin herrliches Frontale, eine Stiftung lieinrichs II. an das
Münster zu Bafel, bewahrt jetzt das lhotel Lluny in Paris auf. Ls
besteht aus einer 7 crn starken Platte aus Ledernholz, die mit einem
getriebenen Goldblech überzogen ist, welches unter fünf Rundbogen-
arkaden die stehenden Figuren Lhristi und der Heil. Michael, Rafael,
Gabriel und Benediktus zeigt.