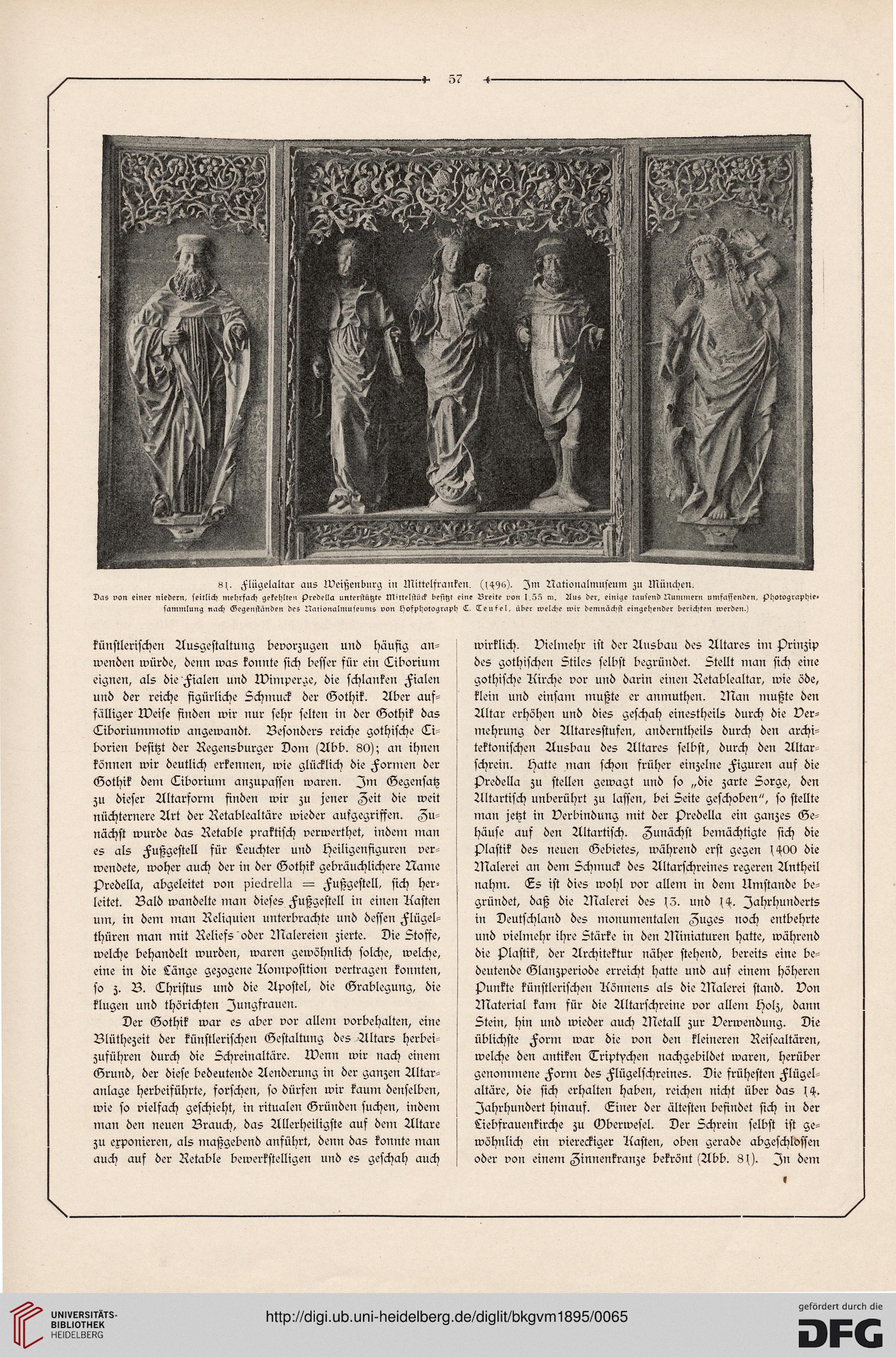57
4
/
\
8;. Flügelaltar aus Weitzenburg in Mittelsranken. (^90). Im Nationalmuseum zu München.
Das von einer niedern, seitlich mehrfach gekehlten Predella unterstützte M'ttelstück besitzt eine Breite von 1.55 m. Aus der, einige tausend Nummern umfassenden, Photographie»
sammlung nach Gegenständen des Nationalmuseunis von ^ofphotograph T. Teufel, über welche wir demnächst eingehender berichten werden.)
künstlerischen Ausgestaltung bevorzugen und häufig an-
wenden würde, denn was konnte sich bester für ein Tiborium
eignen, als die Fialen und Wimperge, die schlanken Fialen
und der reiche figürliche Schmuck der Gothik. Aber auf-
fälliger weise finden wir nur sehr selten in der Gothik das
Tiboriummotiv angewandt. Besonders reiche gothische Ti-
borien besitzt der Regensburger Dom (Abb. 80); ait ihnen
können wir deutlich erkennen, wie glücklich die Formen der
Gothik dem Tiborium anzupasten waren. Im Gegensatz
zu dieser Altarform finden wir zu jener Zeit die weit
nüchternere Art der Retablealtäre wieder aufgegriffen. Zu-
nächst wurde das Retable praktisch verwerthet, indem man
es als Fußgestell für Leuchter und Heiligenfiguren ver-
wendete, woher auch der in der Gothik gebräuchlichere Name
Predella, abgeleitet von piedrella — Fußgestell, sich her-
leitet. Bald wandelte man dieses Fußgestell in einen Aasten
um, in dem inan Reliquien unterbrachte und dessen Flügel-
thüren man mit Reliefs oder Malereien zierte. Die Stoffe,
welche behandelt wurden, waren gewöhnlich solche, welche,
eine in die Länge gezogene Komposition vertragen konnten,
so z. B. Christus und die Apostel, die Grablegung, die
klugen und thörichten Jungfrauen.
Der Gothik war es aber vor allem Vorbehalten, eine
Blüthezeit der künstlerischen Gestaltung des Altars herbei-
zuführen durch die Schreinaltäre, wenn wir nach einem
Grund, der diese bedeutende Aenderung in der ganzen Altar-
anlage herbeiführte, forschen, so dürfen wir kauin denselben,
wie so vielfach geschieht, in ritualen Gründen suchen, indem
man den neuen Brauch, das Allerheiligste aus dem Altäre
zu exponieren, als maßgebend anführt, denn das konnte man
auch auf der Retable bewerkstelligen und es geschah auch
wirklich. Vielmehr ist der Ausbau des Altares in: Prinzip
des gothischen Stiles selbst begründet. Stellt man sich eine
gothische Kirche vor und darin einen Retablealtar, wie öde,
klein und einsam mußte er anmuthen. Man mußte den
Altar erhöhen und dies geschah einestheils durch die Ver-
mehrung der Altaresstufen, anderntheils durch den archi-
tektonischen Ausbau des Altares selbst, durch den Altar
schrein. hatte man schon früher einzelne Figuren auf die
Predella zu stellen gewagt und so „die zarte Sorge, den
Altartisch unberührt zu lassen, bei Seite geschoben", so stellte
man jetzt in Verbindung mit der Predella ein ganzes Ge-
häuse aus den Altartisch. Zunächst bemächtigte sich die
Plastik des neuen Gebietes, während erst gegen ^00 die
Malerei an dem Schmuck des Altarschreines regeren Antheil
nahm. Ts ist dies wohl vor allem in dem Umstande be-
gründet, daß die Malerei des s3. und Jahrhunderts
in Deutschland des monumentalen Zuges noch entbehrte
und vielmehr ihre Stärke in den Miniaturen hatte, während
die Plastik, der Architektur näher stehend, bereits eine be-
deutende Glanzperiode erreicht hatte und auf einem höheren
Punkte künstlerischen Könnens als die Malerei stand. Von
Material kam für die Altarschreine vor allem Holz, dann
Stein, hin und wieder auch Metall zur Verwendung. Die
üblichste Form war die von den kleineren Reisealtären,
welche den antiken Triptychen nachgebildet waren, herüber
genommene Form des Flügelschreines. Die frühesten Flügel-
altäre, die sich erhalten haben, reichen nicht über das sH.
Jahrhundert hinauf. Tiner der ältesten befindet sich in der
Liebsrauenkirche zu Mberwesel. Der Schrein selbst ist ge-
wöhnlich ein viereckiger Kasten, oben gerade abgeschlossen
oder von einem Zinnenkränze bekrönt (Abb. 8 s). In dem
X
«
4
/
\
8;. Flügelaltar aus Weitzenburg in Mittelsranken. (^90). Im Nationalmuseum zu München.
Das von einer niedern, seitlich mehrfach gekehlten Predella unterstützte M'ttelstück besitzt eine Breite von 1.55 m. Aus der, einige tausend Nummern umfassenden, Photographie»
sammlung nach Gegenständen des Nationalmuseunis von ^ofphotograph T. Teufel, über welche wir demnächst eingehender berichten werden.)
künstlerischen Ausgestaltung bevorzugen und häufig an-
wenden würde, denn was konnte sich bester für ein Tiborium
eignen, als die Fialen und Wimperge, die schlanken Fialen
und der reiche figürliche Schmuck der Gothik. Aber auf-
fälliger weise finden wir nur sehr selten in der Gothik das
Tiboriummotiv angewandt. Besonders reiche gothische Ti-
borien besitzt der Regensburger Dom (Abb. 80); ait ihnen
können wir deutlich erkennen, wie glücklich die Formen der
Gothik dem Tiborium anzupasten waren. Im Gegensatz
zu dieser Altarform finden wir zu jener Zeit die weit
nüchternere Art der Retablealtäre wieder aufgegriffen. Zu-
nächst wurde das Retable praktisch verwerthet, indem man
es als Fußgestell für Leuchter und Heiligenfiguren ver-
wendete, woher auch der in der Gothik gebräuchlichere Name
Predella, abgeleitet von piedrella — Fußgestell, sich her-
leitet. Bald wandelte man dieses Fußgestell in einen Aasten
um, in dem inan Reliquien unterbrachte und dessen Flügel-
thüren man mit Reliefs oder Malereien zierte. Die Stoffe,
welche behandelt wurden, waren gewöhnlich solche, welche,
eine in die Länge gezogene Komposition vertragen konnten,
so z. B. Christus und die Apostel, die Grablegung, die
klugen und thörichten Jungfrauen.
Der Gothik war es aber vor allem Vorbehalten, eine
Blüthezeit der künstlerischen Gestaltung des Altars herbei-
zuführen durch die Schreinaltäre, wenn wir nach einem
Grund, der diese bedeutende Aenderung in der ganzen Altar-
anlage herbeiführte, forschen, so dürfen wir kauin denselben,
wie so vielfach geschieht, in ritualen Gründen suchen, indem
man den neuen Brauch, das Allerheiligste aus dem Altäre
zu exponieren, als maßgebend anführt, denn das konnte man
auch auf der Retable bewerkstelligen und es geschah auch
wirklich. Vielmehr ist der Ausbau des Altares in: Prinzip
des gothischen Stiles selbst begründet. Stellt man sich eine
gothische Kirche vor und darin einen Retablealtar, wie öde,
klein und einsam mußte er anmuthen. Man mußte den
Altar erhöhen und dies geschah einestheils durch die Ver-
mehrung der Altaresstufen, anderntheils durch den archi-
tektonischen Ausbau des Altares selbst, durch den Altar
schrein. hatte man schon früher einzelne Figuren auf die
Predella zu stellen gewagt und so „die zarte Sorge, den
Altartisch unberührt zu lassen, bei Seite geschoben", so stellte
man jetzt in Verbindung mit der Predella ein ganzes Ge-
häuse aus den Altartisch. Zunächst bemächtigte sich die
Plastik des neuen Gebietes, während erst gegen ^00 die
Malerei an dem Schmuck des Altarschreines regeren Antheil
nahm. Ts ist dies wohl vor allem in dem Umstande be-
gründet, daß die Malerei des s3. und Jahrhunderts
in Deutschland des monumentalen Zuges noch entbehrte
und vielmehr ihre Stärke in den Miniaturen hatte, während
die Plastik, der Architektur näher stehend, bereits eine be-
deutende Glanzperiode erreicht hatte und auf einem höheren
Punkte künstlerischen Könnens als die Malerei stand. Von
Material kam für die Altarschreine vor allem Holz, dann
Stein, hin und wieder auch Metall zur Verwendung. Die
üblichste Form war die von den kleineren Reisealtären,
welche den antiken Triptychen nachgebildet waren, herüber
genommene Form des Flügelschreines. Die frühesten Flügel-
altäre, die sich erhalten haben, reichen nicht über das sH.
Jahrhundert hinauf. Tiner der ältesten befindet sich in der
Liebsrauenkirche zu Mberwesel. Der Schrein selbst ist ge-
wöhnlich ein viereckiger Kasten, oben gerade abgeschlossen
oder von einem Zinnenkränze bekrönt (Abb. 8 s). In dem
X
«