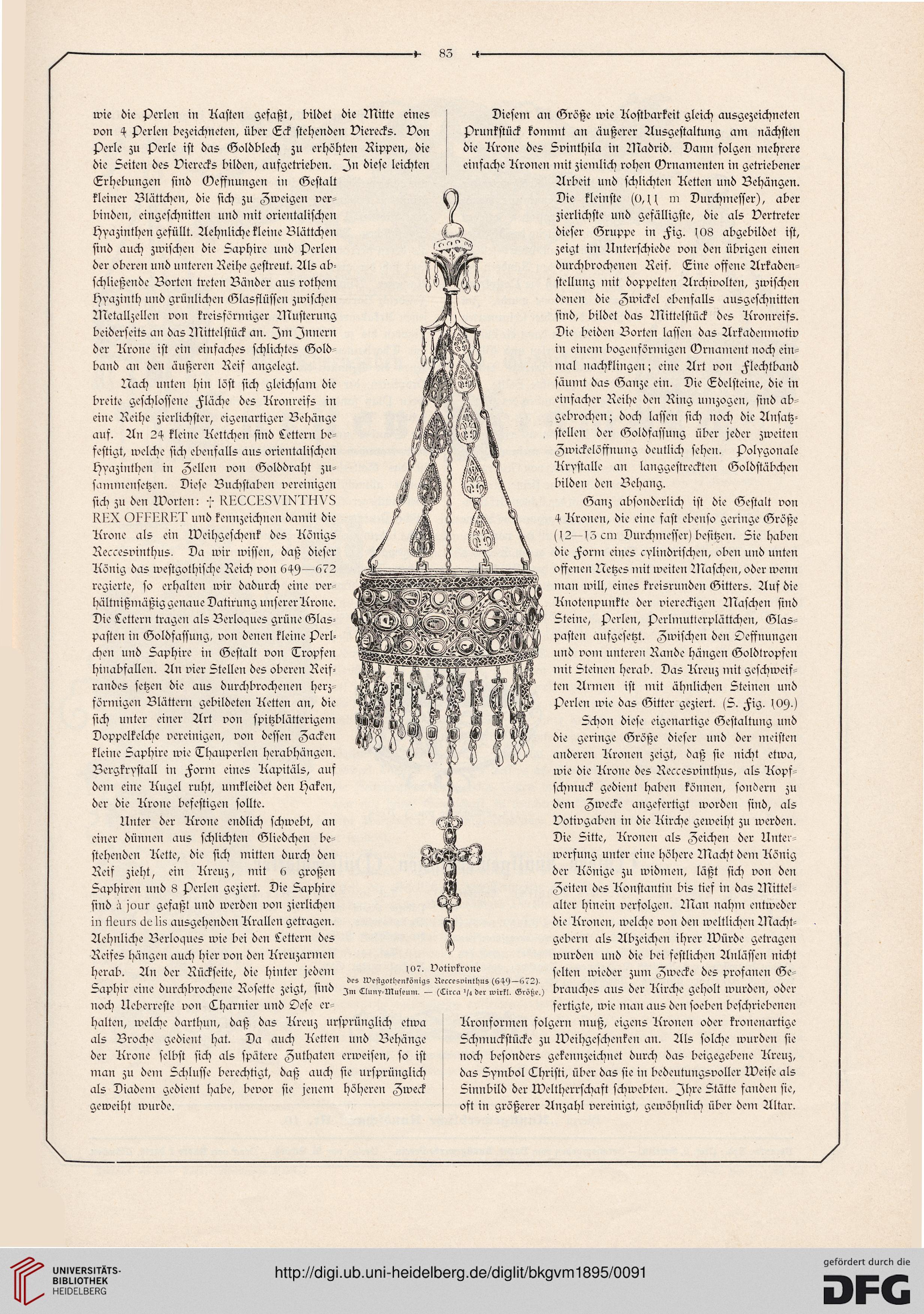wie die perlen in Aasten gefaßt, bildet die Mitte eines
von 4 perlen bezeichnten, über Eck stehenden Vierecks. Von
perle zu perle ist das Goldblech zu erhöhten Rippen, die
die Leiten des Vierecks bilden, aufgetrieben. In diese leichten
Erhebungen sind Oeffnungen in Gestalt
kleiner Blättchen, die sich zu Zweigen ver-
binden, eingeschnitten und mit orientalischen
Hyazinthen gefüllt. Aehnliche kleine Blättchen
sind auch zwischen die Saphire und Perlen
der oberen und unteren Reihe gestreut. Als ab-
schließende Borten treten Bänder aus rothem
Hyazinth und grünlichen Glasstüsten zwischen
Metallzellen von kreisföriniger Musterung
beiderseits an das Mittelstück an. Im Innern
der Arone ist ein einfaches schlichtes Gold-
band an den äußeren Reif angelegt.
Nach unten hin löst sich gleichsam die
breite geschlossene Fläche des Aronreifs in
eine Reihe zierlichster, eigenartiger Behänge
auf. An kleine Aeltchen sind Lettern be-
festigt, welche sich ebenfalls aus orientalischen
Hyazinthen in Zellen von Golddraht zu-
sammensetzen. Diese Buchstaben vereinigen
sich zu den Worten: y RECCESVINTHVS
REX OPFERET und kennzeichnen damit die
Arone als ein Weihgeschenk des Aönigs
Reccesvinthus. Da wir wissen, daß dieser
Aönig das westgothische Reich von 64«)—672
regierte, so erhalten wir dadurch eine ver-
hältnißmäßig genaue Datirung unserer Arone.
Die Lettern tragen als Berloques grüne Glas-
paften in Goldfastung, von denen kleine perl-
chen und Saphire in Gestalt von Tropfen
hinabfallen. An vier Stellen des oberen Reif-
randes setzen die aus durchbrochenen herz-
förmigen Blättern gebildeten Aetten an, die
sich unter einer Art von spitzblätterigem
Doppelkelche vereinigen, von dessen Zacken
kleine Saphire wie Thauperlen herabhängen.
Bergkrystall in Form eines Aapitäls, auf
dein eine Angel ruht, umkleidet den bjaken,
der die Arone befestigen sollte.
Unter der Arone endlich schwebt, an
einer dünnen aus schlichten Gliedchen be-
stehenden Aette, die sich mitten durch den
Reif zieht, ein Areuz, mit 6 großen
Saphiren und 8 perlen geziert. Die Saphire
sind ä jour gefaßt und werden von zierlichen
in lleurs de lis ausgehenden Arallen getragen.
Aehnliche Berloques wie bei den Lettern des
Reifes hängen auch hier von den Areuzarmen
herab. An der Rückseite, die hinter jedem
Saphir eine durchbrochene Rosette zeigt, sind
noch Ueberreste von Tharnier und Oese er-
halten, welche darthun, daß das Areuz ursprünglich etwa
als Broche gedient hat. Da auch Aetten und Behänge
der Arone selbst sich als spätere Zuthaten erweisen, so ist
man zu dem Schluffe berechtigt, daß auch sie ursprünglich
als Diadem gedient habe, bevor sie jenem höheren Zweck
geweiht wurde.
Diesem an Größe wie Aostbarkeit gleich ausgezeichneten
Prunkstück kommt an äußerer Ausgestaltung am nächsten
die Arone des Svinthila in Madrid. Dann folgen mehrere
einfache Aronen mit ziemlich rohen Ornamenten in getriebener
Arbeit und schlichten Aetten und Behängen.
Die kleinste (0,ss m Durchmesser), aber
zierlichste und gefälligste, die als Vertreter
dieser Gruppe in Fig. \ 08 abgebildet ist,
zeigt mi Unterschiede von den übrigen einen
durchbrochenen Reif. Eine offene Arkaden-
stellung mit doppelten Archivolten, zwischen
denen die Zwickel ebenfalls ausgeschnitten
sind, bildet das Mittelstück des Aronreifs.
Die beiden Borten lasten das Arkadenmotiv
in einem bogenförmigen Ornament noch ein-
mal nachklingen; eine Art von Flechtband
säumt das Ganze ein. Die Edelsteine, die in
einfacher Reihe den Ring umzogen, sind ab-
gebrochen; doch lassen sich noch die Ansatz-
stellen der Goldfassung über jeder zweiten
Zwickelöffnung deutlich sehen. Polygonale
Arystalle an langgestreckten Goldstäbchen
bilden den Behang.
Ganz absonderlich ist die Gestalt von
«f Aronen, die eine fast ebenso geringe Größe
(f2—föcm Durchmesser) besitzen. Sie haben
die Form eines cylindrischen, oben und unten
offenen Netzes mit weiten Maschen, oder wenn
man will, eines kreisrunden Gitters. Auf die
Anotenpunkte der viereckigen Maschen sind
Steine, perlen, Perlmutterplättchen, Glas-
pasten aufgesetzt. Zwischen den Oeffnungen
und vom unteren Rande hängen Goldtropfen
mit Steinen herab. Das Areuz mit geschweif-
ten Armen ist mit ähnlichen Steinen und
perlen wie das Gitter geziert. (S. Fig. fOst.)
Schon diese eigenartige Gestaltung und
die geringe Größe dieser und der meisten
anderen Aronen zeigt, daß sie nicht etwa,
wie die Arone des Reccesvinthus, als Aopf-
schmuck gedient haben können, sondern zu
dem Zwecke angefertigt worden sind, als
Votivgaben in die Airche geweiht zu werden.
Die Sitte, Aronen als Zeichen der Unter-
werfung unter eine höhere Macht dem Aönig
der Aönige zu widmen, läßt sich von den
Zeiten des Aonstantin bis tief in das Mittel -
alter hinein verfolgen. Man nahm entweder
die Aronen, welche von den weltlichen Macht-
gebern als Abzeichen ihrer Würde getragen
wurden und die bei festlichen Anlässen nicht
selten wieder zum Zwecke des profanen Ge-
brauches aus der Airche geholt wurden, oder
fertigte, wie man aus den soeben beschriebenen
Aronformen folgern muß, eigens Aronen oder kronenartige
Schmuckstücke zu Weihgeschenken an. Als solche wurden sie
noch besonders gekennzeichnet durch das beigegebene Areuz,
das Symbol Ehristi, über das sie in bedeutungsvoller Weise als
Sinnbild der Weltherrschaft schwebten. Ihre Stätte fanden sie,
oft in größerer Anzahl vereinigt, gewöhnlich über dein Altar.
;07. Votivkrone
des Westgothenkönigs Reccesvinthus (6^9—672).
3nt Cluny-Mufeum. — (Circa */4 der wirk!. Größe.)
von 4 perlen bezeichnten, über Eck stehenden Vierecks. Von
perle zu perle ist das Goldblech zu erhöhten Rippen, die
die Leiten des Vierecks bilden, aufgetrieben. In diese leichten
Erhebungen sind Oeffnungen in Gestalt
kleiner Blättchen, die sich zu Zweigen ver-
binden, eingeschnitten und mit orientalischen
Hyazinthen gefüllt. Aehnliche kleine Blättchen
sind auch zwischen die Saphire und Perlen
der oberen und unteren Reihe gestreut. Als ab-
schließende Borten treten Bänder aus rothem
Hyazinth und grünlichen Glasstüsten zwischen
Metallzellen von kreisföriniger Musterung
beiderseits an das Mittelstück an. Im Innern
der Arone ist ein einfaches schlichtes Gold-
band an den äußeren Reif angelegt.
Nach unten hin löst sich gleichsam die
breite geschlossene Fläche des Aronreifs in
eine Reihe zierlichster, eigenartiger Behänge
auf. An kleine Aeltchen sind Lettern be-
festigt, welche sich ebenfalls aus orientalischen
Hyazinthen in Zellen von Golddraht zu-
sammensetzen. Diese Buchstaben vereinigen
sich zu den Worten: y RECCESVINTHVS
REX OPFERET und kennzeichnen damit die
Arone als ein Weihgeschenk des Aönigs
Reccesvinthus. Da wir wissen, daß dieser
Aönig das westgothische Reich von 64«)—672
regierte, so erhalten wir dadurch eine ver-
hältnißmäßig genaue Datirung unserer Arone.
Die Lettern tragen als Berloques grüne Glas-
paften in Goldfastung, von denen kleine perl-
chen und Saphire in Gestalt von Tropfen
hinabfallen. An vier Stellen des oberen Reif-
randes setzen die aus durchbrochenen herz-
förmigen Blättern gebildeten Aetten an, die
sich unter einer Art von spitzblätterigem
Doppelkelche vereinigen, von dessen Zacken
kleine Saphire wie Thauperlen herabhängen.
Bergkrystall in Form eines Aapitäls, auf
dein eine Angel ruht, umkleidet den bjaken,
der die Arone befestigen sollte.
Unter der Arone endlich schwebt, an
einer dünnen aus schlichten Gliedchen be-
stehenden Aette, die sich mitten durch den
Reif zieht, ein Areuz, mit 6 großen
Saphiren und 8 perlen geziert. Die Saphire
sind ä jour gefaßt und werden von zierlichen
in lleurs de lis ausgehenden Arallen getragen.
Aehnliche Berloques wie bei den Lettern des
Reifes hängen auch hier von den Areuzarmen
herab. An der Rückseite, die hinter jedem
Saphir eine durchbrochene Rosette zeigt, sind
noch Ueberreste von Tharnier und Oese er-
halten, welche darthun, daß das Areuz ursprünglich etwa
als Broche gedient hat. Da auch Aetten und Behänge
der Arone selbst sich als spätere Zuthaten erweisen, so ist
man zu dem Schluffe berechtigt, daß auch sie ursprünglich
als Diadem gedient habe, bevor sie jenem höheren Zweck
geweiht wurde.
Diesem an Größe wie Aostbarkeit gleich ausgezeichneten
Prunkstück kommt an äußerer Ausgestaltung am nächsten
die Arone des Svinthila in Madrid. Dann folgen mehrere
einfache Aronen mit ziemlich rohen Ornamenten in getriebener
Arbeit und schlichten Aetten und Behängen.
Die kleinste (0,ss m Durchmesser), aber
zierlichste und gefälligste, die als Vertreter
dieser Gruppe in Fig. \ 08 abgebildet ist,
zeigt mi Unterschiede von den übrigen einen
durchbrochenen Reif. Eine offene Arkaden-
stellung mit doppelten Archivolten, zwischen
denen die Zwickel ebenfalls ausgeschnitten
sind, bildet das Mittelstück des Aronreifs.
Die beiden Borten lasten das Arkadenmotiv
in einem bogenförmigen Ornament noch ein-
mal nachklingen; eine Art von Flechtband
säumt das Ganze ein. Die Edelsteine, die in
einfacher Reihe den Ring umzogen, sind ab-
gebrochen; doch lassen sich noch die Ansatz-
stellen der Goldfassung über jeder zweiten
Zwickelöffnung deutlich sehen. Polygonale
Arystalle an langgestreckten Goldstäbchen
bilden den Behang.
Ganz absonderlich ist die Gestalt von
«f Aronen, die eine fast ebenso geringe Größe
(f2—föcm Durchmesser) besitzen. Sie haben
die Form eines cylindrischen, oben und unten
offenen Netzes mit weiten Maschen, oder wenn
man will, eines kreisrunden Gitters. Auf die
Anotenpunkte der viereckigen Maschen sind
Steine, perlen, Perlmutterplättchen, Glas-
pasten aufgesetzt. Zwischen den Oeffnungen
und vom unteren Rande hängen Goldtropfen
mit Steinen herab. Das Areuz mit geschweif-
ten Armen ist mit ähnlichen Steinen und
perlen wie das Gitter geziert. (S. Fig. fOst.)
Schon diese eigenartige Gestaltung und
die geringe Größe dieser und der meisten
anderen Aronen zeigt, daß sie nicht etwa,
wie die Arone des Reccesvinthus, als Aopf-
schmuck gedient haben können, sondern zu
dem Zwecke angefertigt worden sind, als
Votivgaben in die Airche geweiht zu werden.
Die Sitte, Aronen als Zeichen der Unter-
werfung unter eine höhere Macht dem Aönig
der Aönige zu widmen, läßt sich von den
Zeiten des Aonstantin bis tief in das Mittel -
alter hinein verfolgen. Man nahm entweder
die Aronen, welche von den weltlichen Macht-
gebern als Abzeichen ihrer Würde getragen
wurden und die bei festlichen Anlässen nicht
selten wieder zum Zwecke des profanen Ge-
brauches aus der Airche geholt wurden, oder
fertigte, wie man aus den soeben beschriebenen
Aronformen folgern muß, eigens Aronen oder kronenartige
Schmuckstücke zu Weihgeschenken an. Als solche wurden sie
noch besonders gekennzeichnet durch das beigegebene Areuz,
das Symbol Ehristi, über das sie in bedeutungsvoller Weise als
Sinnbild der Weltherrschaft schwebten. Ihre Stätte fanden sie,
oft in größerer Anzahl vereinigt, gewöhnlich über dein Altar.
;07. Votivkrone
des Westgothenkönigs Reccesvinthus (6^9—672).
3nt Cluny-Mufeum. — (Circa */4 der wirk!. Größe.)