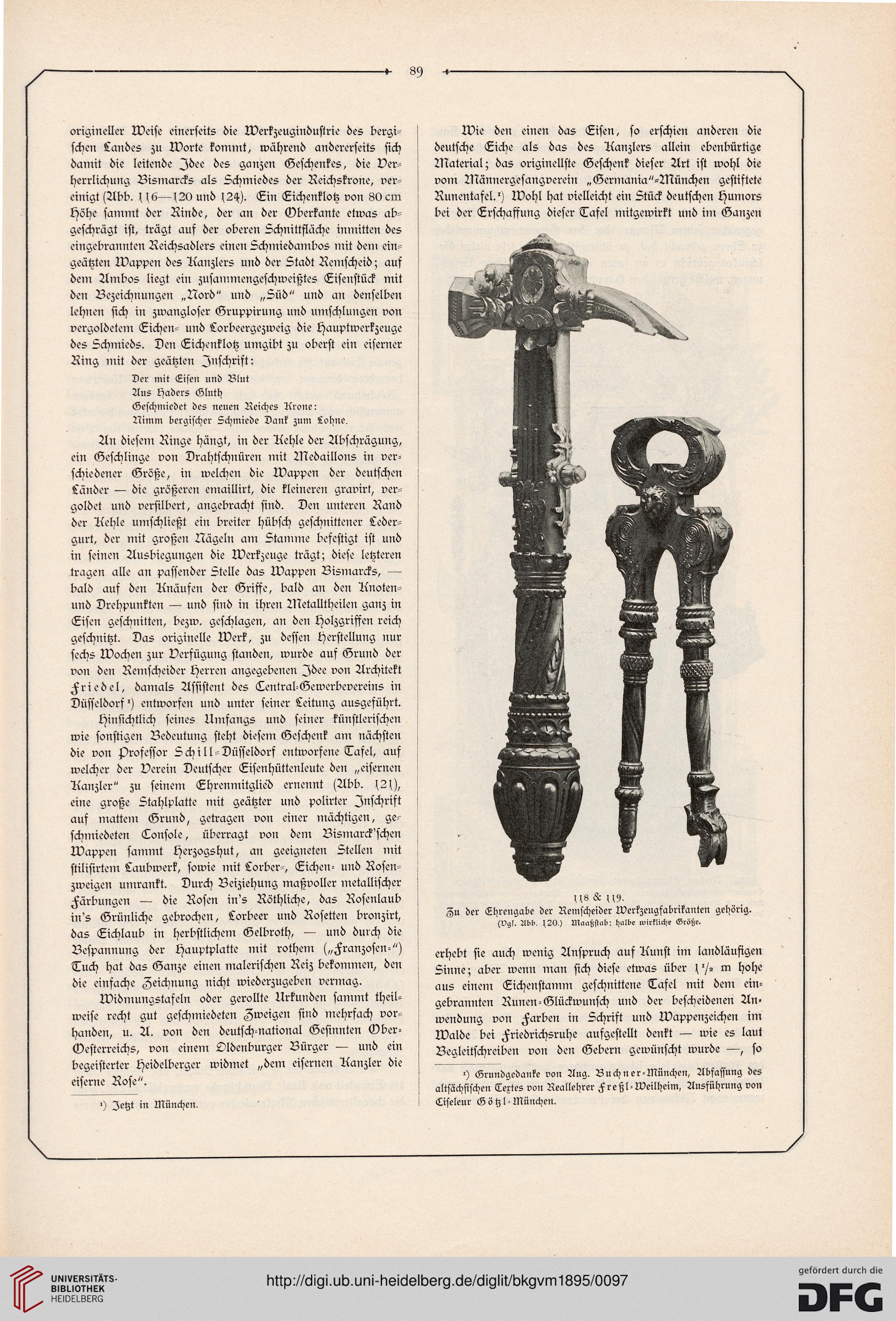X
■4- 89 -*■
origineller Weise einerseits die Werkzeugindustrie des bergi-
fchen Landes zu Worte kommt, während andererseits sich
damit die leitende Idee des ganzen Geschenkes, die Ver-
herrlichung Bismarcks als Schmiedes der Reichskrone, ver-
einigt (Abb. \\<ä—l20 und f2h. Gin Eichenklotz von 80 cm
höhe sannnt der Rinde, der an der Oberkante etwas ab-
geschrägt ist, trägt auf der oberen Schnittfläche inmitten des
eingebrannten Reichsadlers einen Schmiedambos mit dem ein-
geätzten Wappen des Kanzlers und der Stadt Remscheid; auf
dem Ambos liegt ein zusammengeschweißtes Eisenstück mit
den Bezeichnungen „Nord" und „Süd" und an denselben
lehnen sich in zwangloser Gruppirung und umschlungen von
vergoldetem Eichen- und Lorbeergezweig die hauptwerkzeuge
des Schmieds. Den Eichenklotz umgibt zu oberst ein eiserner
Ring mit der geätzten Inschrift:
Der mit Eisen und Blut
Aus Kaders Gluth
Geschmiedet des neuen Reiches Aronc:
Nimm bergischer Schmiede Dank zum Lohne.
An diesem Ringe hängt, in der Kehle der Abschrägung,
ein Geschlinge von Drahtschnüren ntit Medaillons in ver-
schiedener Größe, in welchen die Wappen der deutschen
Länder — die größeren emaillirt, die kleineren gravirt, ver-
goldet und versilbert, angebracht sind. Den unteren Rand
der Kehle umschließt ein breiter hübsch geschnittener Leder-
gurt, der mit großen Nägeln am Stannne befestigt ist und
in seinen Ausbiegungen die Werkzeuge trägt; diese letzteren
tragen alle an passender Stelle das Wappen Bismarcks, —
bald auf den Knäufen der Griffe, bald an den Knoten-
und Drehpunkten — und sind in ihren Metalltheilen ganz in
Eisen geschnitten, bezw. geschlagen, an den lsolzgriffen reich
geschnitzt. Das originelle Werk, zu dessen Herstellung nur
sechs Wochen zur Verfügung standen, wurde auf Grund der
von den Remscheider Herren angegebenen Idee von Architekt
Friede!, damals Assistent des Eentral-Gewerbevereins in
Düsseldorf') entworfen und unter seiner Leitung ausgeführt.
hinsichtlich seines Uinfangs und seiner künstlerischen
wie sonstigen Bedeutung steht diesem Geschenk am nächsten
die von Professor Schill- Düsseldorf entworfene Tafel, auf
welcher der Verein Deutscher Eisenhüttenleute den „eisernen
Kanzler" zu seinem Ehrenmitglied ernennt (Abb. s2s),
eine große Stahlplatte mit geätzter und polirter Inschrift
auf mattem Grund, getragen von einer mächtigen, ge-
schmiedeten Eonsole, überragt von dem Bismarck'schen
Wappen sammt Herzogshut, an geeigneten Stellen mit
stilisirtem Laubwerk, sowie mit Lorber-, Eichen- und Rosen-
zweigen umrankt. Durch Beiziehung maßvoller metallischer
Färbungen — die Rosen in's Röthliche, das Rosenlaub
in's Grünliche gebrochen, Lorbeer und Rosetten bronzirt,
das Eichlaub in herbstlichem Gelbroth, — und durch die
Bespannung der hauptplatte mit rothem („Franzosen-")
Tuch hat das Ganze einen malerischen Reiz bekommen, den
die einfache Zeichnung nicht wiederzugeben vermag.
widmungstafeln oder gerollte Urkunden sammt theil-
weise recht gut geschmiedeten Zweigen sind mehrfach vor-
handen, u. A. von den deutsch-national Gesinnten Gber-
Oesterreichs, von einen, Oldenburger Bürger — und ein
begeisterter Heidelberger widmet „dem eisernen Kanzler die
eiserne Rose".
') Jetzt in München.
Wie den einen das Eisen, so erschien anderen die
deutsche Eiche als das des Kanzlers allein ebenbürtige
Material; das originellste Geschenk dieser Art ist wohl die
von, Männergesangverein „Germania"-München gestiftete
Runentafel.') Wohl hat vielleicht ein Stück deutschen hmnors
bei der Erschaffung dieser Tafel ,nitgewirkt und im Ganzen
U« 6c US.
Zu der Ehrengabe der Remscheider lverkzeugfabrikanten gehörig.
(vgl. Abb. 1(20.) Maaßstab: halbe wirkliche Größe.
erhebt sie auch wenig Anspruch auf Kunst im landläufigen
Sinne; aber wenn man sich diese etwas über f'/- m hohe
aus einem Eichenstamm geschnittene Tafel mit dem ein-
gebrannten Runen-Glückwunsch und der bescheidenen An-
wendung von Farben in Schrift und Wappenzeichen im
Walde bei Friedrichsruhe aufgestellt denkt — wie es laut
Begleitschreiben von den Gebern gewünscht wurde —, so
>) Grundgedanke von Aug. Büchner-München, Abfassung des
altsächsischen Textes von Reallehrer Freßl-lVeilheim, Ausführung von
Eiseleur Götzl-München.
■4- 89 -*■
origineller Weise einerseits die Werkzeugindustrie des bergi-
fchen Landes zu Worte kommt, während andererseits sich
damit die leitende Idee des ganzen Geschenkes, die Ver-
herrlichung Bismarcks als Schmiedes der Reichskrone, ver-
einigt (Abb. \\<ä—l20 und f2h. Gin Eichenklotz von 80 cm
höhe sannnt der Rinde, der an der Oberkante etwas ab-
geschrägt ist, trägt auf der oberen Schnittfläche inmitten des
eingebrannten Reichsadlers einen Schmiedambos mit dem ein-
geätzten Wappen des Kanzlers und der Stadt Remscheid; auf
dem Ambos liegt ein zusammengeschweißtes Eisenstück mit
den Bezeichnungen „Nord" und „Süd" und an denselben
lehnen sich in zwangloser Gruppirung und umschlungen von
vergoldetem Eichen- und Lorbeergezweig die hauptwerkzeuge
des Schmieds. Den Eichenklotz umgibt zu oberst ein eiserner
Ring mit der geätzten Inschrift:
Der mit Eisen und Blut
Aus Kaders Gluth
Geschmiedet des neuen Reiches Aronc:
Nimm bergischer Schmiede Dank zum Lohne.
An diesem Ringe hängt, in der Kehle der Abschrägung,
ein Geschlinge von Drahtschnüren ntit Medaillons in ver-
schiedener Größe, in welchen die Wappen der deutschen
Länder — die größeren emaillirt, die kleineren gravirt, ver-
goldet und versilbert, angebracht sind. Den unteren Rand
der Kehle umschließt ein breiter hübsch geschnittener Leder-
gurt, der mit großen Nägeln am Stannne befestigt ist und
in seinen Ausbiegungen die Werkzeuge trägt; diese letzteren
tragen alle an passender Stelle das Wappen Bismarcks, —
bald auf den Knäufen der Griffe, bald an den Knoten-
und Drehpunkten — und sind in ihren Metalltheilen ganz in
Eisen geschnitten, bezw. geschlagen, an den lsolzgriffen reich
geschnitzt. Das originelle Werk, zu dessen Herstellung nur
sechs Wochen zur Verfügung standen, wurde auf Grund der
von den Remscheider Herren angegebenen Idee von Architekt
Friede!, damals Assistent des Eentral-Gewerbevereins in
Düsseldorf') entworfen und unter seiner Leitung ausgeführt.
hinsichtlich seines Uinfangs und seiner künstlerischen
wie sonstigen Bedeutung steht diesem Geschenk am nächsten
die von Professor Schill- Düsseldorf entworfene Tafel, auf
welcher der Verein Deutscher Eisenhüttenleute den „eisernen
Kanzler" zu seinem Ehrenmitglied ernennt (Abb. s2s),
eine große Stahlplatte mit geätzter und polirter Inschrift
auf mattem Grund, getragen von einer mächtigen, ge-
schmiedeten Eonsole, überragt von dem Bismarck'schen
Wappen sammt Herzogshut, an geeigneten Stellen mit
stilisirtem Laubwerk, sowie mit Lorber-, Eichen- und Rosen-
zweigen umrankt. Durch Beiziehung maßvoller metallischer
Färbungen — die Rosen in's Röthliche, das Rosenlaub
in's Grünliche gebrochen, Lorbeer und Rosetten bronzirt,
das Eichlaub in herbstlichem Gelbroth, — und durch die
Bespannung der hauptplatte mit rothem („Franzosen-")
Tuch hat das Ganze einen malerischen Reiz bekommen, den
die einfache Zeichnung nicht wiederzugeben vermag.
widmungstafeln oder gerollte Urkunden sammt theil-
weise recht gut geschmiedeten Zweigen sind mehrfach vor-
handen, u. A. von den deutsch-national Gesinnten Gber-
Oesterreichs, von einen, Oldenburger Bürger — und ein
begeisterter Heidelberger widmet „dem eisernen Kanzler die
eiserne Rose".
') Jetzt in München.
Wie den einen das Eisen, so erschien anderen die
deutsche Eiche als das des Kanzlers allein ebenbürtige
Material; das originellste Geschenk dieser Art ist wohl die
von, Männergesangverein „Germania"-München gestiftete
Runentafel.') Wohl hat vielleicht ein Stück deutschen hmnors
bei der Erschaffung dieser Tafel ,nitgewirkt und im Ganzen
U« 6c US.
Zu der Ehrengabe der Remscheider lverkzeugfabrikanten gehörig.
(vgl. Abb. 1(20.) Maaßstab: halbe wirkliche Größe.
erhebt sie auch wenig Anspruch auf Kunst im landläufigen
Sinne; aber wenn man sich diese etwas über f'/- m hohe
aus einem Eichenstamm geschnittene Tafel mit dem ein-
gebrannten Runen-Glückwunsch und der bescheidenen An-
wendung von Farben in Schrift und Wappenzeichen im
Walde bei Friedrichsruhe aufgestellt denkt — wie es laut
Begleitschreiben von den Gebern gewünscht wurde —, so
>) Grundgedanke von Aug. Büchner-München, Abfassung des
altsächsischen Textes von Reallehrer Freßl-lVeilheim, Ausführung von
Eiseleur Götzl-München.