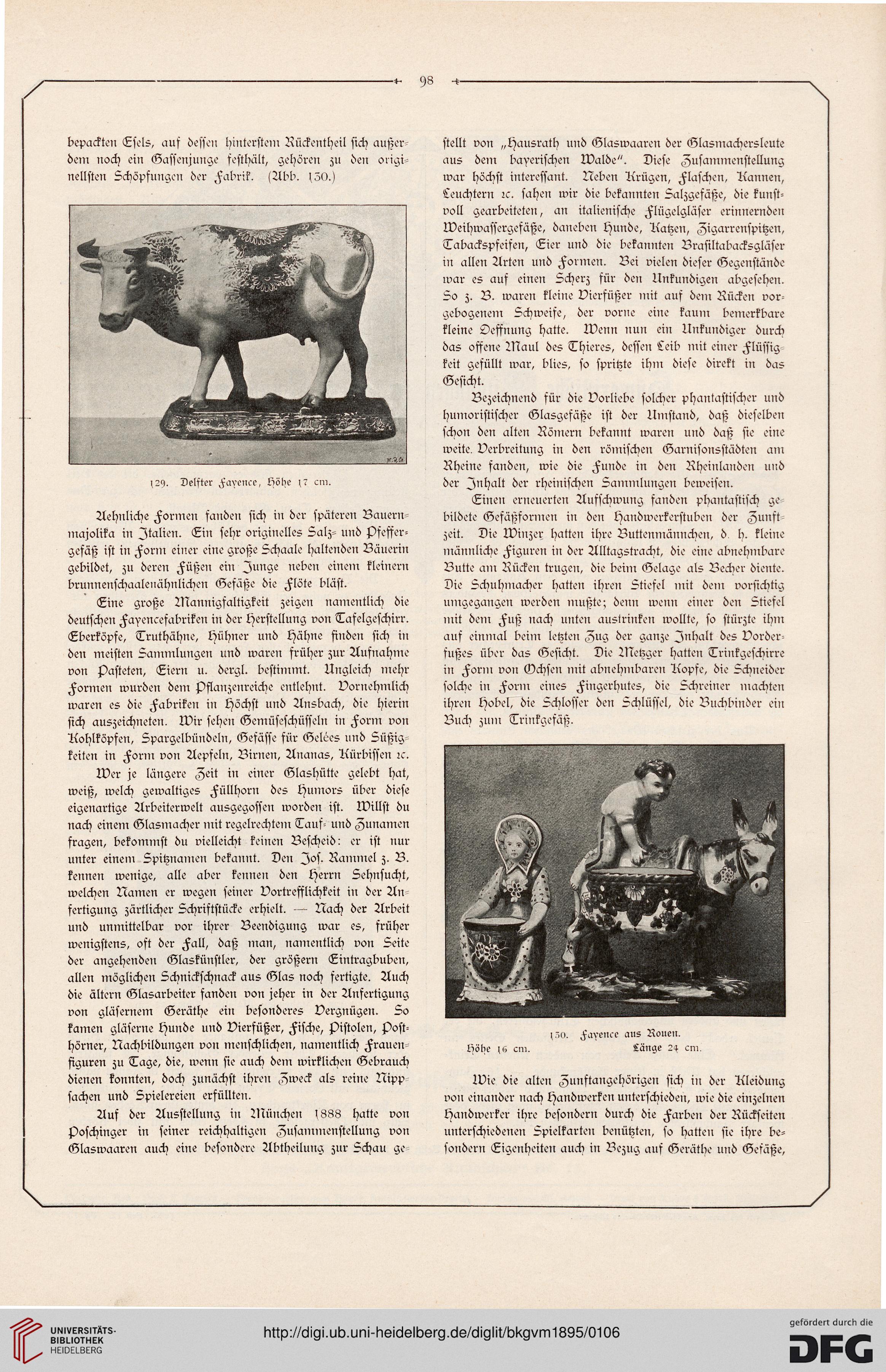bepackten Esels, auf dessen hinterstem Rückentheil sich außer-
dem noch ein Gassenjunge sesthält, gehören zu den origi-
nellsten Schöpfungen der Fabrik. jAbb. l50.)
\2y. Delfter Fayence, Höhe ^7 cm,
Aehnliche formen fanden sich in der späteren Bauern-
majolika in Italien. Ein sehr originelles Salz- und Pfeffer-
gefäß ist in Form einer eine große Schaale haltenden Bäuerin
gebildet, zu deren Füßen ein Junge neben einem kleinern
brunnenschaalenähnlichen Gefäße die Flöte bläst.
Eine große Mannigfaltigkeit zeigen namentlich die
deutscheit Fayencefabriken iit der Perstellung von Tafelgeschirr.
Eberköpfe, Truthähne, pühner uitd pähne finden sich in
deit meisten Sammlungen und waren früher zur Aufnahme
von Pasteten, Eiern u. dergl. bestimmt. Ungleich mehr
Formen wurden dem Pflanzenreiche entlehnt. Vornehmlich
waren es die Fabriken in Pochst und Ansbach, die hierin
sich auszeichneten, wir sehen Gemüseschüsseln in Form von
Uohlköpfen, Spargelbündeln, Gesässe für Geldes und Süßig
ketten in Fornt von Aepfeln, Birnen, Ananas, Kürbissen rc.
Wer je längere Zeit in einer Glashütte gelebt hat,
weiß, welch gewaltiges Füllhorn des puinors über diese
eigenartige Arbeiterwelt ausgegossen worden ist. Willst du
nach einem Glasmacher mit regelrechtem Tauf- und Zunamen
fragen, bekommst du vielleicht keinen Bescheid: er ist nur
unter einein Spitznamen bekannt. Den Jos. Rammel z. B.
kennen wenige, alle aber kennen den perrn Sehnsucht,
welchen Namen er wegen seiner Vortrefflichkeit in der An
fertigung zärtlicher Schriftstücke erhielt. — Nach der Arbeit
und unmittelbar vor ihrer Beendigung war es, früher
wenigstens, oft der Fall, daß man, namentlich von Seite
der angehenden Glaskünstler, der größern Eintragbuben,
allen möglichen Schnickschnack aus Glas noch fertigte. Auch
die ältern Glasarbeiter fanden von jeher in der Anfertigung
von gläsernem Geräthe ein besonderes Vergnügen. So
kamen gläserne punde und Vierfüßer, Fische, Pistolen, Post-
hörner, Nachbildungen von inenschlichen, namentlich Frauen-
figuren zu Tage, die, wenn sie auch dem wirklichen Gebrauch
dienen konnten, doch zunächst ihren Zweck als reine Nipp
fachen und Spielereien erfüllten.
Auf der Ausstellung in München f888 hatte von
pofchinger in seiner reichhaltigen Zusammenstellung von
Glaswaaren auch eine besondere Abtheilung zur Schau ge
stellt von „Pausrath und Glaswaaren der Glasmachersleute
aus dein bayerischen Walde". Diese Zusammenstellung
war höchst interessant. Neben Krügen, Flaschen, Kannen,
Leuchtern rc. sahen wir die bekannten Salzgefäße, die kunst-
voll gearbeiteten, an italieiiische Flügelgläser erinnerndeii
Weihwassergefäße, daneben punde, Katzen, Zigarrenspitzen,
Tabackspfeifen, Eier und die bekannten Brasiltabacksgläfer
in allen Arten und Formen. Bei vielen dieser Gegenstände
war es auf einen Scherz für deii Unkundigen abgesehen.
So z. B. waren kleine Vierfüßer „iit auf dem Rücken vor-
gebogenem Schweife, der vorne eine kaunr bemerkbare
kleine Deffnung hatte. Wenn nun ein Unkundiger durch
das offene Maul des Thieres, dessen Leib mit einer Flüssig
Feit gefüllt war, blies, so spritzte ihni diese direkt iu das
Gesicht.
Bezeichnend für die Vorliebe solcher phantastischer und
humoristischer Glasgefäße ist der Umstand, daß dieselben
schon den alten Römern bekannt waren und daß sie eine
weite. Verbreitung in den römischen Garnisonsstädten an:
Rheine fanden, wie die Funde in den Rheinlanden und
der Inhalt der rheinischen Sammlungen beweisen.
Einen erneuerten Aufschwung fanden phantastisch ge
bildete Gefäßformen in den pandwerkerstuben der Zunft
zeit. Die Winzer hatten ihre Buttenmännchen, d h. kleine
männliche Figuren in der Alltagstracht, die eine abnehmbare
Butte am Rücken trugen, die dein: Gelage als Becher diente.
Die Schuhmacher hatten ihren Stiefel mit deni vorsichtig
umgegangen werden mußte; denn wenn einer den Stiefel
mit dem Fuß nach unten austrinken wollte, so stürzte ihn:
auf einmal beim letzten Zug der ganze Inhalt des Vorder-
fußes über das Gesicht. Die Metzger hatten Trinkgeschirre
in Form von Ochsen mit abnehmbaren Kopfe, die Schneider
solche in Form eines Fingerhutes, die Schreiner machten
ihren Pöbel, die Schlosser den Schlüssel, die Buchbinder ein
Buch zum Trinkgefäß.
„io. Fayence aus Rouen.
Höbe ;s cm. Länge cm.
Wie die alten Zunftangehörigen sich in der Kleidung
von einander nach pandwerken unterschieden, wie die einzelnen
pandwerker ihre besondern durch die Farben der Rückseiten
unterschiedenen Spielkarten benützten, so hatten sie ihre be-
sondern Eigenheiten auch in Bezug auf Geräthe und Gefäße,
dem noch ein Gassenjunge sesthält, gehören zu den origi-
nellsten Schöpfungen der Fabrik. jAbb. l50.)
\2y. Delfter Fayence, Höhe ^7 cm,
Aehnliche formen fanden sich in der späteren Bauern-
majolika in Italien. Ein sehr originelles Salz- und Pfeffer-
gefäß ist in Form einer eine große Schaale haltenden Bäuerin
gebildet, zu deren Füßen ein Junge neben einem kleinern
brunnenschaalenähnlichen Gefäße die Flöte bläst.
Eine große Mannigfaltigkeit zeigen namentlich die
deutscheit Fayencefabriken iit der Perstellung von Tafelgeschirr.
Eberköpfe, Truthähne, pühner uitd pähne finden sich in
deit meisten Sammlungen und waren früher zur Aufnahme
von Pasteten, Eiern u. dergl. bestimmt. Ungleich mehr
Formen wurden dem Pflanzenreiche entlehnt. Vornehmlich
waren es die Fabriken in Pochst und Ansbach, die hierin
sich auszeichneten, wir sehen Gemüseschüsseln in Form von
Uohlköpfen, Spargelbündeln, Gesässe für Geldes und Süßig
ketten in Fornt von Aepfeln, Birnen, Ananas, Kürbissen rc.
Wer je längere Zeit in einer Glashütte gelebt hat,
weiß, welch gewaltiges Füllhorn des puinors über diese
eigenartige Arbeiterwelt ausgegossen worden ist. Willst du
nach einem Glasmacher mit regelrechtem Tauf- und Zunamen
fragen, bekommst du vielleicht keinen Bescheid: er ist nur
unter einein Spitznamen bekannt. Den Jos. Rammel z. B.
kennen wenige, alle aber kennen den perrn Sehnsucht,
welchen Namen er wegen seiner Vortrefflichkeit in der An
fertigung zärtlicher Schriftstücke erhielt. — Nach der Arbeit
und unmittelbar vor ihrer Beendigung war es, früher
wenigstens, oft der Fall, daß man, namentlich von Seite
der angehenden Glaskünstler, der größern Eintragbuben,
allen möglichen Schnickschnack aus Glas noch fertigte. Auch
die ältern Glasarbeiter fanden von jeher in der Anfertigung
von gläsernem Geräthe ein besonderes Vergnügen. So
kamen gläserne punde und Vierfüßer, Fische, Pistolen, Post-
hörner, Nachbildungen von inenschlichen, namentlich Frauen-
figuren zu Tage, die, wenn sie auch dem wirklichen Gebrauch
dienen konnten, doch zunächst ihren Zweck als reine Nipp
fachen und Spielereien erfüllten.
Auf der Ausstellung in München f888 hatte von
pofchinger in seiner reichhaltigen Zusammenstellung von
Glaswaaren auch eine besondere Abtheilung zur Schau ge
stellt von „Pausrath und Glaswaaren der Glasmachersleute
aus dein bayerischen Walde". Diese Zusammenstellung
war höchst interessant. Neben Krügen, Flaschen, Kannen,
Leuchtern rc. sahen wir die bekannten Salzgefäße, die kunst-
voll gearbeiteten, an italieiiische Flügelgläser erinnerndeii
Weihwassergefäße, daneben punde, Katzen, Zigarrenspitzen,
Tabackspfeifen, Eier und die bekannten Brasiltabacksgläfer
in allen Arten und Formen. Bei vielen dieser Gegenstände
war es auf einen Scherz für deii Unkundigen abgesehen.
So z. B. waren kleine Vierfüßer „iit auf dem Rücken vor-
gebogenem Schweife, der vorne eine kaunr bemerkbare
kleine Deffnung hatte. Wenn nun ein Unkundiger durch
das offene Maul des Thieres, dessen Leib mit einer Flüssig
Feit gefüllt war, blies, so spritzte ihni diese direkt iu das
Gesicht.
Bezeichnend für die Vorliebe solcher phantastischer und
humoristischer Glasgefäße ist der Umstand, daß dieselben
schon den alten Römern bekannt waren und daß sie eine
weite. Verbreitung in den römischen Garnisonsstädten an:
Rheine fanden, wie die Funde in den Rheinlanden und
der Inhalt der rheinischen Sammlungen beweisen.
Einen erneuerten Aufschwung fanden phantastisch ge
bildete Gefäßformen in den pandwerkerstuben der Zunft
zeit. Die Winzer hatten ihre Buttenmännchen, d h. kleine
männliche Figuren in der Alltagstracht, die eine abnehmbare
Butte am Rücken trugen, die dein: Gelage als Becher diente.
Die Schuhmacher hatten ihren Stiefel mit deni vorsichtig
umgegangen werden mußte; denn wenn einer den Stiefel
mit dem Fuß nach unten austrinken wollte, so stürzte ihn:
auf einmal beim letzten Zug der ganze Inhalt des Vorder-
fußes über das Gesicht. Die Metzger hatten Trinkgeschirre
in Form von Ochsen mit abnehmbaren Kopfe, die Schneider
solche in Form eines Fingerhutes, die Schreiner machten
ihren Pöbel, die Schlosser den Schlüssel, die Buchbinder ein
Buch zum Trinkgefäß.
„io. Fayence aus Rouen.
Höbe ;s cm. Länge cm.
Wie die alten Zunftangehörigen sich in der Kleidung
von einander nach pandwerken unterschieden, wie die einzelnen
pandwerker ihre besondern durch die Farben der Rückseiten
unterschiedenen Spielkarten benützten, so hatten sie ihre be-
sondern Eigenheiten auch in Bezug auf Geräthe und Gefäße,