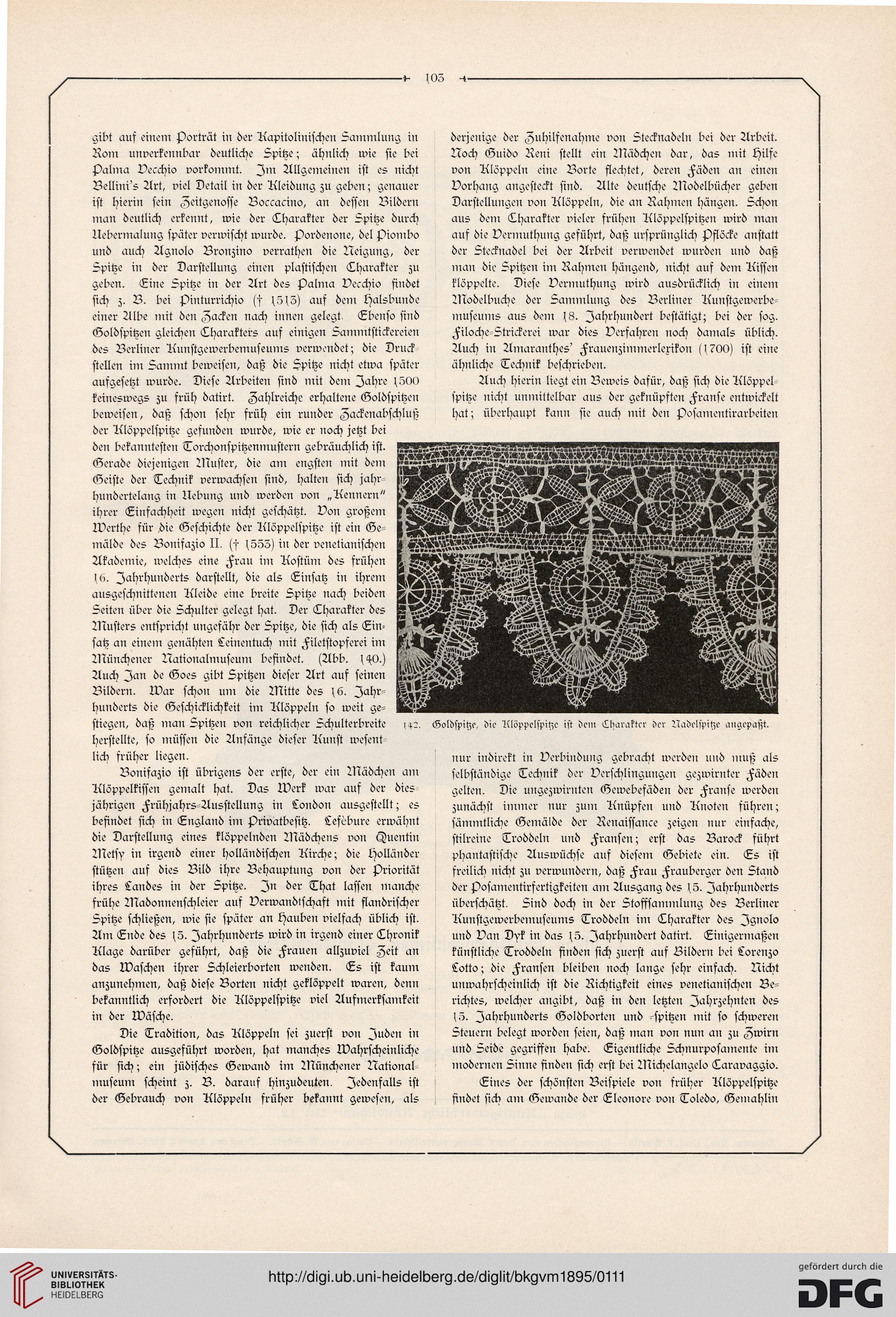gibt auf einem Porträt in der Rapitolinischen Sammlung in
Rom unverkennbar deutliche Spitze; ähnlich wie sie bei
Palma Vecchio vorkommt. jm Allgemeinen ist es nicht
Bellini's Art, viel Detail in der Rleidung zu geben; genauer
ist hierin fein Zeitgenosse Boccacino, an dessen Bildern
man deutlich erkennt, wie der Tharakter der Spitze durch
Uebermalung später verwischt wurde, pordenone, del piombo
und auch Agnolo Bronzino verrathen die Neigung, der
Spitze in der Darstellung einen plastischen Tharakter zu
geben. Line Spitze in der Art des Palma Vecchio findet
sich z. B. bei Pinturrichio ff 15^5) aus dem Halsbunde
einer Albe mit den Zacken nach innen gelegt. Ebenso sind
Goldspitzen gleichen Tharakters auf einigen Sammtstickereien
des Berliner Runstgewerbemuseums verwendet; die Druck
stellen im Sammt beweisen, daß die Spitze nicht etwa später
aufgesetzt wurde. Diese Arbeiten sind mit dem Zahre \500
keineswegs zu früh datirt. Zahlreiche erhaltene Goldspitzen
beweisen, daß schon sehr früh ein runder Zackenabschluß
der Rlöppelspitze gefunden wurde, wie er noch jetzt bei
den bekanntesten Torchonspitzenmustern gebräuchlich ist.
Gerade diejenigen Muster, die am engsten mit dem
Geiste der Technik verwachsen sind, halten sich jahr-
hundertelang in Hebung und werden von „Rennern"
ihrer Einfachheit wegen nicht geschätzt. Von großem
Merthe für die Geschichte der Rlöppelspitze ist ein Ge-
mälde des Bonifazio II. jfi 1553) in der venetianischen
Akademie, welches eine Frau im Rostüm des frühen
f6. Jahrhunderts darstellt, die als Einsatz in ihrem
ausgeschnittenen Rleide eine breite Spitze nach beiden
Seiten über die Schulter gelegt hat. Der Tharakter des
Musters entspricht ungefähr der Spitze, die sich als Ein-
satz an einem genähten Leinentuch mit Filetstopferei im
Münchener Nationalmuseum befindet. (Abb. 140.)
Auch Jan de Goes gibt Spitzen dieser Art auf seinen
Bildern. Mar schon um die Mitte des (6. Jahr-
hunderts die Geschicklichkeit im Rlöppeln so weit ge-
stiegen, daß man Spitzen von reichlicher Schulterbreite
herstellte, so müssen die Anfänge dieser Run st wesent
lich früher liegen.
Bonifazio ist übrigens der erste, der ein Mädchen am
Rlöppelkifien gemalt hat. Das Merk war auf der dies
jährigen Frühjahrs-Ausstellung in London ausgestellt; es
befindet sich in England im privatbesitz. Leföbure erwähnt
die Darstellung eines klöppelnden Mädchens von Quentin
Metsy in irgend einer holländischen Rirche; die Holländer
stützen auf dies Bild ihre Behauptung von der Priorität
ihres Landes in der Spitze. Zn der That lassen manche
frühe Madonnenschleier auf Verwandlschaft mit flandrischer
Spitze schließen, wie sie später an Hauben vielfach üblich ist.
Am Ende des lö. Zahrhunderts wird in irgend einer Thronik
Rlage darüber geführt, daß die Frauen allzuviel Zeit an
das Maschen ihrer Schleierborten wenden. Es ist kaum
anzunehmen, daß diese Borten nicht geklöppelt waren, denn
bekanntlich erfordert die Rlöppelspitze viel Aufmerksamkeit
in der Wäsche.
Die Tradition, das Rlöppeln sei zuerst von Zuden in
Goldspitze ausgeführt worden, hat manches wahrscheinliche
für sich; ein jüdisches Gewand im Münchener National
museum scheint z. B. darauf hinzudeuten. Jedenfalls ist
der Gebrauch von Rlöppeln früher bekannt gewesen, als
derjenige der Zuhilfenahme von Stecknadeln bei der Arbeit.
Noch Guido Reni stellt ein Mädchen dar, das mit Hilfe
von Rlöppeln eine Borte flechtet, deren Fäden an einen
Vorhang angesteckt sind. Alte deutsche Modelbücher geben
Darstellungen von Rlöppeln, die an Rahmen hängen. Schon
aus dem Tharakter vieler frühen Rlöppelspitzen wird man
aus die Vermuthung geführt, daß ursprünglich pflöcke anstatt
der Stecknadel bei der Arbeit verwendet wurden und daß
man die Spitzen im Rahmen hängend, nicht auf dem Rissen
klöppelte. Diese Vermuthung wird ausdrücklich in einem
Modelbuche der Sammlung des Berliner Runstgewerbe-
mufeums aus dem f8. Zahrhundert bestätigt; bei der sog.
Filoche-Strickerei war dies Verfahren noch damals üblich.
Auch in Amaranthes' Frauenzimmerlexikon (1700) ist eine
ähnliche Technik beschrieben.
Auch hierin liegt ein Beweis dafür, daß sich die Rlöppel
spitze nicht unmittelbar aus der geknüpften Franse entwickelt
hat; überhaupt kann sie auch mit den posamentirarbeiten
nur indirekt in Verbindung gebracht werden und muß als
selbständige Technik der Verschlingungen gezwirnter Fäden
gelten. Die ungezwirnten Gewebefäden der Franse werden
zunächst immer nur zum Rnüpfen und Rnoten führen;
sämmtliche Gemälde der Renaissance zeigen nur einfache,
stilreine Troddeln und Fransen; erst das Barock führt
phantastische Auswüchse auf diesem Gebiete ein. Es ist
freilich nicht zu verwundern, daß Frau Frauberger den Stand
der posamentirfertigkeiten am Ausgang des fö. Jahrhunderts
überschätzt. Sind doch in der Stoffsammlung des Berliner
Runstgewerbemuseums Troddeln im Tharakter des Zgnolo
und Van Dyk in das 15. Jahrhundert datirt. Einigermaßen
künstliche Troddeln finden sich zuerst auf Bildern bei Lorenzo
Lotto; die Fransen bleiben noch lange sehr einfach. Nicht
unwahrscheinlich ist die Richtigkeit eines venetianischen Be-
richtes, welcher angibt, daß in den letzten Jahrzehnten des
lö. Jahrhunderts Goldborten und -spitzen mit so schweren
Steuern belegt worden seien, daß man von nun an zu Zwirn
und Seide gegriffen habe. Eigentliche Schnurposamente im
modernen Sinne finden sich erst bei Michelangelo Taravaggio.
Eines der schönsten Beispiele von früher Rlöppelspitze
findet sich am Gewände der Eleonore von Toledo, Gemahlin
Rom unverkennbar deutliche Spitze; ähnlich wie sie bei
Palma Vecchio vorkommt. jm Allgemeinen ist es nicht
Bellini's Art, viel Detail in der Rleidung zu geben; genauer
ist hierin fein Zeitgenosse Boccacino, an dessen Bildern
man deutlich erkennt, wie der Tharakter der Spitze durch
Uebermalung später verwischt wurde, pordenone, del piombo
und auch Agnolo Bronzino verrathen die Neigung, der
Spitze in der Darstellung einen plastischen Tharakter zu
geben. Line Spitze in der Art des Palma Vecchio findet
sich z. B. bei Pinturrichio ff 15^5) aus dem Halsbunde
einer Albe mit den Zacken nach innen gelegt. Ebenso sind
Goldspitzen gleichen Tharakters auf einigen Sammtstickereien
des Berliner Runstgewerbemuseums verwendet; die Druck
stellen im Sammt beweisen, daß die Spitze nicht etwa später
aufgesetzt wurde. Diese Arbeiten sind mit dem Zahre \500
keineswegs zu früh datirt. Zahlreiche erhaltene Goldspitzen
beweisen, daß schon sehr früh ein runder Zackenabschluß
der Rlöppelspitze gefunden wurde, wie er noch jetzt bei
den bekanntesten Torchonspitzenmustern gebräuchlich ist.
Gerade diejenigen Muster, die am engsten mit dem
Geiste der Technik verwachsen sind, halten sich jahr-
hundertelang in Hebung und werden von „Rennern"
ihrer Einfachheit wegen nicht geschätzt. Von großem
Merthe für die Geschichte der Rlöppelspitze ist ein Ge-
mälde des Bonifazio II. jfi 1553) in der venetianischen
Akademie, welches eine Frau im Rostüm des frühen
f6. Jahrhunderts darstellt, die als Einsatz in ihrem
ausgeschnittenen Rleide eine breite Spitze nach beiden
Seiten über die Schulter gelegt hat. Der Tharakter des
Musters entspricht ungefähr der Spitze, die sich als Ein-
satz an einem genähten Leinentuch mit Filetstopferei im
Münchener Nationalmuseum befindet. (Abb. 140.)
Auch Jan de Goes gibt Spitzen dieser Art auf seinen
Bildern. Mar schon um die Mitte des (6. Jahr-
hunderts die Geschicklichkeit im Rlöppeln so weit ge-
stiegen, daß man Spitzen von reichlicher Schulterbreite
herstellte, so müssen die Anfänge dieser Run st wesent
lich früher liegen.
Bonifazio ist übrigens der erste, der ein Mädchen am
Rlöppelkifien gemalt hat. Das Merk war auf der dies
jährigen Frühjahrs-Ausstellung in London ausgestellt; es
befindet sich in England im privatbesitz. Leföbure erwähnt
die Darstellung eines klöppelnden Mädchens von Quentin
Metsy in irgend einer holländischen Rirche; die Holländer
stützen auf dies Bild ihre Behauptung von der Priorität
ihres Landes in der Spitze. Zn der That lassen manche
frühe Madonnenschleier auf Verwandlschaft mit flandrischer
Spitze schließen, wie sie später an Hauben vielfach üblich ist.
Am Ende des lö. Zahrhunderts wird in irgend einer Thronik
Rlage darüber geführt, daß die Frauen allzuviel Zeit an
das Maschen ihrer Schleierborten wenden. Es ist kaum
anzunehmen, daß diese Borten nicht geklöppelt waren, denn
bekanntlich erfordert die Rlöppelspitze viel Aufmerksamkeit
in der Wäsche.
Die Tradition, das Rlöppeln sei zuerst von Zuden in
Goldspitze ausgeführt worden, hat manches wahrscheinliche
für sich; ein jüdisches Gewand im Münchener National
museum scheint z. B. darauf hinzudeuten. Jedenfalls ist
der Gebrauch von Rlöppeln früher bekannt gewesen, als
derjenige der Zuhilfenahme von Stecknadeln bei der Arbeit.
Noch Guido Reni stellt ein Mädchen dar, das mit Hilfe
von Rlöppeln eine Borte flechtet, deren Fäden an einen
Vorhang angesteckt sind. Alte deutsche Modelbücher geben
Darstellungen von Rlöppeln, die an Rahmen hängen. Schon
aus dem Tharakter vieler frühen Rlöppelspitzen wird man
aus die Vermuthung geführt, daß ursprünglich pflöcke anstatt
der Stecknadel bei der Arbeit verwendet wurden und daß
man die Spitzen im Rahmen hängend, nicht auf dem Rissen
klöppelte. Diese Vermuthung wird ausdrücklich in einem
Modelbuche der Sammlung des Berliner Runstgewerbe-
mufeums aus dem f8. Zahrhundert bestätigt; bei der sog.
Filoche-Strickerei war dies Verfahren noch damals üblich.
Auch in Amaranthes' Frauenzimmerlexikon (1700) ist eine
ähnliche Technik beschrieben.
Auch hierin liegt ein Beweis dafür, daß sich die Rlöppel
spitze nicht unmittelbar aus der geknüpften Franse entwickelt
hat; überhaupt kann sie auch mit den posamentirarbeiten
nur indirekt in Verbindung gebracht werden und muß als
selbständige Technik der Verschlingungen gezwirnter Fäden
gelten. Die ungezwirnten Gewebefäden der Franse werden
zunächst immer nur zum Rnüpfen und Rnoten führen;
sämmtliche Gemälde der Renaissance zeigen nur einfache,
stilreine Troddeln und Fransen; erst das Barock führt
phantastische Auswüchse auf diesem Gebiete ein. Es ist
freilich nicht zu verwundern, daß Frau Frauberger den Stand
der posamentirfertigkeiten am Ausgang des fö. Jahrhunderts
überschätzt. Sind doch in der Stoffsammlung des Berliner
Runstgewerbemuseums Troddeln im Tharakter des Zgnolo
und Van Dyk in das 15. Jahrhundert datirt. Einigermaßen
künstliche Troddeln finden sich zuerst auf Bildern bei Lorenzo
Lotto; die Fransen bleiben noch lange sehr einfach. Nicht
unwahrscheinlich ist die Richtigkeit eines venetianischen Be-
richtes, welcher angibt, daß in den letzten Jahrzehnten des
lö. Jahrhunderts Goldborten und -spitzen mit so schweren
Steuern belegt worden seien, daß man von nun an zu Zwirn
und Seide gegriffen habe. Eigentliche Schnurposamente im
modernen Sinne finden sich erst bei Michelangelo Taravaggio.
Eines der schönsten Beispiele von früher Rlöppelspitze
findet sich am Gewände der Eleonore von Toledo, Gemahlin