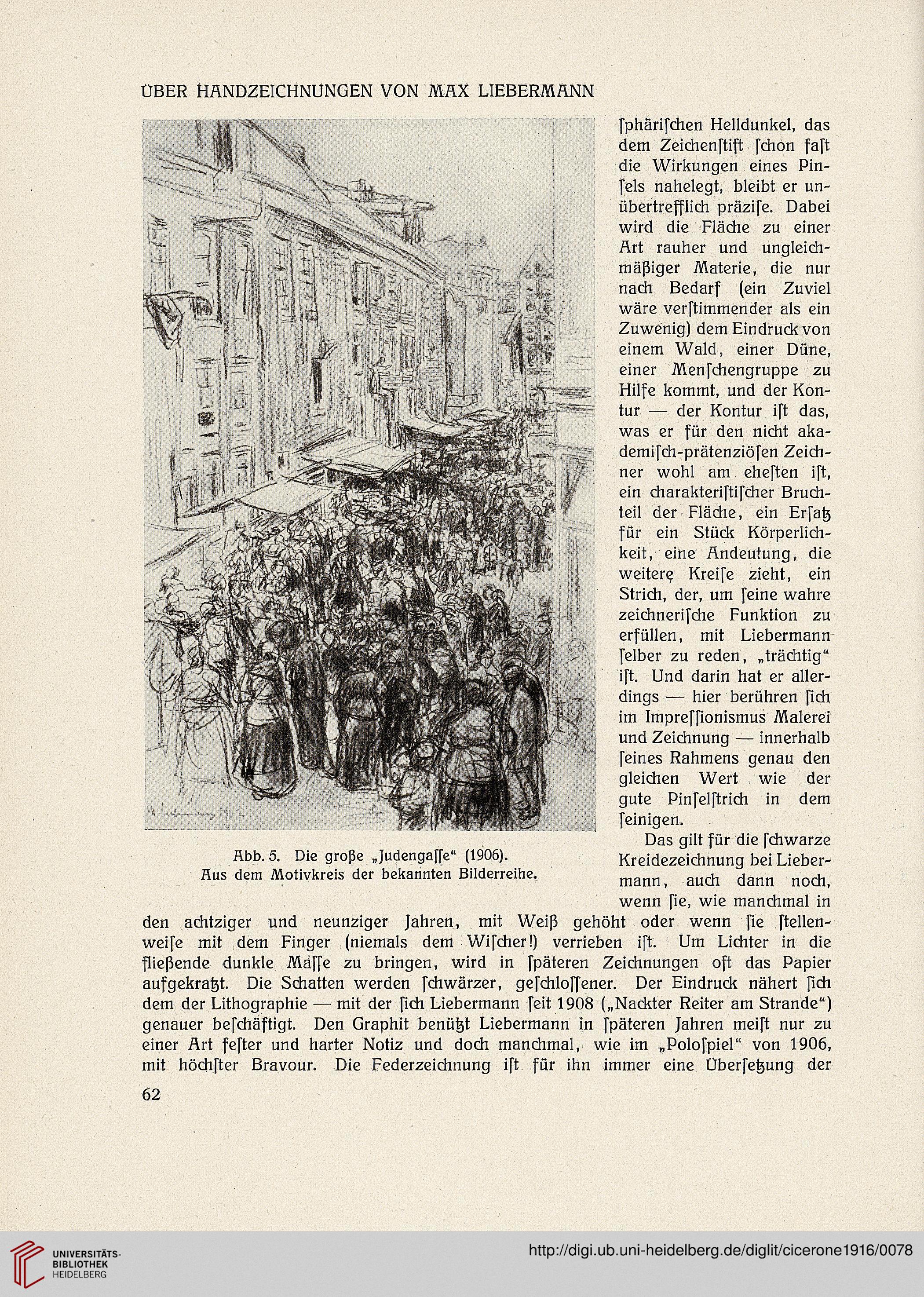Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 8.1916
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26378#0078
DOI Heft:
Heft 3/4
DOI Artikel:Gold, Alfred: Über Handzeichungen von Max Liebermann
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26378#0078
ÜBER HANDZEICHNUNGEN VON MAX LIEBERMANN
Art rauher und ungleich-
mäßiger Materie, die nur
nach Bedarf (ein Zuviel
wäre verftimmender als ein
Zuwenig) dem Eindruck von
einem Wald, einer Düne,
einer Menfchengruppe zu
Hilfe kommt, und der Kon-
tur — der Kontur ift das,
was er für den nicht aka-
demifch-prätenziöfen Zeich-
ner wohl am eheften ift,
ein charakteriftifcher Bruch-
teil der Fläche, ein Erfal^
für ein Stück Körperlich-
keit, eine Andeutung, die
weiterp Kreife zieht, ein
Strich, der, um feine wahre
zeichnerifche Funktion zu
erfüilen, mit Liebermann
feiber zu reden, „trächtig"
ift. Und darin hat er aller-
dings — hier berühren fich
im Impreffionismus Malerei
und Zeichnung — innerhalb
feines Rahmens genau den
gleichen Wert wie der
gute Pinfelftrich in dem
feinigen.
Das gilt für die fchwarze
Abb. 5. Die große „Judengaffe" (1906). Kreidezeichnung bei Lieber-
Aus dem Motivkreis der bekannten Biiderreihe. mann auch dann noch
wenn fie, wie manchmal in
den achtziger und neunziger Jahren, mit Weiß gehöht oder wenn fie ftellen-
weife mit dem Finger (niemals dem Wifcher!) verrieben ift. Um Lichter in die
fließende dunkle Maffe zu bringen, wird in fpäteren Zeichnungen oft das Papier
aufgekraßt. Die Schatten werden fchwärzer, gefchloffener. Der Eindruck nähert fich
dem der Lithographie — mit der fich Liebermann feit 1908 („Nackter Reiter am Strande")
genauer befchäftigt. Den Graphit benützt Liebermann in fpäteren Jahren meift nur zu
einer Art fefter und harter Notiz und doch manchmal, wie im „Polofpiel" von 1906,
mit höchfter Bravour. Die Federzeichnung ift für ihn immer eine Überfe^ung der
fphärifchen Helldunkel, das
dem Zeichenftift fchon faft
die Wirkungen eines Pin-
fels nahelegt, bleibt er un-
übertrefflich präzife. Dabei
wird die Fläche zu einer
62
Art rauher und ungleich-
mäßiger Materie, die nur
nach Bedarf (ein Zuviel
wäre verftimmender als ein
Zuwenig) dem Eindruck von
einem Wald, einer Düne,
einer Menfchengruppe zu
Hilfe kommt, und der Kon-
tur — der Kontur ift das,
was er für den nicht aka-
demifch-prätenziöfen Zeich-
ner wohl am eheften ift,
ein charakteriftifcher Bruch-
teil der Fläche, ein Erfal^
für ein Stück Körperlich-
keit, eine Andeutung, die
weiterp Kreife zieht, ein
Strich, der, um feine wahre
zeichnerifche Funktion zu
erfüilen, mit Liebermann
feiber zu reden, „trächtig"
ift. Und darin hat er aller-
dings — hier berühren fich
im Impreffionismus Malerei
und Zeichnung — innerhalb
feines Rahmens genau den
gleichen Wert wie der
gute Pinfelftrich in dem
feinigen.
Das gilt für die fchwarze
Abb. 5. Die große „Judengaffe" (1906). Kreidezeichnung bei Lieber-
Aus dem Motivkreis der bekannten Biiderreihe. mann auch dann noch
wenn fie, wie manchmal in
den achtziger und neunziger Jahren, mit Weiß gehöht oder wenn fie ftellen-
weife mit dem Finger (niemals dem Wifcher!) verrieben ift. Um Lichter in die
fließende dunkle Maffe zu bringen, wird in fpäteren Zeichnungen oft das Papier
aufgekraßt. Die Schatten werden fchwärzer, gefchloffener. Der Eindruck nähert fich
dem der Lithographie — mit der fich Liebermann feit 1908 („Nackter Reiter am Strande")
genauer befchäftigt. Den Graphit benützt Liebermann in fpäteren Jahren meift nur zu
einer Art fefter und harter Notiz und doch manchmal, wie im „Polofpiel" von 1906,
mit höchfter Bravour. Die Federzeichnung ift für ihn immer eine Überfe^ung der
fphärifchen Helldunkel, das
dem Zeichenftift fchon faft
die Wirkungen eines Pin-
fels nahelegt, bleibt er un-
übertrefflich präzife. Dabei
wird die Fläche zu einer
62