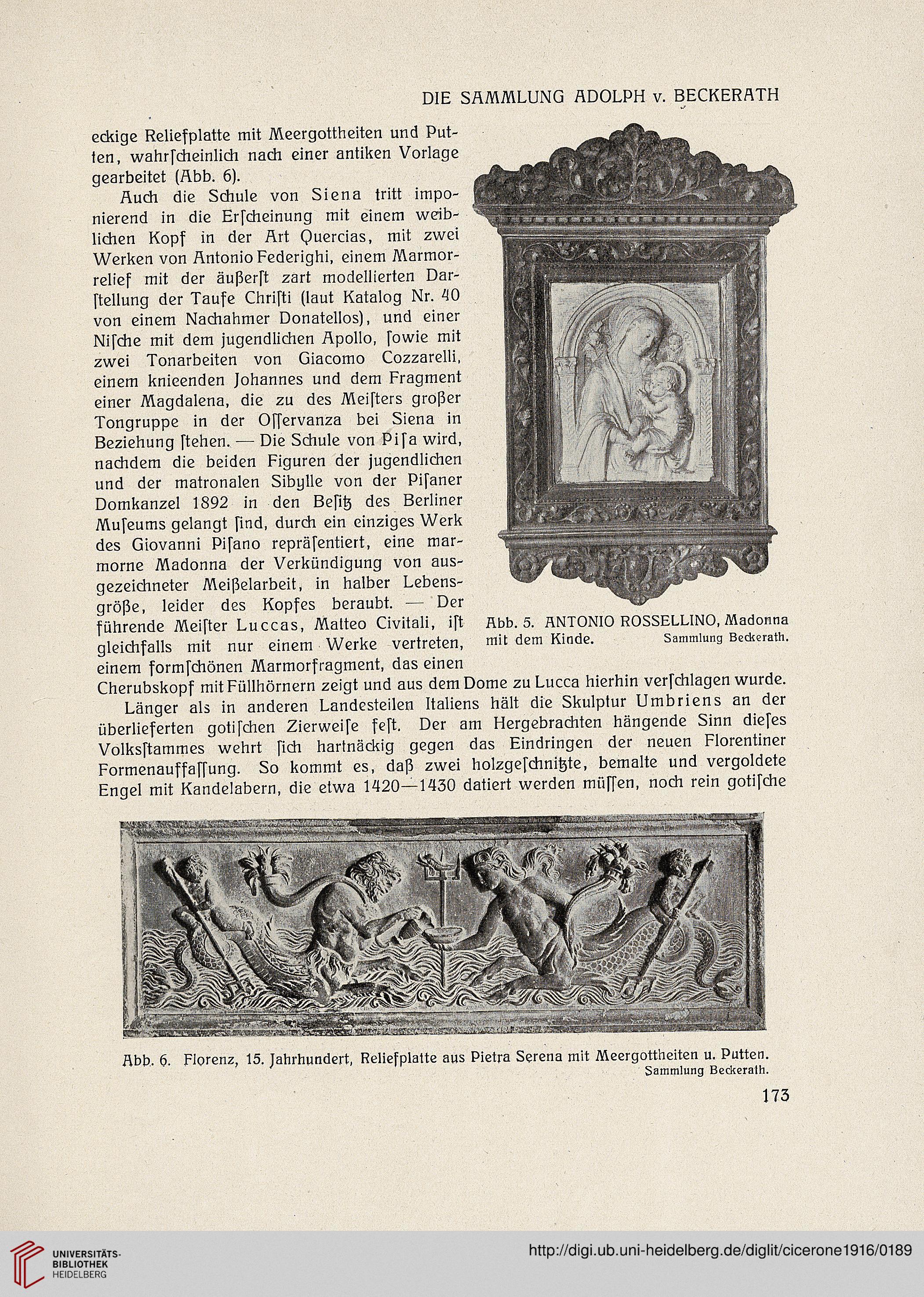Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 8.1916
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26378#0189
DOI Heft:
Heft 9/10
DOI Artikel:Bombe, Walter: Die Sammlung Adolph v. Beckerath
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26378#0189
DIE SAMMLUNG ADOLPH v. BECKERATH
eckige Reliefplatte mit Meergottheiten und Put-
ten, wahrfcheinlich nach einer antiken Vorlage
gearbeitet (Abb. 6).
Auch die Schuie von Siena tritt impo-
nierend in die Erfcheinung mit einem weib-
lichen Kopf in der Art Quercias, mit zwei
Werken von Antonio Federighi, einem Marmor-
relief mit der äußerft zart modellierten Dar-
fteHung der Taufe Chrifti (laut Katalog Nr. 40
von einem Nachahmer Donateltos), und einer
Nifche mit dem jugendlichen Apolio, fowie mit
zwei Tonarbeiten von Giacomo Cozzarelii,
einem knicenden Johannes und dem Fragment
einer Magdalena, die zu des Meifters großer
Tongruppe in der Offervanza bei Siena in
Beziehung ftehen. - Die Schule von Pifa wird,
nachdem die beiden Figuren der jugendiichen
und der matronalen Sibylle von der Pifaner
Domkanzei 1892 in den Befit$ des Berliner
Mufeums gelangt find, durch ein einziges Werk
des Giovanni Pifano repräfentiert, eine mar-
morne Madonna der Verkündigung von aus-
gezeichneter Meißeiarbeit, in halber Lebens-
größe, leider des Kopfes beraubt. - Der
führende Meifter Luccas, Matteo Civitali, ift Abb. 5. ANTONIO ROSSELL1NO, Madonna
gleichfalls mit nur einem Werke vertreten, mit dem Kinde. Sammtung Beckerath,
einem formfehönen Marmorfragment, das einen
Cherubskopf mit Füllhörnern zeigt und aus dem Dome zu Lucca hierhin verfchlagen wurde.
Länger als in anderen Landcsteilen Italiens hält die Skulptur Umbriens an der
überlieferten gotifchen Zierweife feft. Der am Hergebrachten hängende Sinn diefes
Volksftammes wehrt fich hartnäckig gegen das Eindringen der neuen Florentiner
Formenauffaffung. So kommt es, daß zwei holzgefchni^te, bemalte und vergoldete
Engel mit Kandelabern, die etwa 1420—1430 datiert werden miiffen, noch rein gotifche
eckige Reliefplatte mit Meergottheiten und Put-
ten, wahrfcheinlich nach einer antiken Vorlage
gearbeitet (Abb. 6).
Auch die Schuie von Siena tritt impo-
nierend in die Erfcheinung mit einem weib-
lichen Kopf in der Art Quercias, mit zwei
Werken von Antonio Federighi, einem Marmor-
relief mit der äußerft zart modellierten Dar-
fteHung der Taufe Chrifti (laut Katalog Nr. 40
von einem Nachahmer Donateltos), und einer
Nifche mit dem jugendlichen Apolio, fowie mit
zwei Tonarbeiten von Giacomo Cozzarelii,
einem knicenden Johannes und dem Fragment
einer Magdalena, die zu des Meifters großer
Tongruppe in der Offervanza bei Siena in
Beziehung ftehen. - Die Schule von Pifa wird,
nachdem die beiden Figuren der jugendiichen
und der matronalen Sibylle von der Pifaner
Domkanzei 1892 in den Befit$ des Berliner
Mufeums gelangt find, durch ein einziges Werk
des Giovanni Pifano repräfentiert, eine mar-
morne Madonna der Verkündigung von aus-
gezeichneter Meißeiarbeit, in halber Lebens-
größe, leider des Kopfes beraubt. - Der
führende Meifter Luccas, Matteo Civitali, ift Abb. 5. ANTONIO ROSSELL1NO, Madonna
gleichfalls mit nur einem Werke vertreten, mit dem Kinde. Sammtung Beckerath,
einem formfehönen Marmorfragment, das einen
Cherubskopf mit Füllhörnern zeigt und aus dem Dome zu Lucca hierhin verfchlagen wurde.
Länger als in anderen Landcsteilen Italiens hält die Skulptur Umbriens an der
überlieferten gotifchen Zierweife feft. Der am Hergebrachten hängende Sinn diefes
Volksftammes wehrt fich hartnäckig gegen das Eindringen der neuen Florentiner
Formenauffaffung. So kommt es, daß zwei holzgefchni^te, bemalte und vergoldete
Engel mit Kandelabern, die etwa 1420—1430 datiert werden miiffen, noch rein gotifche