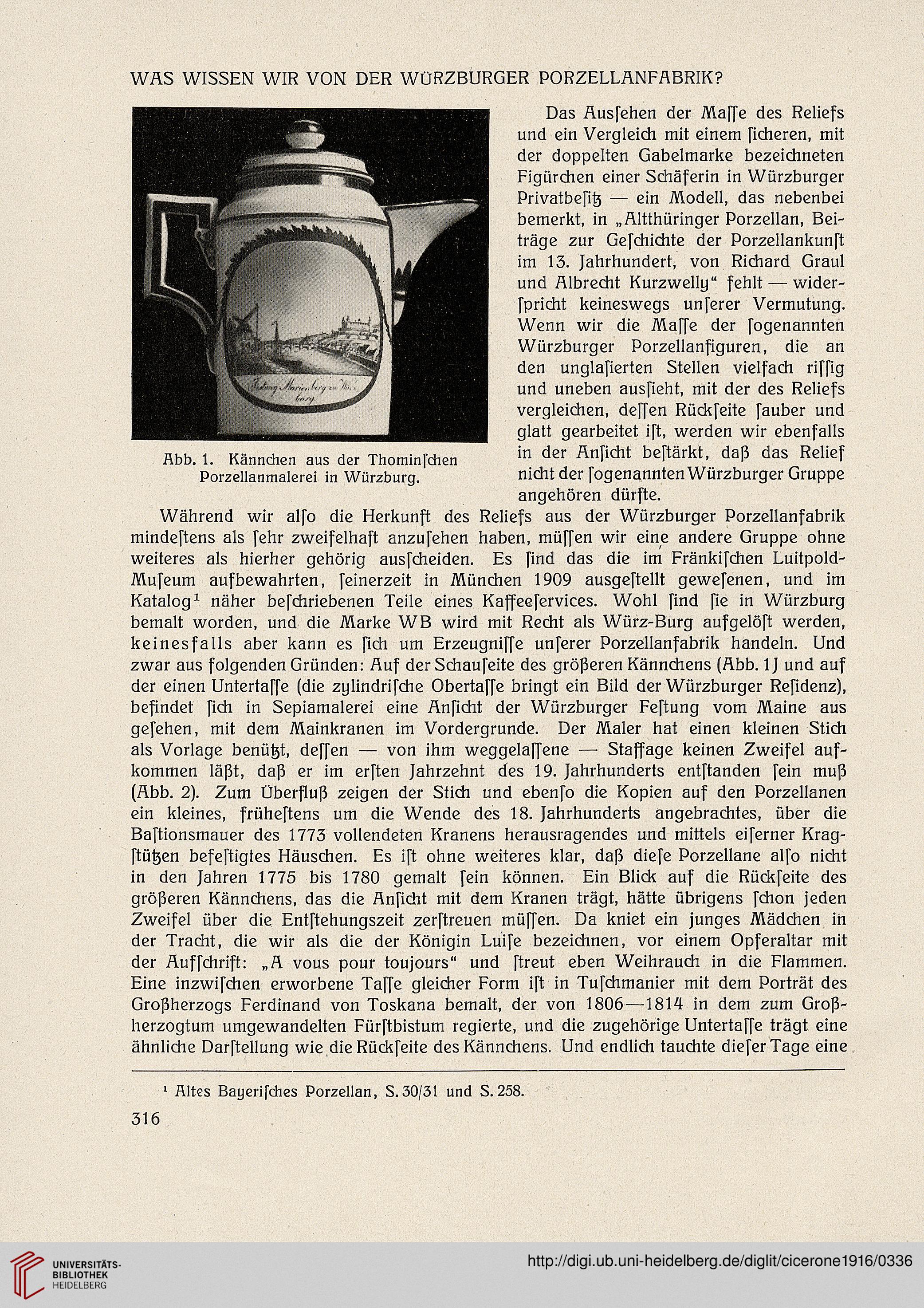WAS WISSEN WIR VON DER WÜRZBURGER PORZELLANFABRIK?
Das Ausfehen der Maffe des Reliefs
und ein Vergleich mit einem ficheren, mit
der doppelten Gabelmarke bezeichneten
Figürchen einer Schäferin in Würzburger
Privatbefiß — ein Modell, das nebenbei
bemerkt, in „Aitthüringer Porzellan, Bei-
träge zur Gefchichte der Porzeilankunft
im 13. Jahrhundert, von Richard Graul
und Aibrecht Kurzweiig" fehlt — wider-
fpricht keineswegs unferer Vermutung.
Wenn wir die Maffe der fogenannten
Würzburger Porzelianfiguren, die an
den unglafierten Stellen vielfach riffig
und uneben ausfieht, mit der des Reliefs
vergleichen, deffen Rückfeite fauber und
giatt gearbeitet ift, werden wir ebenfails
in der Anficht beftärkt, daß das Relief
nicht der fogenannten Würzburger Gruppe
angehören dürfte.
Während wir alfo die Herkunft des Reliefs aus der Würzburger Porzellanfabrik
mindeftens als fehr zweifelhaft anzufehen haben, müffen wir eine andere Gruppe ohne
weiteres als hierher gehörig ausfcheiden. Es find das die im Fränkifchen Luitpold-
Mufeum auf bewahrten, feinerzeit in München 1909 ausgefteht gewefenen, und im
Katalog ^ näher befchriebenen Teile eines Kaffeefervices. Wohl find fie in Würzburg
bemalt worden, und die Marke WB wird mit Recht als Würz-Burg aufgelöft werden,
keinesfaiis aber kann es fich um Erzeugniffe unferer PorzeHanfabrik handeln. Und
zwar aus folgenden Gründen: Auf der Schaufeite des größeren Kännchens (Abb. 1J und auf
der einen Untertaffe (die zgiindrifche Obertaffe bringt ein Biid der Würzburger Refidenz),
befindet fich in Sepiamalerei eine Anficht der Würzburger Feftung vom Maine aus
gefehen, mit dem Mainkranen im Vordergründe. Der Maler hat einen kleinen Stich
als Vorlage benützt, deffen — von ihm weggelaffene — Staffage keinen Zweifel auf-
kommen läßt, daß er im erften Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entftanden fein muß
(Abb. 2). Zum Überfluß zeigen der Stich und ebenfo die Kopien auf den Porzelianen
ein kleines, früheftens um die Wende des 18. Jahrhunderts angebrachtes, über die
Baftionsmauer des 1773 vohendeten Kranens herausragendes und mittels eiferner Krag-
ftüt;en befeftigtes Häuschen. Es ift ohne weiteres kiar, daß diefe Porzellane alfo nicht
in den Jahren 1775 bis 1780 gemalt fein können. Ein Blick auf die Rückfeite des
größeren Kännchens, das die Anficht mit dem Kranen trägt, hätte übrigens fchon jeden
Zweifel über die Entftehungszeit zerftreuen müffen. Da kniet ein junges Mädchen in
der Tracht, die wir als die der Königin Luife bezeichnen, vor einem Opferaitar mit
der Auffchrift: „A vous pour toujours" und ftreut eben Weihrauch in die Flammen.
Eine inzwifchen erworbene Taffe gleicher Form ift in Tufchmanier mit dem Porträt des
Großherzogs Ferdinand von Toskana bemalt, der von 1806—1814 in dem zum Groß-
herzogtum umgewandelten Fürftbistum regierte, und die zugehörige Untertaffe trägt eine
ähnliche Darfteliung wie die Rückfeite des Kännchens. Und endlich tauchte dieferTage eine
' Altes Bayerifches Porzellan, S. 30(31 und S. 258.
316
Das Ausfehen der Maffe des Reliefs
und ein Vergleich mit einem ficheren, mit
der doppelten Gabelmarke bezeichneten
Figürchen einer Schäferin in Würzburger
Privatbefiß — ein Modell, das nebenbei
bemerkt, in „Aitthüringer Porzellan, Bei-
träge zur Gefchichte der Porzeilankunft
im 13. Jahrhundert, von Richard Graul
und Aibrecht Kurzweiig" fehlt — wider-
fpricht keineswegs unferer Vermutung.
Wenn wir die Maffe der fogenannten
Würzburger Porzelianfiguren, die an
den unglafierten Stellen vielfach riffig
und uneben ausfieht, mit der des Reliefs
vergleichen, deffen Rückfeite fauber und
giatt gearbeitet ift, werden wir ebenfails
in der Anficht beftärkt, daß das Relief
nicht der fogenannten Würzburger Gruppe
angehören dürfte.
Während wir alfo die Herkunft des Reliefs aus der Würzburger Porzellanfabrik
mindeftens als fehr zweifelhaft anzufehen haben, müffen wir eine andere Gruppe ohne
weiteres als hierher gehörig ausfcheiden. Es find das die im Fränkifchen Luitpold-
Mufeum auf bewahrten, feinerzeit in München 1909 ausgefteht gewefenen, und im
Katalog ^ näher befchriebenen Teile eines Kaffeefervices. Wohl find fie in Würzburg
bemalt worden, und die Marke WB wird mit Recht als Würz-Burg aufgelöft werden,
keinesfaiis aber kann es fich um Erzeugniffe unferer PorzeHanfabrik handeln. Und
zwar aus folgenden Gründen: Auf der Schaufeite des größeren Kännchens (Abb. 1J und auf
der einen Untertaffe (die zgiindrifche Obertaffe bringt ein Biid der Würzburger Refidenz),
befindet fich in Sepiamalerei eine Anficht der Würzburger Feftung vom Maine aus
gefehen, mit dem Mainkranen im Vordergründe. Der Maler hat einen kleinen Stich
als Vorlage benützt, deffen — von ihm weggelaffene — Staffage keinen Zweifel auf-
kommen läßt, daß er im erften Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entftanden fein muß
(Abb. 2). Zum Überfluß zeigen der Stich und ebenfo die Kopien auf den Porzelianen
ein kleines, früheftens um die Wende des 18. Jahrhunderts angebrachtes, über die
Baftionsmauer des 1773 vohendeten Kranens herausragendes und mittels eiferner Krag-
ftüt;en befeftigtes Häuschen. Es ift ohne weiteres kiar, daß diefe Porzellane alfo nicht
in den Jahren 1775 bis 1780 gemalt fein können. Ein Blick auf die Rückfeite des
größeren Kännchens, das die Anficht mit dem Kranen trägt, hätte übrigens fchon jeden
Zweifel über die Entftehungszeit zerftreuen müffen. Da kniet ein junges Mädchen in
der Tracht, die wir als die der Königin Luife bezeichnen, vor einem Opferaitar mit
der Auffchrift: „A vous pour toujours" und ftreut eben Weihrauch in die Flammen.
Eine inzwifchen erworbene Taffe gleicher Form ift in Tufchmanier mit dem Porträt des
Großherzogs Ferdinand von Toskana bemalt, der von 1806—1814 in dem zum Groß-
herzogtum umgewandelten Fürftbistum regierte, und die zugehörige Untertaffe trägt eine
ähnliche Darfteliung wie die Rückfeite des Kännchens. Und endlich tauchte dieferTage eine
' Altes Bayerifches Porzellan, S. 30(31 und S. 258.
316