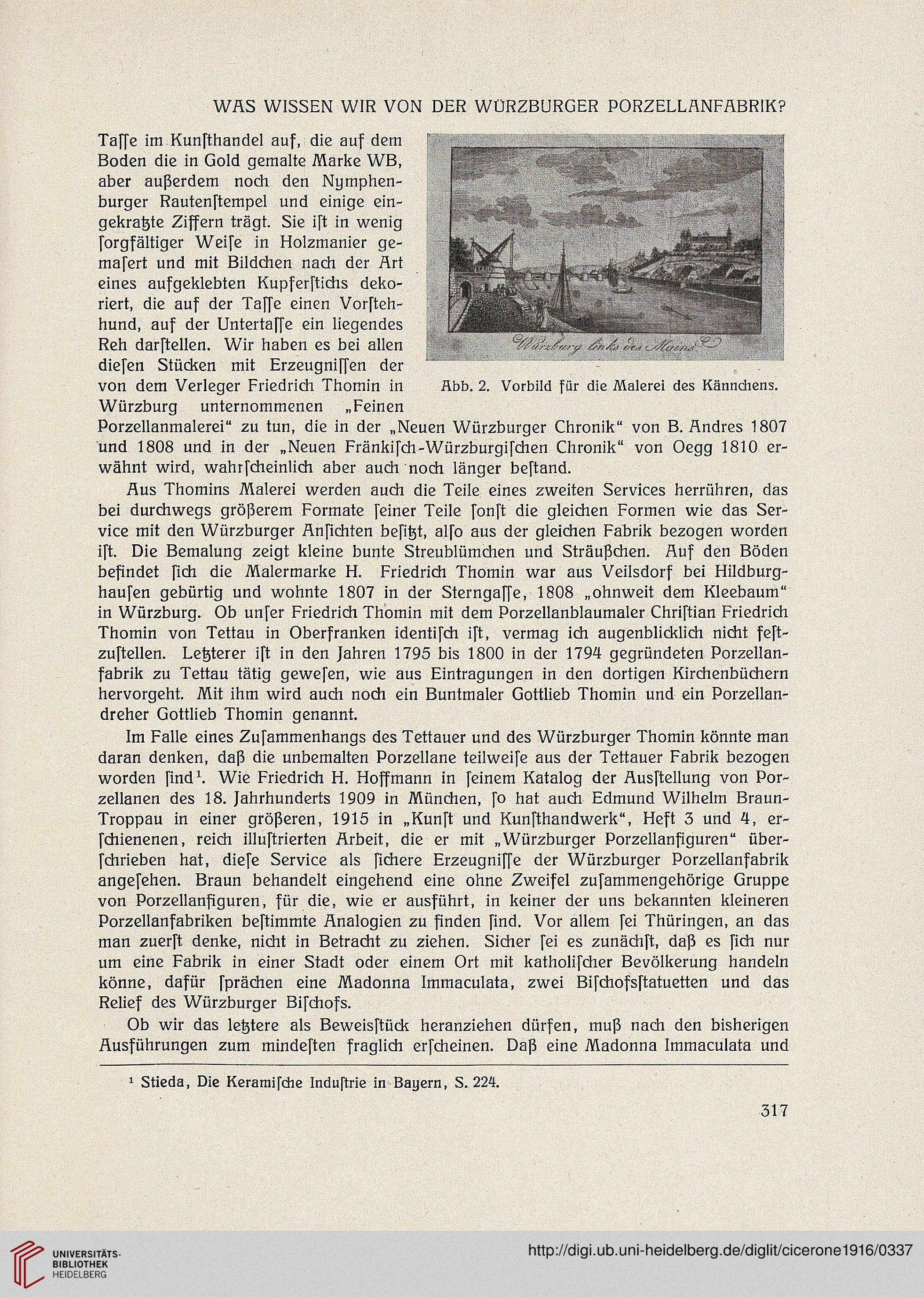WAS WISSEN WIR VON DER WÜRZBURGER PORZELLANFABRIK?
Taffe im Kunfthandel auf, die auf dem
Boden die in Gold gemalte Marke WB,
aber außerdem noch den Nymphen-
burger Rautenftempel und einige ein-
gekraßte Ziffern trägt. Sie ift in wenig
forgfältiger Weife in Holzmanier ge-
mafert und mit Bildchen nach der Art
eines aufgeklebten Kupferftichs deko-
riert, die auf der Taffe einen Vorfteh-
hund, auf der Untertaffe ein liegendes
Reh darftellen. Wir haben es bei allen
diefen Stücken mit Erzeugniffen der
von dem Verleger Friedrich Thomin in
Würzburg unternommenen „Feinen
Porzellanmalerei" zu tun, die in der „Neuen Würzburger Chronik" von B. Andres 1807
und 1808 und in der „Neuen Fränkifch-Würzburgifchen Chronik" von Oegg 1810 er-
wähnt wird, wahrfcheinlich aber auch noch länger beftand.
Aus Thomins Malerei werden auch die Teile eines zweiten Services herrühren, das
bei durchwegs größerem Formate feiner Teile fonft die gleichen Formen wie das Ser-
vice mit den Würzburger Anfichten befißt, alfo aus der gleichen Fabrik bezogen worden
ift. Die Bemalung zeigt kleine bunte Streublümchen und Sträußchen. Auf den Böden
befindet fich die Malermarke H. Friedrich Thomin war aus Veilsdorf bei Hildburg-
haufen gebürtig und wohnte 1807 in der Sterngaffe, 1808 „ohnweit dem Kleebaum"
in Würzburg. Ob unfer Friedrich Thomin mit dem Porzellanblaumaler Chriftian Friedrich
Thomin von Tettau in Oberfranken identifch ift, vermag ich augenblicklich nicht feft-
zuftellen. Letzterer ift in den Jahren 1795 bis 1800 in der 1794 gegründeten Porzellan-
fabrik zu Tettau tätig gewefen, wie aus Eintragungen in den dortigen Kirchenbüchern
hervorgeht. Mit ihm wird auch noch ein Buntmaler Gottlieb Thomin und ein Porzellan-
dreher Gottlieb Thomin genannt.
Im Falle eines Zufammenhangs des Tettauer und des Würzburger Thomin könnte man
daran denken, daß die unbemalten Porzellane teilweife aus der Tettauer Fabrik bezogen
worden findL Wie Friedrich H. Hoffmann in feinem Katalog der Ausftellung von Por-
zellanen des 18. Jahrhunderts 1909 in München, fo hat auch Edmund Wilhelm Braun-
Troppau in einer größeren, 1915 in „Kunft und Kunfthandwerk", Heft 3 und 4, er-
fchienenen, reich illuftrierten Arbeit, die er mit „Würzburger Porzellanfiguren" über-
fchrieben hat, diefe Service als fichere Erzeugniffe der Würzburger Porzellanfabrik
angefehen. Braun behandelt eingehend eine ohne Zweifel zufammengehörige Gruppe
von Porzellanfiguren, für die, wie er ausführt, in keiner der uns bekannten kleineren
Porzellanfabriken beftimmte Analogien zu finden find. Vor allem fei Thüringen, an das
man zuerft denke, nicht in Betracht zu ziehen. Sicher fei es zunächft, daß es fich nur
um eine Fabrik in einer Stadt oder einem Ort mit katholifcher Bevölkerung handeln
könne, dafür fprächen eine Madonna Immaculata, zwei Bifchofsftatuetten und das
Relief des Würzburger Bifchofs.
Ob wir das letztere als Beweisftück heranziehen dürfen, muß nach den bisherigen
Ausführungen zum mindeften fraglich erfcheinen. Daß eine Madonna Immaculata und
* Stieda, Die Keramifche Induftrie in Bayern, S. 224.
Abb. 2. Vorbild für die Malerei des Kännchens.
317
Taffe im Kunfthandel auf, die auf dem
Boden die in Gold gemalte Marke WB,
aber außerdem noch den Nymphen-
burger Rautenftempel und einige ein-
gekraßte Ziffern trägt. Sie ift in wenig
forgfältiger Weife in Holzmanier ge-
mafert und mit Bildchen nach der Art
eines aufgeklebten Kupferftichs deko-
riert, die auf der Taffe einen Vorfteh-
hund, auf der Untertaffe ein liegendes
Reh darftellen. Wir haben es bei allen
diefen Stücken mit Erzeugniffen der
von dem Verleger Friedrich Thomin in
Würzburg unternommenen „Feinen
Porzellanmalerei" zu tun, die in der „Neuen Würzburger Chronik" von B. Andres 1807
und 1808 und in der „Neuen Fränkifch-Würzburgifchen Chronik" von Oegg 1810 er-
wähnt wird, wahrfcheinlich aber auch noch länger beftand.
Aus Thomins Malerei werden auch die Teile eines zweiten Services herrühren, das
bei durchwegs größerem Formate feiner Teile fonft die gleichen Formen wie das Ser-
vice mit den Würzburger Anfichten befißt, alfo aus der gleichen Fabrik bezogen worden
ift. Die Bemalung zeigt kleine bunte Streublümchen und Sträußchen. Auf den Böden
befindet fich die Malermarke H. Friedrich Thomin war aus Veilsdorf bei Hildburg-
haufen gebürtig und wohnte 1807 in der Sterngaffe, 1808 „ohnweit dem Kleebaum"
in Würzburg. Ob unfer Friedrich Thomin mit dem Porzellanblaumaler Chriftian Friedrich
Thomin von Tettau in Oberfranken identifch ift, vermag ich augenblicklich nicht feft-
zuftellen. Letzterer ift in den Jahren 1795 bis 1800 in der 1794 gegründeten Porzellan-
fabrik zu Tettau tätig gewefen, wie aus Eintragungen in den dortigen Kirchenbüchern
hervorgeht. Mit ihm wird auch noch ein Buntmaler Gottlieb Thomin und ein Porzellan-
dreher Gottlieb Thomin genannt.
Im Falle eines Zufammenhangs des Tettauer und des Würzburger Thomin könnte man
daran denken, daß die unbemalten Porzellane teilweife aus der Tettauer Fabrik bezogen
worden findL Wie Friedrich H. Hoffmann in feinem Katalog der Ausftellung von Por-
zellanen des 18. Jahrhunderts 1909 in München, fo hat auch Edmund Wilhelm Braun-
Troppau in einer größeren, 1915 in „Kunft und Kunfthandwerk", Heft 3 und 4, er-
fchienenen, reich illuftrierten Arbeit, die er mit „Würzburger Porzellanfiguren" über-
fchrieben hat, diefe Service als fichere Erzeugniffe der Würzburger Porzellanfabrik
angefehen. Braun behandelt eingehend eine ohne Zweifel zufammengehörige Gruppe
von Porzellanfiguren, für die, wie er ausführt, in keiner der uns bekannten kleineren
Porzellanfabriken beftimmte Analogien zu finden find. Vor allem fei Thüringen, an das
man zuerft denke, nicht in Betracht zu ziehen. Sicher fei es zunächft, daß es fich nur
um eine Fabrik in einer Stadt oder einem Ort mit katholifcher Bevölkerung handeln
könne, dafür fprächen eine Madonna Immaculata, zwei Bifchofsftatuetten und das
Relief des Würzburger Bifchofs.
Ob wir das letztere als Beweisftück heranziehen dürfen, muß nach den bisherigen
Ausführungen zum mindeften fraglich erfcheinen. Daß eine Madonna Immaculata und
* Stieda, Die Keramifche Induftrie in Bayern, S. 224.
Abb. 2. Vorbild für die Malerei des Kännchens.
317