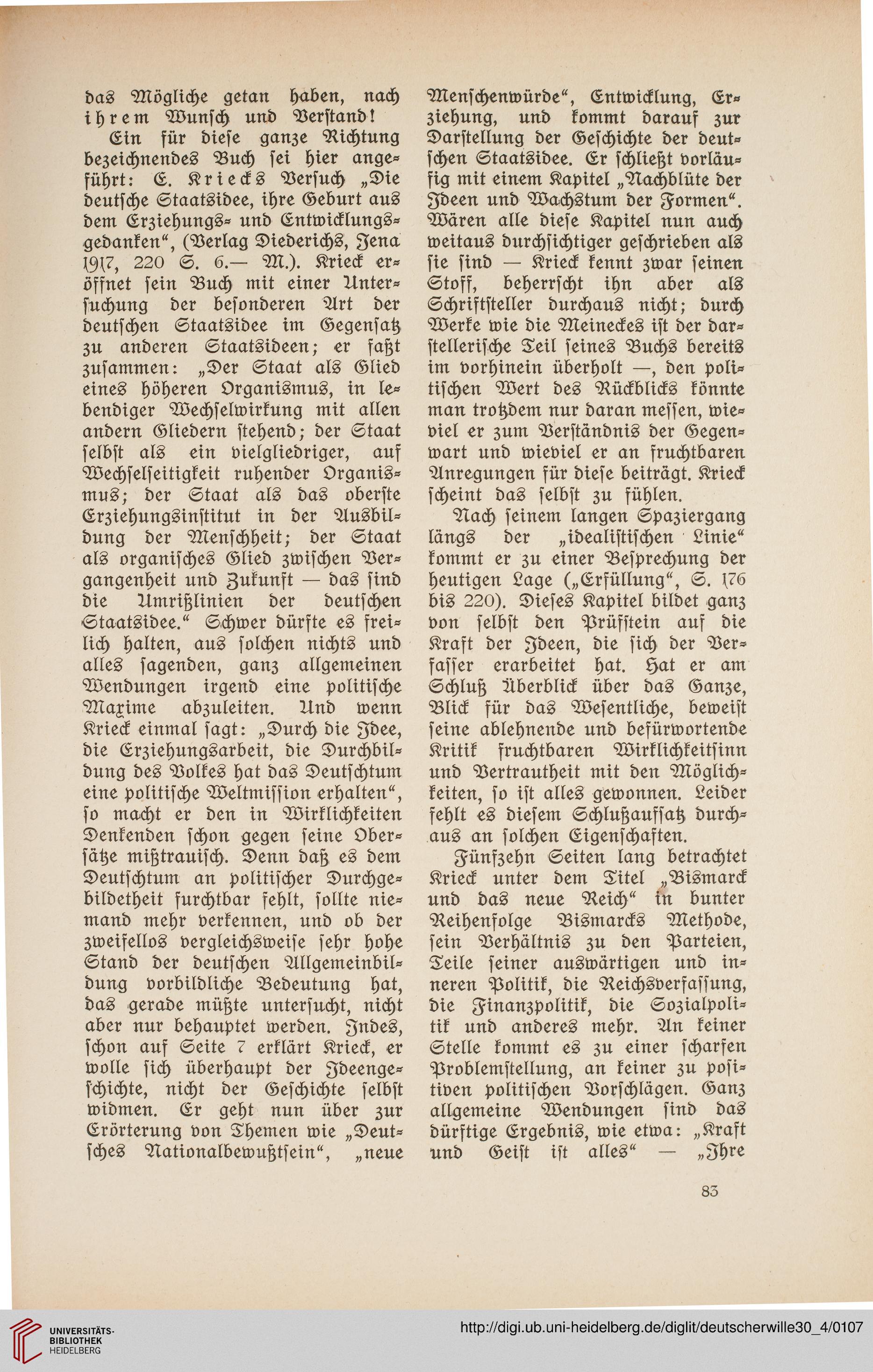das Mögliche getan hnben, nach
ihrem Wunsch und Verstand!
Ein für diese ganze Richtung
bezeichnendes Buch sei hier ange«
führt: E. Kriecks Versuch „Die
deutsche Staatsidee, ihre Geburt aus
dem Erziehungs-- und Lntwicklungs-
gedanken", (Verlag Diederichs, Iena
220 S. 6.— M.). Krieck er-
öffnet sein Buch mit einer Unter-
suchung der besonderen Art der
deutschen Staatsidee im Gegensatz
zu anderen Staatsideen; er faßt
zusammen: „Der Staat als Glied
eines höheren Organismus, in le-
bendiger Wechselwirkung mit allen
andern Gliedern stehend; der Staat
selbst als ein vielgliedriger, aus
Wechselseitigkeit ruhender Organis-
mus; der Staat als das oberste
Erziehungsinstitut in der Ausbil-
dung der Menschheit; der Staat
als organisches Glied zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft — das sind
die Amrißlinien der deutschen
Staatsidee." Schwer dürfte es frei-
lich halten, aus solchen nichts und
alles sagenden, ganz allgemeinen
Wendungen irgend eine politische
Maxime abzuleiten. Und wenn
Krieck einmal sagt: „Durch die Idee,
die Erziehungsarbeit, die Durchbil-
dung des Volkes hat das Deutschtum
eine politische Weltmission erhalten",
so macht er den in Wirklichkeiten
Denkenden schon gegen seine Ober-
sätze mißtrauisch. Denn daß es dem
Deutschtum an politischer Durchge-
bildetheit furchtbar fehlt, sollte nie-
mand mehr verkennen, und ob der
zweifellos vergleichsweise sehr hohe
Stand der deutschen Allgemeinbil-
dung vorbildliche Bedeutung hat,
das gerade müßte untersucht, nicht
aber nur behauptet werden. Indes,
schon auf Seite 7 erklärt Krieck, er
wolle sich überhaupt der Ideenge-
schichte, nicht der Geschichte selbst
widmen. Er geht nun über zur
Erörterung von Themen wie „Deut-
sches Nationalbewußtsein", „neue
Menschenwürde", Lntwicklung, Lr-
ziehung, und kommt darauf zur
Darstellung der Geschichte der deut-
schen Staatsidee. Er schließt vorläu-
fig mit einem Kapitel „Nachblüte der
Ideen und Wachstum der Formen".
Wären alle diese Kapitel nun auch
weitaus durchsichtiger geschrieben als
sie sind — Krieck kennt zwar seinen
Stoff, beherrscht ihn aber als
Schriftsteller durchaus nicht; durch
Werke wie die Meineckes ist der dar-
stellerische Teil seines Buchs bereits
im vorhinein überholt —, den poli-
tischen Wert des Rückblicks könnte
man trotzdem nur daran messen, wie-
viel er zum Verständnis der Gegen-
wart und wieviel er an fruchtbaren
Anregungen für diese beiträgt. Krieck
scheint das selbst zu fühlen.
Nach seinem langen Spaziergang
längs der „idealistischen Linie"
kommt er zu einer Besprechung der
heutigen Lage („Lrfüllung", S. (76
bis 220). Dieses Kapitel bildet ganz
von selbst den Prüfstein auf die
Kraft der Ideen, die sich der Ver-
fasser erarbeitet hat. tzat er am
Schluß Aberblick über das Ganze,
Blick für das Wesentliche, beweist
seine ablehnende und befürwortende
Kritik fruchtbaren Wirklichkeitsinn
und Vertrautheit mit den Möglich-
keiten, so ist alles gewonnen. Leider
fehlt es diesem Schlußaufsatz durch-
aus an solchen Eigenschaften.
Fünfzehn Seiten lang betrachtet
Krieck unter dem Titel „Bismarck
und das neue Reich" in bunter
Reihenfolge Bismarcks Methode,
sein Verhältnis zu den Parteien,
Teile seiner auswärtigen und in-
neren Politik, die Reichsverfassung,
die Finanzpolitik, die Sozialpoli-
tik und anderes mehr. An keiner
Stelle kommt es zu einer scharfen
Problemstellung, an keiner zu posi-
tiven politischen Vorschlägen. Ganz
allgemeine Wendungen sind das
dürftige Ergebnis, wie etwa: „Kraft
und Geist ist alles" — „Ihre
83
ihrem Wunsch und Verstand!
Ein für diese ganze Richtung
bezeichnendes Buch sei hier ange«
führt: E. Kriecks Versuch „Die
deutsche Staatsidee, ihre Geburt aus
dem Erziehungs-- und Lntwicklungs-
gedanken", (Verlag Diederichs, Iena
220 S. 6.— M.). Krieck er-
öffnet sein Buch mit einer Unter-
suchung der besonderen Art der
deutschen Staatsidee im Gegensatz
zu anderen Staatsideen; er faßt
zusammen: „Der Staat als Glied
eines höheren Organismus, in le-
bendiger Wechselwirkung mit allen
andern Gliedern stehend; der Staat
selbst als ein vielgliedriger, aus
Wechselseitigkeit ruhender Organis-
mus; der Staat als das oberste
Erziehungsinstitut in der Ausbil-
dung der Menschheit; der Staat
als organisches Glied zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft — das sind
die Amrißlinien der deutschen
Staatsidee." Schwer dürfte es frei-
lich halten, aus solchen nichts und
alles sagenden, ganz allgemeinen
Wendungen irgend eine politische
Maxime abzuleiten. Und wenn
Krieck einmal sagt: „Durch die Idee,
die Erziehungsarbeit, die Durchbil-
dung des Volkes hat das Deutschtum
eine politische Weltmission erhalten",
so macht er den in Wirklichkeiten
Denkenden schon gegen seine Ober-
sätze mißtrauisch. Denn daß es dem
Deutschtum an politischer Durchge-
bildetheit furchtbar fehlt, sollte nie-
mand mehr verkennen, und ob der
zweifellos vergleichsweise sehr hohe
Stand der deutschen Allgemeinbil-
dung vorbildliche Bedeutung hat,
das gerade müßte untersucht, nicht
aber nur behauptet werden. Indes,
schon auf Seite 7 erklärt Krieck, er
wolle sich überhaupt der Ideenge-
schichte, nicht der Geschichte selbst
widmen. Er geht nun über zur
Erörterung von Themen wie „Deut-
sches Nationalbewußtsein", „neue
Menschenwürde", Lntwicklung, Lr-
ziehung, und kommt darauf zur
Darstellung der Geschichte der deut-
schen Staatsidee. Er schließt vorläu-
fig mit einem Kapitel „Nachblüte der
Ideen und Wachstum der Formen".
Wären alle diese Kapitel nun auch
weitaus durchsichtiger geschrieben als
sie sind — Krieck kennt zwar seinen
Stoff, beherrscht ihn aber als
Schriftsteller durchaus nicht; durch
Werke wie die Meineckes ist der dar-
stellerische Teil seines Buchs bereits
im vorhinein überholt —, den poli-
tischen Wert des Rückblicks könnte
man trotzdem nur daran messen, wie-
viel er zum Verständnis der Gegen-
wart und wieviel er an fruchtbaren
Anregungen für diese beiträgt. Krieck
scheint das selbst zu fühlen.
Nach seinem langen Spaziergang
längs der „idealistischen Linie"
kommt er zu einer Besprechung der
heutigen Lage („Lrfüllung", S. (76
bis 220). Dieses Kapitel bildet ganz
von selbst den Prüfstein auf die
Kraft der Ideen, die sich der Ver-
fasser erarbeitet hat. tzat er am
Schluß Aberblick über das Ganze,
Blick für das Wesentliche, beweist
seine ablehnende und befürwortende
Kritik fruchtbaren Wirklichkeitsinn
und Vertrautheit mit den Möglich-
keiten, so ist alles gewonnen. Leider
fehlt es diesem Schlußaufsatz durch-
aus an solchen Eigenschaften.
Fünfzehn Seiten lang betrachtet
Krieck unter dem Titel „Bismarck
und das neue Reich" in bunter
Reihenfolge Bismarcks Methode,
sein Verhältnis zu den Parteien,
Teile seiner auswärtigen und in-
neren Politik, die Reichsverfassung,
die Finanzpolitik, die Sozialpoli-
tik und anderes mehr. An keiner
Stelle kommt es zu einer scharfen
Problemstellung, an keiner zu posi-
tiven politischen Vorschlägen. Ganz
allgemeine Wendungen sind das
dürftige Ergebnis, wie etwa: „Kraft
und Geist ist alles" — „Ihre
83