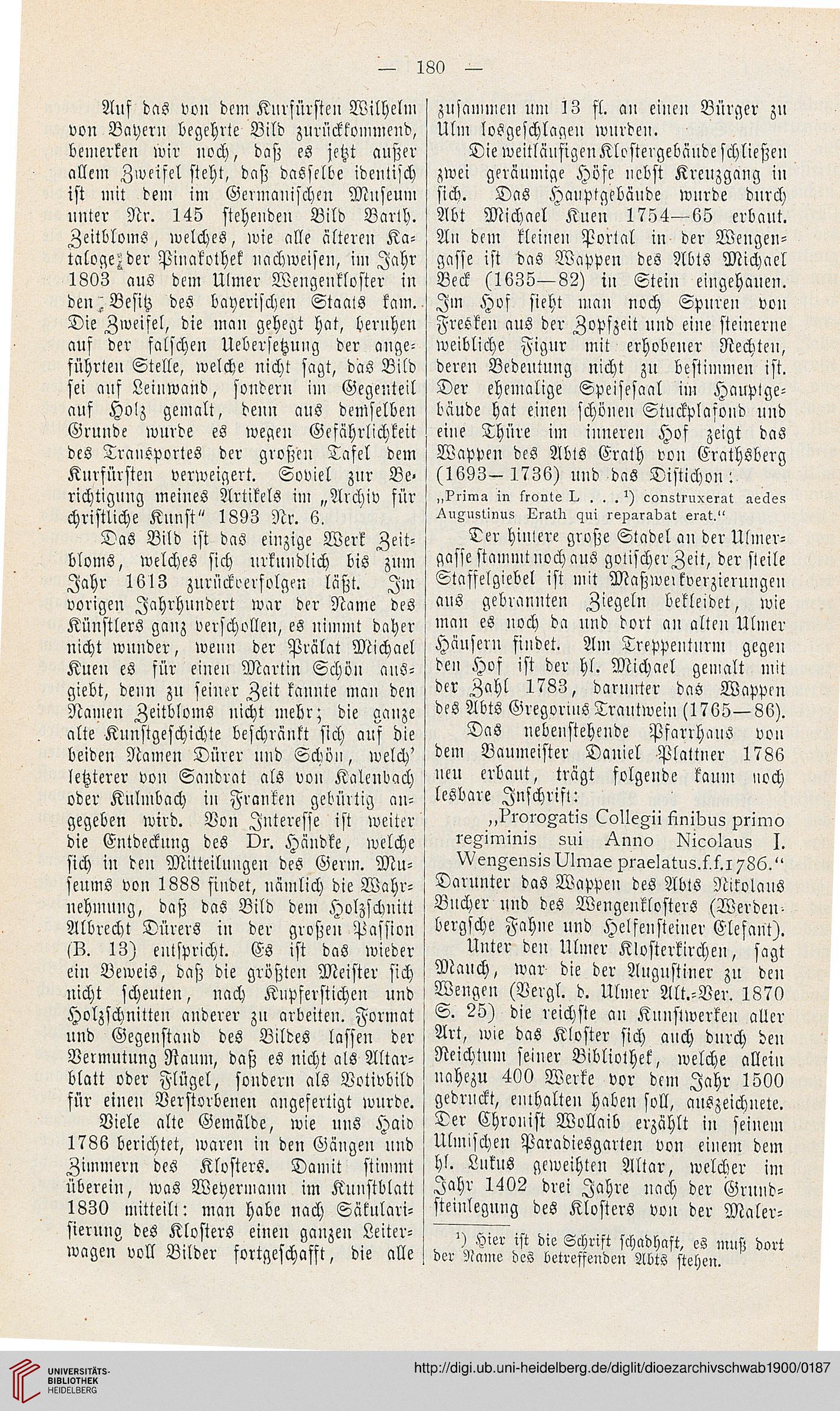180
Auf das von dem Kurfürsten Wilhelm
von Bayern begehrte Bild zurückkommend,
bemerken wir noch, daß es jetzt außer
allem Zweifel steht, daß dasselbe identisch
ist mit dem im Germanischen Museum
unter Nr. 146 stehenden Bild Barth.
Zeitbloms, welches, wie alle älteren Ka-
taloge^der Pinakothek Nachweisen, im Jahr
1803 aus dem Ulmer Wengenkloster in
den : Besitz des bayerischen Staats kam.
Die Zweifel, die man gehegt hat, beruhen
ans der falschen Uebersetzung der ange-
führten Stelle, welche nicht sagt, das Bild
sei ans Leinwand, sondern im Gegenteil
auf Holz gemalt, denn ans demselben
Grunde wurde es wegen Gefährlichkeit
des Transportes der großen Tafel dem
Kurfürsten verweigert. Soviel zur Be-
richtigung meines Artikels im „Archiv für
christliche Kunst" 1893 Nr. 6.
Das Bild ist das einzige Werk Zeit-
bloms, welches sich urkundlich bis zum
Jahr 1613 zurnckoerfvlgen läßt. Im
vorigen Jahrhundert war der Name des
Künstlers ganz verschollen, es nimmt daher
nicht wunder, wenn der Prälat Michael
Kuen es für eine» Martin Schön anö-
giebt, denn zu seiner Zeit kannte man den
Namen Zeitbloms nicht mebr; die ganze
alte Kunstgeschichte beschränkt sich ans die
beiden Namen Dürer und Schön, welch'
letzterer von Sandrat als von Kalendach
oder Knlmbach in Franken gebürtig an-
gegeben wird. Von Interesse ist weiter
die Entdeckung des Or. Händke, welche
sich in den Mitteilungen des Germ. Mu-
seums von 1888 findet, nämlich die Wahr-
nehmung, daß das Bild dem Holzschnitt
Albrecht Dürers in der großen Passion
<13. 13) entspricht. Es ist das wieder
ein Beweis, daß die größten Meister sich
nicht scheuten, nach Kupferstichen und
Holzschnitten anderer zu arbeiten. Format
und Gegenstand des Bildes lassen der
Vermutung Raum, daß es nicht als Altar-
blatt oder Flügel, sondern als Votivbild
für einen Verstorbenen angefertigt wurde.
Viele alte Gemälde, wie uns Haiv
1786 berichtet, waren in den Gängen und
Zimmern des Klosters. Damit stimmt
überein, was Weyermann im Kunstblatt
1830 mitteilt: man habe nach Säkulari-
sierung des Klosters einen ganzen Leiter-
wagen voll Bilder fortgeschafft, die alle
zusammen um 13 sl. an einen Bürger zu
Ulm losgeschlagen wurden.
Die weitläufigen Klostergebäude schließen
zwei geräumige Höfe nebst Kreuzgang in
sich. Das Hauptgebäude wurde durch
Abt Michael Kuen 1754—65 erbaut.
An dem kleinen Portal in der Wengen-
gasse ist das Wappen des Abts Michael
Beck (1635—82) in Stein eingehanen.
Im Hof sieht man noch Spuren von
Fresken aus der Zopfzeit und eine steinerne
weibliche Figur mit erhobener Rechten,
deren Bedeutung nicht zu bestimmen ist.
Der ehemalige Speisesaal im Hauptge-
bäude hat einen schönen Stnckplasond und
eine Thüre im inneren Hof zeigt das
Wappen des Abts Erath von Erathsberg
(1693— 1736) und das Distichon:
„Nrima in fronte I. ... st construxerat aeciea
-ruAnstinus txratli Hui repnrnbat ernt."
Ter Hintere große Stadel an der Ulmer-
gasse stammt noch aus golischerZeit, der steile
Staffelgiebel ist mit Maßweikverzierunge»
ans gebrannten Ziegeln bekleidet, wie
man es noch da und dort an alten Ulmer
Häusern findet. Am Treppentnrm gegen
den Hof ist der hl. Michael gemalt mit
der Zahl 1783, darunter das Wappen
des Abts GregorinS Trantwein (1765—86).
Das nebenstehende Pfarrhaus von
dem Baumeister Daniel Plattner 1786
neu erbaut, trägt folgende kaum noch
lesbare Inschrift:
,,?roio§ntis EolleZii llnidus primo
reZiminis sui T^irno ßstcolnus I.
WenAensis lstlnrne prnelLtus.ül.i/ZO."
Darunter das Wappen des Abts Nikolaus
Bücher und des Wengenklosters (Werden-
bergsche Fahne und Helfensteiner Elefant).
Unter den Ulmer Klosterkirchen, sagt
Manch, war die der Augustiner zu den
Wengen (Vergl. d. Ulmer Alt.-Ver. 1870
S. 25) die reichste an Kunstwerken aller
Art, wie das Kloster sich auch durch den
Reichtum seiner Bibliothek, welche allein
nahezu 400 Werke vor dem Jahr 1500
gedruckt, enthalte» haben soll, anSzeichnete.
Der Chronist Wollaib erzählt in seinem
Ulmischen Paradiesgarten von einem dem
hl. Lnkns geweihten Altar, welcher im
Jahr 1402 drei Jahre nach der Grund-
steinlegung des Klosters von der Maler-
st Hier ist die Schrift schadhaft, es muß dort
der Name des betreffenden AbtS stehen.
Auf das von dem Kurfürsten Wilhelm
von Bayern begehrte Bild zurückkommend,
bemerken wir noch, daß es jetzt außer
allem Zweifel steht, daß dasselbe identisch
ist mit dem im Germanischen Museum
unter Nr. 146 stehenden Bild Barth.
Zeitbloms, welches, wie alle älteren Ka-
taloge^der Pinakothek Nachweisen, im Jahr
1803 aus dem Ulmer Wengenkloster in
den : Besitz des bayerischen Staats kam.
Die Zweifel, die man gehegt hat, beruhen
ans der falschen Uebersetzung der ange-
führten Stelle, welche nicht sagt, das Bild
sei ans Leinwand, sondern im Gegenteil
auf Holz gemalt, denn ans demselben
Grunde wurde es wegen Gefährlichkeit
des Transportes der großen Tafel dem
Kurfürsten verweigert. Soviel zur Be-
richtigung meines Artikels im „Archiv für
christliche Kunst" 1893 Nr. 6.
Das Bild ist das einzige Werk Zeit-
bloms, welches sich urkundlich bis zum
Jahr 1613 zurnckoerfvlgen läßt. Im
vorigen Jahrhundert war der Name des
Künstlers ganz verschollen, es nimmt daher
nicht wunder, wenn der Prälat Michael
Kuen es für eine» Martin Schön anö-
giebt, denn zu seiner Zeit kannte man den
Namen Zeitbloms nicht mebr; die ganze
alte Kunstgeschichte beschränkt sich ans die
beiden Namen Dürer und Schön, welch'
letzterer von Sandrat als von Kalendach
oder Knlmbach in Franken gebürtig an-
gegeben wird. Von Interesse ist weiter
die Entdeckung des Or. Händke, welche
sich in den Mitteilungen des Germ. Mu-
seums von 1888 findet, nämlich die Wahr-
nehmung, daß das Bild dem Holzschnitt
Albrecht Dürers in der großen Passion
<13. 13) entspricht. Es ist das wieder
ein Beweis, daß die größten Meister sich
nicht scheuten, nach Kupferstichen und
Holzschnitten anderer zu arbeiten. Format
und Gegenstand des Bildes lassen der
Vermutung Raum, daß es nicht als Altar-
blatt oder Flügel, sondern als Votivbild
für einen Verstorbenen angefertigt wurde.
Viele alte Gemälde, wie uns Haiv
1786 berichtet, waren in den Gängen und
Zimmern des Klosters. Damit stimmt
überein, was Weyermann im Kunstblatt
1830 mitteilt: man habe nach Säkulari-
sierung des Klosters einen ganzen Leiter-
wagen voll Bilder fortgeschafft, die alle
zusammen um 13 sl. an einen Bürger zu
Ulm losgeschlagen wurden.
Die weitläufigen Klostergebäude schließen
zwei geräumige Höfe nebst Kreuzgang in
sich. Das Hauptgebäude wurde durch
Abt Michael Kuen 1754—65 erbaut.
An dem kleinen Portal in der Wengen-
gasse ist das Wappen des Abts Michael
Beck (1635—82) in Stein eingehanen.
Im Hof sieht man noch Spuren von
Fresken aus der Zopfzeit und eine steinerne
weibliche Figur mit erhobener Rechten,
deren Bedeutung nicht zu bestimmen ist.
Der ehemalige Speisesaal im Hauptge-
bäude hat einen schönen Stnckplasond und
eine Thüre im inneren Hof zeigt das
Wappen des Abts Erath von Erathsberg
(1693— 1736) und das Distichon:
„Nrima in fronte I. ... st construxerat aeciea
-ruAnstinus txratli Hui repnrnbat ernt."
Ter Hintere große Stadel an der Ulmer-
gasse stammt noch aus golischerZeit, der steile
Staffelgiebel ist mit Maßweikverzierunge»
ans gebrannten Ziegeln bekleidet, wie
man es noch da und dort an alten Ulmer
Häusern findet. Am Treppentnrm gegen
den Hof ist der hl. Michael gemalt mit
der Zahl 1783, darunter das Wappen
des Abts GregorinS Trantwein (1765—86).
Das nebenstehende Pfarrhaus von
dem Baumeister Daniel Plattner 1786
neu erbaut, trägt folgende kaum noch
lesbare Inschrift:
,,?roio§ntis EolleZii llnidus primo
reZiminis sui T^irno ßstcolnus I.
WenAensis lstlnrne prnelLtus.ül.i/ZO."
Darunter das Wappen des Abts Nikolaus
Bücher und des Wengenklosters (Werden-
bergsche Fahne und Helfensteiner Elefant).
Unter den Ulmer Klosterkirchen, sagt
Manch, war die der Augustiner zu den
Wengen (Vergl. d. Ulmer Alt.-Ver. 1870
S. 25) die reichste an Kunstwerken aller
Art, wie das Kloster sich auch durch den
Reichtum seiner Bibliothek, welche allein
nahezu 400 Werke vor dem Jahr 1500
gedruckt, enthalte» haben soll, anSzeichnete.
Der Chronist Wollaib erzählt in seinem
Ulmischen Paradiesgarten von einem dem
hl. Lnkns geweihten Altar, welcher im
Jahr 1402 drei Jahre nach der Grund-
steinlegung des Klosters von der Maler-
st Hier ist die Schrift schadhaft, es muß dort
der Name des betreffenden AbtS stehen.