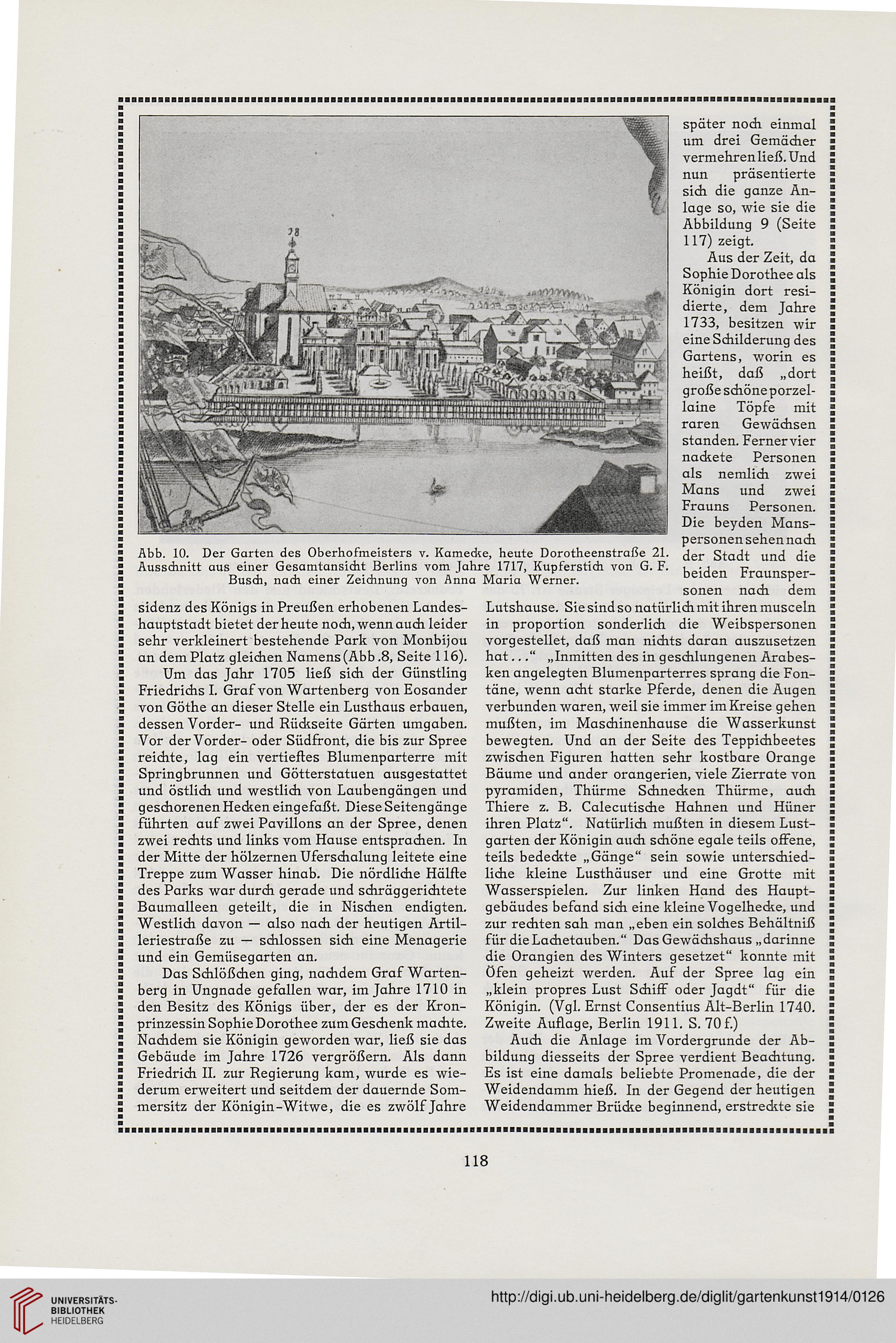später noch einmal
um drei Gemächer
vermehren ließ. Und
nun präsentierte
sich die ganze An-
lage so, wie sie die
Abbildung 9 (Seite
117) zeigt.
Aus der Zeit, da
Sophie Dorothee als
Königin dort resi-
dierte, dem Jahre
1733, besitzen wir
eine Schilderung des
Gartens, worin es
heißt, daß „dort
große schöne porzel-
laine Töpfe mit
raren Gewächsen
standen. Ferner vier
nackete Personen
als nemlich zwei
Mans und zwei
Frauns Personen.
Die beyden Mans-
personen sehen nach
Abb. 10. Der Garten des Oberhofmeisters v. Kamecke, heute Dorotheenstraße 21. ^er Stadt und die
Ausschnitt aus einer Gesamtansicht Berlins vom Jahre 1717, Kupferstich von G. F. i • j-c
Busch, nach einer Zeichnung von Anna Maria Werner. Deiaen rraunsper-
sonen nach dem
sidenz des Königs in Preußen erhobenen Landes- Lutshause. Sie sind so natürlich mit ihren musceln
hauptstadt bietet der heute noch, wenn auch leider in proportion sonderlich die Weibspersonen
sehr verkleinert bestehende Park von Monbijou vorgestellet, daß man nichts daran auszusetzen
an dem Platz gleichen Namens (Abb .8, Seite 116). hat..." „Inmitten des in geschlungenen Arabes-
Um das Jahr 1705 ließ sich der Günstling ken angelegten Blumenparterres sprang die Fon-
Friedrichs I. Graf von Wartenberg von Eosander täne, wenn acht starke Pferde, denen die Augen
von Göthe an dieser Stelle ein Lusthaus erbauen, verbunden waren, weil sie immer im Kreise gehen
dessen Vorder- und Rückseite Gärten umgaben, mußten, im Maschinenhause die Wasserkunst
Vor der Vorder- oder Südfront, die bis zur Spree bewegten. Und an der Seite des Teppichbeetes
reichte, lag ein vertieftes Blumenparterre mit zwischen Figuren hatten sehr kostbare Orange
Springbrunnen und Götterstatuen ausgestattet Bäume und ander Orangerien, viele Zierrate von
und östlich und westlich von Laubengängen und pyramiden, Thürme Schnecken Thürme, auch
geschorenen Hecken eingefaßt. Diese Seitengänge Thiere z. B. Calecutische Hahnen und Hüner
führten auf zwei Pavillons an der Spree, denen ihren Platz". Natürlich mußten in diesem Lust-
zwei rechts und links vom Hause entsprachen. In garten der Königin auch schöne egale teils offene,
der Mitte der hölzernen Uferschalung leitete eine teils bedeckte „Gänge" sein sowie unterschied-
Treppe zum Wasser hinab. Die nördliche Hälfte liehe kleine Lusthäuser und eine Grotte mit
des Parks war durch gerade und schräggerichtete Wasserspielen. Zur linken Hand des Haupt-
Baumalleen geteilt, die in Nischen endigten, gebäudes befand sich eine kleine Vogelhecke, und
Westlich davon — also nach der heutigen Artil- zur rechten sah man „eben ein solches Behältniß
leriestraße zu — schlössen sich eine Menagerie für die Lachetauben." Das Gewächshaus „darinne
und ein Gemüsegarten an. die Orangien des Winters gesetzet" konnte mit
Das Schlößchen ging, nachdem Graf Warten- Öfen geheizt werden. Auf der Spree lag ein
berg in Ungnade gefallen war, im Jahre 1710 in „klein propres Lust Schiff oder Jagdt" für die
den Besitz des Königs über, der es der Krön- Königin. (Vgl. Ernst Consentius Alt-Berlin 1740.
Prinzessin Sophie Dorothee zum Geschenk machte. Zweite Auflage, Berlin 1911. S. 70f.)
Nachdem sie Königin geworden war, ließ sie das Auch die Anlage im Vordergrunde der Ab-
Gebäude im Jahre 1726 vergrößern. Als dann bildung diesseits der Spree verdient Beachtung.
Friedrich II. zur Regierung kam, wurde es wie- Es ist eine damals beliebte Promenade, die der
derum erweitert und seitdem der dauernde Som- Weidendamm hieß. In der Gegend der heutigen
mersitz der König in-Witwe, die es zwölf Jahre Weidendammer Brücke beginnend, erstreckte sie
118
um drei Gemächer
vermehren ließ. Und
nun präsentierte
sich die ganze An-
lage so, wie sie die
Abbildung 9 (Seite
117) zeigt.
Aus der Zeit, da
Sophie Dorothee als
Königin dort resi-
dierte, dem Jahre
1733, besitzen wir
eine Schilderung des
Gartens, worin es
heißt, daß „dort
große schöne porzel-
laine Töpfe mit
raren Gewächsen
standen. Ferner vier
nackete Personen
als nemlich zwei
Mans und zwei
Frauns Personen.
Die beyden Mans-
personen sehen nach
Abb. 10. Der Garten des Oberhofmeisters v. Kamecke, heute Dorotheenstraße 21. ^er Stadt und die
Ausschnitt aus einer Gesamtansicht Berlins vom Jahre 1717, Kupferstich von G. F. i • j-c
Busch, nach einer Zeichnung von Anna Maria Werner. Deiaen rraunsper-
sonen nach dem
sidenz des Königs in Preußen erhobenen Landes- Lutshause. Sie sind so natürlich mit ihren musceln
hauptstadt bietet der heute noch, wenn auch leider in proportion sonderlich die Weibspersonen
sehr verkleinert bestehende Park von Monbijou vorgestellet, daß man nichts daran auszusetzen
an dem Platz gleichen Namens (Abb .8, Seite 116). hat..." „Inmitten des in geschlungenen Arabes-
Um das Jahr 1705 ließ sich der Günstling ken angelegten Blumenparterres sprang die Fon-
Friedrichs I. Graf von Wartenberg von Eosander täne, wenn acht starke Pferde, denen die Augen
von Göthe an dieser Stelle ein Lusthaus erbauen, verbunden waren, weil sie immer im Kreise gehen
dessen Vorder- und Rückseite Gärten umgaben, mußten, im Maschinenhause die Wasserkunst
Vor der Vorder- oder Südfront, die bis zur Spree bewegten. Und an der Seite des Teppichbeetes
reichte, lag ein vertieftes Blumenparterre mit zwischen Figuren hatten sehr kostbare Orange
Springbrunnen und Götterstatuen ausgestattet Bäume und ander Orangerien, viele Zierrate von
und östlich und westlich von Laubengängen und pyramiden, Thürme Schnecken Thürme, auch
geschorenen Hecken eingefaßt. Diese Seitengänge Thiere z. B. Calecutische Hahnen und Hüner
führten auf zwei Pavillons an der Spree, denen ihren Platz". Natürlich mußten in diesem Lust-
zwei rechts und links vom Hause entsprachen. In garten der Königin auch schöne egale teils offene,
der Mitte der hölzernen Uferschalung leitete eine teils bedeckte „Gänge" sein sowie unterschied-
Treppe zum Wasser hinab. Die nördliche Hälfte liehe kleine Lusthäuser und eine Grotte mit
des Parks war durch gerade und schräggerichtete Wasserspielen. Zur linken Hand des Haupt-
Baumalleen geteilt, die in Nischen endigten, gebäudes befand sich eine kleine Vogelhecke, und
Westlich davon — also nach der heutigen Artil- zur rechten sah man „eben ein solches Behältniß
leriestraße zu — schlössen sich eine Menagerie für die Lachetauben." Das Gewächshaus „darinne
und ein Gemüsegarten an. die Orangien des Winters gesetzet" konnte mit
Das Schlößchen ging, nachdem Graf Warten- Öfen geheizt werden. Auf der Spree lag ein
berg in Ungnade gefallen war, im Jahre 1710 in „klein propres Lust Schiff oder Jagdt" für die
den Besitz des Königs über, der es der Krön- Königin. (Vgl. Ernst Consentius Alt-Berlin 1740.
Prinzessin Sophie Dorothee zum Geschenk machte. Zweite Auflage, Berlin 1911. S. 70f.)
Nachdem sie Königin geworden war, ließ sie das Auch die Anlage im Vordergrunde der Ab-
Gebäude im Jahre 1726 vergrößern. Als dann bildung diesseits der Spree verdient Beachtung.
Friedrich II. zur Regierung kam, wurde es wie- Es ist eine damals beliebte Promenade, die der
derum erweitert und seitdem der dauernde Som- Weidendamm hieß. In der Gegend der heutigen
mersitz der König in-Witwe, die es zwölf Jahre Weidendammer Brücke beginnend, erstreckte sie
118