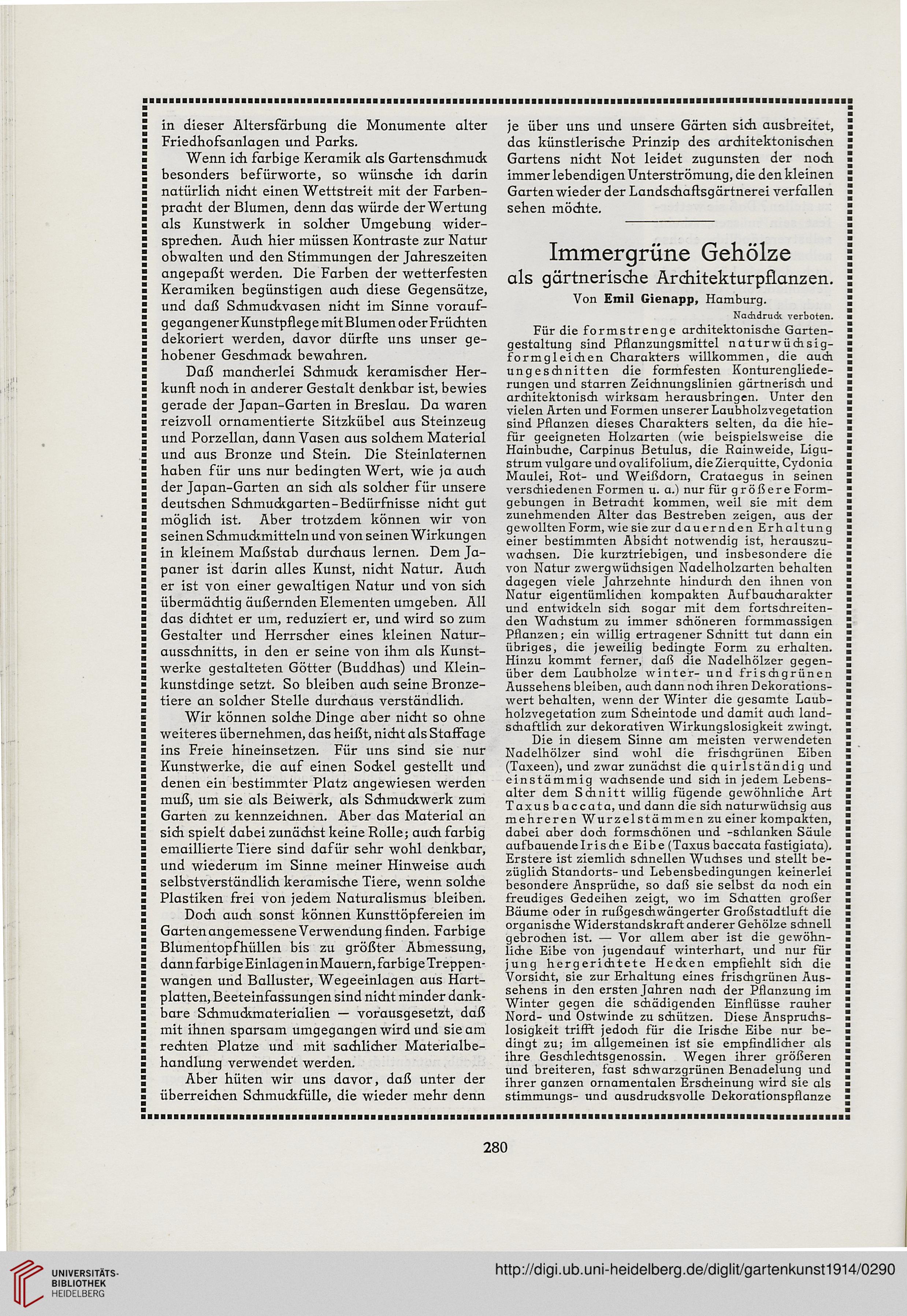in dieser Altersfärbung die Monumente alter
Friedhofsanlagen und Parks.
Wenn ich farbige Keramik als Gartenschmuck
besonders befürworte, so wünsche ich darin
natürlich nicht einen Wettstreit mit der Farben-
pracht der Blumen, denn das würde der Wertung
als Kunstwerk in solcher Umgebung wider-
sprechen. Auch hier müssen Kontraste zur Natur
obwalten und den Stimmungen der Jahreszeiten
angepaßt werden. Die Farben der wetterfesten
Keramiken begünstigen auch diese Gegensätze,
und daß Schmuckvasen nicht im Sinne vorauf-
gegangener Kunstpfleg e mit Blumen oder Früchten
dekoriert werden, davor dürfte uns unser ge-
hobener Geschmack bewahren.
Daß mancherlei Schmuck keramischer Her-
kunft noch in anderer Gestalt denkbar ist, bewies
gerade der Japan-Garten in Breslau. Da waren
reizvoll ornamentierte Sitzkübel aus Steinzeug
und Porzellan, dann Vasen aus solchem Material
und aus Bronze und Stein. Die Steinlaternen
haben für uns nur bedingten Wert, wie ja auch
der Japan-Garten an sich als solcher für unsere
deutschen Schmuckgarten-Bedürfnisse nicht gut
möglich ist. Aber trotzdem können wir von
seinen Schmuckmitteln und von seinen Wirkung en
in kleinem Maßstab durchaus lernen. Dem Ja-
paner ist darin alles Kunst, nicht Natur. Auch
er ist von einer gewaltigen Natur und von sich
übermächtig äußernden Elementen umgeben. All
das dichtet er um, reduziert er, und wird so zum
Gestalter und Herrscher eines kleinen Natur-
ausschnitts, in den er seine von ihm als Kunst-
werke gestalteten Götter (Buddhas) und Klein-
kunstdinge setzt. So bleiben auch seine Bronze-
tiere an solcher Stelle durchaus verständlich.
Wir können solche Dinge aber nicht so ohne
weiteres üb ernehmen, das heißt, nicht als Staffag e
ins Freie hineinsetzen. Für uns sind sie nur
Kunstwerke, die auf einen Sockel gestellt und
denen ein bestimmter Platz angewiesen werden
muß, um sie als Beiwerk, als Schmuckwerk zum
Garten zu kennzeichnen. Aber das Material an
sich spielt dabei zunächst keine Rolle; auch farbig
emaillierte Tiere sind dafür sehr wohl denkbar,
und wiederum im Sinne meiner Hinweise auch
selbstverständlich keramische Tiere, wenn solche
Plastiken frei von jedem Naturalismus bleiben.
Doch auch sonst können Kunsttöpfereien im
Gartenangemessene Verwendung finden. Farbige
Blumentopfhüllen bis zu größter Abmessung,
dann farbig e Einlag en inMauern, farbig e Treppen-
wangen und Balluster, Wegeeinlagen aus Hart-
platten, Beeteinfassungen sind nicht minder dank-
bare Schmuckmaterialien — vorausgesetzt, daß
mit ihnen sparsam umgegangen wird und sie am
rechten Platze und mit sachlicher Materialbe-
handlung verwendet werden.
Aber hüten wir uns davor, daß unter der
überreichen Schmuckfülle, die wieder mehr denn
je über uns und unsere Gärten sich ausbreitet,
das künstlerische Prinzip des architektonischen
Gartens nicht Not leidet zugunsten der noch
immer lebendigen Unterströmung, die den kleinen
Garten wieder der Landschaftsgärtnerei verfallen
sehen möchte.
Immergrüne Gehölze
als gärtnerische Architekturpflanzen.
Von Emil Gienapp, Hamburg.
Nadidrudt verboten.
Für die formstrenge architektonische Garten-
gestaltung sind Pflanzungsmittel naturwüchsig-
formgleichen Charakters willkommen, die auch
ungeschnitten die formfesten Konturengliede-
rungen und starren Zeichnungslinien gärtnerisch und
architektonisch wirksam herausbringen. Unter den
vielen Arten und Formen unserer Laubholzvegetation
sind Pflanzen dieses Charakters selten, da die hie-
für geeigneten Holzarten (wie beispielsweise die
Hainbuche, Carpinus Betulus, die Rainweide, Ligu-
strum vulgare und ovalifolium, die Zierquitte, Cydonia
Maulei, Rot- und Weißdorn, Crataegus in seinen
verschiedenen Formen u. a.) nur für größere Form-
gebungen in Betracht kommen, weil sie mit dem
zunehmenden Alter das Bestreben zeigen, aus der
gewollten Form, wie sie zur dauernden Erhaltung
einer bestimmten Absicht notwendig ist, herauszu-
wachsen. Die kurztriebigen, und insbesondere die
von Natur zwergwüdisigen Nadelholzarten behalten
dagegen viele Jahrzehnte hindurch den ihnen von
Natur eigentümlichen kompakten Aufbaucharakter
und entwickeln sich sogar mit dem fortschreiten-
den Wachstum zu immer schöneren formmassigen
Pflanzen; ein willig ertragener Schnitt tut dann ein
übriges, die jeweilig bedingte Form zu erhalten.
Hinzu kommt ferner, daß die Nadelhölzer gegen-
über dem Laubholze winter- und frischgrünen
Aussehens bleiben, auch dann nodi ihren Dekorations-
wert behalten, wenn der Winter die gesamte Laub-
holzvegetation zum Scheintode und damit auch land-
schaftlich zur dekorativen Wirkungslosigkeit zwingt.
Die in diesem Sinne am meisten verwendeten
Nadelhölzer sind wohl die frischgrünen Eiben
(Taxeen), und zwar zunächst die quirlständig und
einstämmig wachsende und sich in jedem Lebens-
alter dem Schnitt willig fügende gewöhnliche Art
Taxusbaccata, und dann die sich naturwüchsig aus
mehreren Wurzelstämmen zu einer kompakten,
dabei aber doch formschönen und -schlanken Säule
aufbauende Iris die Eibe (Taxus baccata fastigiata).
Erstere ist ziemlich schnellen Wuchses und stellt be-
züglich Standorts- und Lebensbedingungen keinerlei
besondere Ansprüche, so daß sie selbst da noch ein
freudiges Gedeihen zeigt, wo im Sdiatten großer
Bäume oder in rußgeschwängerter Großstadtluft die
organische Widerstandskraft anderer Gehölze schnell
gebrochen ist. — Vor allem aber ist die gewöhn-
liche Eibe von jugendauf winterhart, und nur für
jung hergerichtete Hecken empfiehlt sich die
Vorsicht, sie zur Erhaltung eines frischgrünen Aus-
sehens in den ersten Jahren nach der Pflanzung im
Winter gegen die schädigenden Einflüsse rauher
Nord- und Ostwinde zu schützen. Diese Anspruchs-
losigkeit trifft jedoch für die Irische Eibe nur be-
dingt zu; im allgemeinen ist sie empfindlicher als
ihre Geschlechtsgenossin. Wegen ihrer größeren
und breiteren, fast schwarzgrünen Benadelung und
ihrer ganzen ornamentalen Erscheinung wird sie als
stimmungs- und ausdrucksvolle Dekorationspflanze
280
Friedhofsanlagen und Parks.
Wenn ich farbige Keramik als Gartenschmuck
besonders befürworte, so wünsche ich darin
natürlich nicht einen Wettstreit mit der Farben-
pracht der Blumen, denn das würde der Wertung
als Kunstwerk in solcher Umgebung wider-
sprechen. Auch hier müssen Kontraste zur Natur
obwalten und den Stimmungen der Jahreszeiten
angepaßt werden. Die Farben der wetterfesten
Keramiken begünstigen auch diese Gegensätze,
und daß Schmuckvasen nicht im Sinne vorauf-
gegangener Kunstpfleg e mit Blumen oder Früchten
dekoriert werden, davor dürfte uns unser ge-
hobener Geschmack bewahren.
Daß mancherlei Schmuck keramischer Her-
kunft noch in anderer Gestalt denkbar ist, bewies
gerade der Japan-Garten in Breslau. Da waren
reizvoll ornamentierte Sitzkübel aus Steinzeug
und Porzellan, dann Vasen aus solchem Material
und aus Bronze und Stein. Die Steinlaternen
haben für uns nur bedingten Wert, wie ja auch
der Japan-Garten an sich als solcher für unsere
deutschen Schmuckgarten-Bedürfnisse nicht gut
möglich ist. Aber trotzdem können wir von
seinen Schmuckmitteln und von seinen Wirkung en
in kleinem Maßstab durchaus lernen. Dem Ja-
paner ist darin alles Kunst, nicht Natur. Auch
er ist von einer gewaltigen Natur und von sich
übermächtig äußernden Elementen umgeben. All
das dichtet er um, reduziert er, und wird so zum
Gestalter und Herrscher eines kleinen Natur-
ausschnitts, in den er seine von ihm als Kunst-
werke gestalteten Götter (Buddhas) und Klein-
kunstdinge setzt. So bleiben auch seine Bronze-
tiere an solcher Stelle durchaus verständlich.
Wir können solche Dinge aber nicht so ohne
weiteres üb ernehmen, das heißt, nicht als Staffag e
ins Freie hineinsetzen. Für uns sind sie nur
Kunstwerke, die auf einen Sockel gestellt und
denen ein bestimmter Platz angewiesen werden
muß, um sie als Beiwerk, als Schmuckwerk zum
Garten zu kennzeichnen. Aber das Material an
sich spielt dabei zunächst keine Rolle; auch farbig
emaillierte Tiere sind dafür sehr wohl denkbar,
und wiederum im Sinne meiner Hinweise auch
selbstverständlich keramische Tiere, wenn solche
Plastiken frei von jedem Naturalismus bleiben.
Doch auch sonst können Kunsttöpfereien im
Gartenangemessene Verwendung finden. Farbige
Blumentopfhüllen bis zu größter Abmessung,
dann farbig e Einlag en inMauern, farbig e Treppen-
wangen und Balluster, Wegeeinlagen aus Hart-
platten, Beeteinfassungen sind nicht minder dank-
bare Schmuckmaterialien — vorausgesetzt, daß
mit ihnen sparsam umgegangen wird und sie am
rechten Platze und mit sachlicher Materialbe-
handlung verwendet werden.
Aber hüten wir uns davor, daß unter der
überreichen Schmuckfülle, die wieder mehr denn
je über uns und unsere Gärten sich ausbreitet,
das künstlerische Prinzip des architektonischen
Gartens nicht Not leidet zugunsten der noch
immer lebendigen Unterströmung, die den kleinen
Garten wieder der Landschaftsgärtnerei verfallen
sehen möchte.
Immergrüne Gehölze
als gärtnerische Architekturpflanzen.
Von Emil Gienapp, Hamburg.
Nadidrudt verboten.
Für die formstrenge architektonische Garten-
gestaltung sind Pflanzungsmittel naturwüchsig-
formgleichen Charakters willkommen, die auch
ungeschnitten die formfesten Konturengliede-
rungen und starren Zeichnungslinien gärtnerisch und
architektonisch wirksam herausbringen. Unter den
vielen Arten und Formen unserer Laubholzvegetation
sind Pflanzen dieses Charakters selten, da die hie-
für geeigneten Holzarten (wie beispielsweise die
Hainbuche, Carpinus Betulus, die Rainweide, Ligu-
strum vulgare und ovalifolium, die Zierquitte, Cydonia
Maulei, Rot- und Weißdorn, Crataegus in seinen
verschiedenen Formen u. a.) nur für größere Form-
gebungen in Betracht kommen, weil sie mit dem
zunehmenden Alter das Bestreben zeigen, aus der
gewollten Form, wie sie zur dauernden Erhaltung
einer bestimmten Absicht notwendig ist, herauszu-
wachsen. Die kurztriebigen, und insbesondere die
von Natur zwergwüdisigen Nadelholzarten behalten
dagegen viele Jahrzehnte hindurch den ihnen von
Natur eigentümlichen kompakten Aufbaucharakter
und entwickeln sich sogar mit dem fortschreiten-
den Wachstum zu immer schöneren formmassigen
Pflanzen; ein willig ertragener Schnitt tut dann ein
übriges, die jeweilig bedingte Form zu erhalten.
Hinzu kommt ferner, daß die Nadelhölzer gegen-
über dem Laubholze winter- und frischgrünen
Aussehens bleiben, auch dann nodi ihren Dekorations-
wert behalten, wenn der Winter die gesamte Laub-
holzvegetation zum Scheintode und damit auch land-
schaftlich zur dekorativen Wirkungslosigkeit zwingt.
Die in diesem Sinne am meisten verwendeten
Nadelhölzer sind wohl die frischgrünen Eiben
(Taxeen), und zwar zunächst die quirlständig und
einstämmig wachsende und sich in jedem Lebens-
alter dem Schnitt willig fügende gewöhnliche Art
Taxusbaccata, und dann die sich naturwüchsig aus
mehreren Wurzelstämmen zu einer kompakten,
dabei aber doch formschönen und -schlanken Säule
aufbauende Iris die Eibe (Taxus baccata fastigiata).
Erstere ist ziemlich schnellen Wuchses und stellt be-
züglich Standorts- und Lebensbedingungen keinerlei
besondere Ansprüche, so daß sie selbst da noch ein
freudiges Gedeihen zeigt, wo im Sdiatten großer
Bäume oder in rußgeschwängerter Großstadtluft die
organische Widerstandskraft anderer Gehölze schnell
gebrochen ist. — Vor allem aber ist die gewöhn-
liche Eibe von jugendauf winterhart, und nur für
jung hergerichtete Hecken empfiehlt sich die
Vorsicht, sie zur Erhaltung eines frischgrünen Aus-
sehens in den ersten Jahren nach der Pflanzung im
Winter gegen die schädigenden Einflüsse rauher
Nord- und Ostwinde zu schützen. Diese Anspruchs-
losigkeit trifft jedoch für die Irische Eibe nur be-
dingt zu; im allgemeinen ist sie empfindlicher als
ihre Geschlechtsgenossin. Wegen ihrer größeren
und breiteren, fast schwarzgrünen Benadelung und
ihrer ganzen ornamentalen Erscheinung wird sie als
stimmungs- und ausdrucksvolle Dekorationspflanze
280