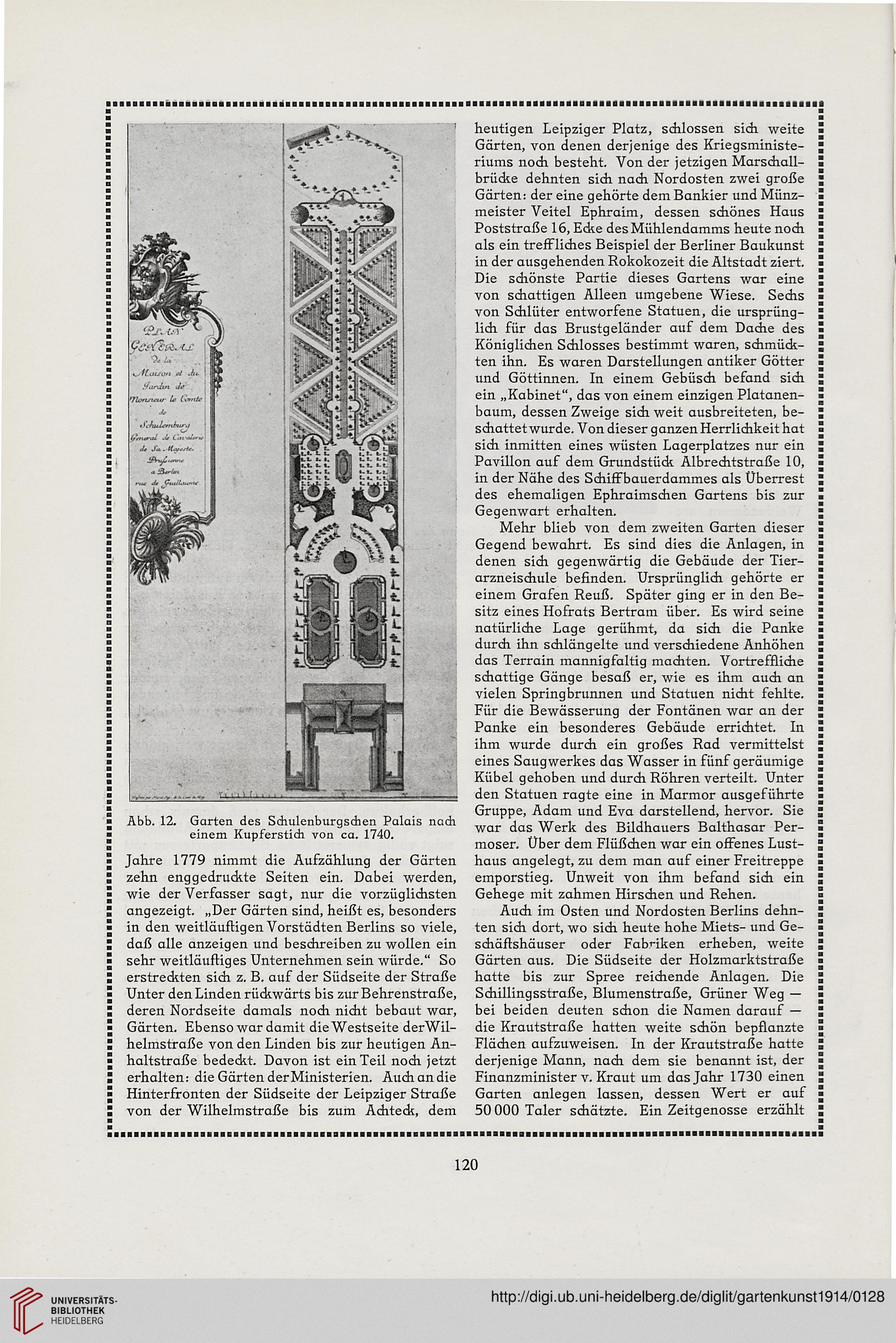Abb. 12. Garten des Schulenburgschen Palais nach
einem Kupferstich von ca. 1740.
Jahre 1779 nimmt die Aufzählung der Gärten
zehn enggedruckte Seiten ein. Dabei werden,
wie der Verfasser sagt, nur die vorzüglichsten
angezeigt. „Der Gärten sind, heißt es, besonders
in den weitläuftigen Vorstädten Berlins so viele,
daß alle anzeigen und beschreiben zu wollen ein
sehr weitläufiges Unternehmen sein würde." So
erstreckten sich z. B. auf der Südseite der Straße
Unter den Linden rückwärts bis zur Behrenstraße,
deren Nordseite damals noch nicht bebaut war,
Gärten. Ebenso war damit die Westseite derWil-
helmstraße von den Linden bis zur heutigen An-
haltstraße bedeckt. Davon ist ein Teil noch jetzt
erhalten: die Gärten der Ministerien. Auch an die
Hinterfronten der Südseite der Leipziger Straße
von der Wilhelmstraße bis zum Achteck, dem
heutigen Leipziger Platz, schlössen sich weite
Gärten, von denen derjenige des Kriegsministe-
riums noch besteht. Von der jetzigen Marschall-
brücke dehnten sich nach Nordosten zwei große
Gärten: der eine gehörte dem Bankier und Münz-
meister Veitel Ephraim, dessen schönes Haus
Poststraße 16, Ecke des Mühlendamms heute noch
als ein treffliches Beispiel der Berliner Baukunst
in der ausgehenden Rokokozeit die Altstadt ziert.
Die schönste Partie dieses Gartens war eine
von schattigen Alleen umgebene Wiese. Sechs
von Schlüter entworfene Statuen, die ursprüng-
lich für das Brustgeländer auf dem Dache des
Königlichen Schlosses bestimmt waren, schmück-
ten ihn. Es waren Darstellungen antiker Götter
und Göttinnen. In einem Gebüsch befand sich
ein „Kabinet", das von einem einzigen Platanen-
baum, dessen Zweige sich weit ausbreiteten, be-
schattet wurde. Von dieser ganzen Herrlichkeit hat
sich inmitten eines wüsten Lagerplatzes nur ein
Pavillon auf dem Grundstück Albrechtstraße 10,
in der Nähe des Schiff bauerdammes als Überrest
des ehemaligen Ephraimschen Gartens bis zur
Gegenwart erhalten.
Mehr blieb von dem zweiten Garten dieser
Gegend bewahrt. Es sind dies die Anlagen, in
denen sich gegenwärtig die Gebäude der Tier-
arzneischule befinden. Ursprünglich gehörte er
einem Grafen Reuß. Später ging er in den Be-
sitz eines Hofrats Bertram über. Es wird seine
natürliche Lage gerühmt, da sich die Panke
durch ihn schlängelte und verschiedene Anhöhen
das Terrain mannigfaltig machten. Vortreffliche
schattige Gänge besaß er, wie es ihm auch an
vielen Springbrunnen und Statuen nicht fehlte.
Für die Bewässerung der Fontänen war an der
Panke ein besonderes Gebäude errichtet. In
ihm wurde durch ein großes Rad vermittelst
eines Saug werkes das Wasser in fünf geräumige
Kübel gehoben und durch Röhren verteilt. Unter
den Statuen ragte eine in Marmor ausgeführte
Gruppe, Adam und Eva darstellend, hervor. Sie
war das Werk des Bildhauers Balthasar Per-
moser. Über dem Flüßchen war ein offenes Lust-
haus angelegt, zu dem man auf einer Freitreppe
emporstieg. Unweit von ihm befand sich ein
Gehege mit zahmen Hirschen und Rehen.
Auch im Osten und Nordosten Berlins dehn-
ten sich dort, wo sich heute hohe Miets- und Ge-
schäftshäuser oder Fabriken erheben, weite
Gärten aus. Die Südseite der Holzmarktstraße
hatte bis zur Spree reichende Anlagen. Die
Schillingsstraße, Blumenstraße, Grüner Weg —
bei beiden deuten schon die Namen darauf —
die Krautstraße hatten weite schön bepflanzte
Flächen aufzuweisen. In der Krautstraße hatte
derjenige Mann, nach dem sie benannt ist, der
Finanzminister v. Kraut um das Jahr 1730 einen
Garten anlegen lassen, dessen Wert er auf
50 000 Taler schätzte. Ein Zeitgenosse erzählt
120
einem Kupferstich von ca. 1740.
Jahre 1779 nimmt die Aufzählung der Gärten
zehn enggedruckte Seiten ein. Dabei werden,
wie der Verfasser sagt, nur die vorzüglichsten
angezeigt. „Der Gärten sind, heißt es, besonders
in den weitläuftigen Vorstädten Berlins so viele,
daß alle anzeigen und beschreiben zu wollen ein
sehr weitläufiges Unternehmen sein würde." So
erstreckten sich z. B. auf der Südseite der Straße
Unter den Linden rückwärts bis zur Behrenstraße,
deren Nordseite damals noch nicht bebaut war,
Gärten. Ebenso war damit die Westseite derWil-
helmstraße von den Linden bis zur heutigen An-
haltstraße bedeckt. Davon ist ein Teil noch jetzt
erhalten: die Gärten der Ministerien. Auch an die
Hinterfronten der Südseite der Leipziger Straße
von der Wilhelmstraße bis zum Achteck, dem
heutigen Leipziger Platz, schlössen sich weite
Gärten, von denen derjenige des Kriegsministe-
riums noch besteht. Von der jetzigen Marschall-
brücke dehnten sich nach Nordosten zwei große
Gärten: der eine gehörte dem Bankier und Münz-
meister Veitel Ephraim, dessen schönes Haus
Poststraße 16, Ecke des Mühlendamms heute noch
als ein treffliches Beispiel der Berliner Baukunst
in der ausgehenden Rokokozeit die Altstadt ziert.
Die schönste Partie dieses Gartens war eine
von schattigen Alleen umgebene Wiese. Sechs
von Schlüter entworfene Statuen, die ursprüng-
lich für das Brustgeländer auf dem Dache des
Königlichen Schlosses bestimmt waren, schmück-
ten ihn. Es waren Darstellungen antiker Götter
und Göttinnen. In einem Gebüsch befand sich
ein „Kabinet", das von einem einzigen Platanen-
baum, dessen Zweige sich weit ausbreiteten, be-
schattet wurde. Von dieser ganzen Herrlichkeit hat
sich inmitten eines wüsten Lagerplatzes nur ein
Pavillon auf dem Grundstück Albrechtstraße 10,
in der Nähe des Schiff bauerdammes als Überrest
des ehemaligen Ephraimschen Gartens bis zur
Gegenwart erhalten.
Mehr blieb von dem zweiten Garten dieser
Gegend bewahrt. Es sind dies die Anlagen, in
denen sich gegenwärtig die Gebäude der Tier-
arzneischule befinden. Ursprünglich gehörte er
einem Grafen Reuß. Später ging er in den Be-
sitz eines Hofrats Bertram über. Es wird seine
natürliche Lage gerühmt, da sich die Panke
durch ihn schlängelte und verschiedene Anhöhen
das Terrain mannigfaltig machten. Vortreffliche
schattige Gänge besaß er, wie es ihm auch an
vielen Springbrunnen und Statuen nicht fehlte.
Für die Bewässerung der Fontänen war an der
Panke ein besonderes Gebäude errichtet. In
ihm wurde durch ein großes Rad vermittelst
eines Saug werkes das Wasser in fünf geräumige
Kübel gehoben und durch Röhren verteilt. Unter
den Statuen ragte eine in Marmor ausgeführte
Gruppe, Adam und Eva darstellend, hervor. Sie
war das Werk des Bildhauers Balthasar Per-
moser. Über dem Flüßchen war ein offenes Lust-
haus angelegt, zu dem man auf einer Freitreppe
emporstieg. Unweit von ihm befand sich ein
Gehege mit zahmen Hirschen und Rehen.
Auch im Osten und Nordosten Berlins dehn-
ten sich dort, wo sich heute hohe Miets- und Ge-
schäftshäuser oder Fabriken erheben, weite
Gärten aus. Die Südseite der Holzmarktstraße
hatte bis zur Spree reichende Anlagen. Die
Schillingsstraße, Blumenstraße, Grüner Weg —
bei beiden deuten schon die Namen darauf —
die Krautstraße hatten weite schön bepflanzte
Flächen aufzuweisen. In der Krautstraße hatte
derjenige Mann, nach dem sie benannt ist, der
Finanzminister v. Kraut um das Jahr 1730 einen
Garten anlegen lassen, dessen Wert er auf
50 000 Taler schätzte. Ein Zeitgenosse erzählt
120