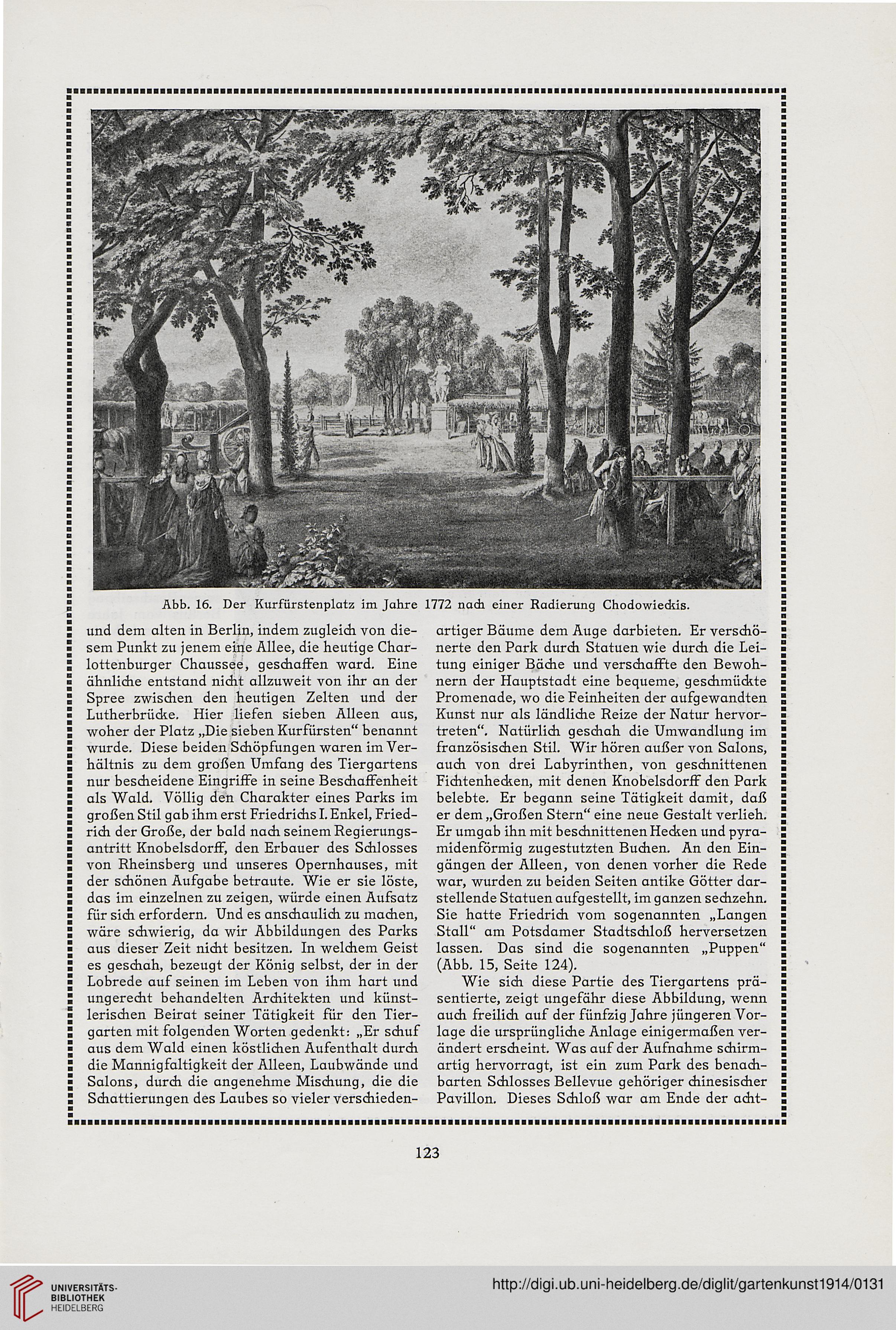Abb. 16. Der Kurfürstenplatz im Jahre 1772 nach einer Radierung Chodowieckis.
und dem alten in Berlin, indem zugleich von die-
sem Punkt zu jenem eine Allee, die heutige Char-
lottenburger Chaussee, geschaffen ward. Eine
ähnliche entstand nicht allzuweit von ihr an der
Spree zwischen den heutigen Zelten und der
Lutherbrücke. Hier liefen sieben Alleen aus,
woher der Platz „Die sieben Kurfürsten" benannt
wurde. Diese beiden Schöpfungen waren im Ver-
hältnis zu dem großen Umfang des Tiergartens
nur bescheidene Eingriffe in seine Beschaffenheit
als Wald. Völlig den Charakter eines Parks im
großen Stil gab ihm erst Friedrichs I. Enkel, Fried-
rich der Große, der bald nach seinem Regierungs-
antritt Knobelsdorff, den Erbauer des Schlosses
von Rheinsberg und unseres Opernhauses, mit
der schönen Aufgabe betraute. Wie er sie löste,
das im einzelnen zu zeigen, würde einen Aufsatz
für sich erfordern. Und es anschaulich zu machen,
wäre schwierig, da wir Abbildungen des Parks
aus dieser Zeit nicht besitzen. In welchem Geist
es geschah, bezeugt der König selbst, der in der
Lobrede auf seinen im Leben von ihm hart und
ungerecht behandelten Architekten und künst-
lerischen Beirat seiner Tätigkeit für den Tier-
garten mit folgenden Worten gedenkt: „Er schuf
aus dem Wald einen köstlichen Aufenthalt durch
die Mannigfaltigkeit der Alleen, Laubwände und
Salons, durch die angenehme Mischung, die die
Schattierungen des Laubes so vieler verschieden-
artiger Bäume dem Auge darbieten. Er verschö-
nerte den Park durch Statuen wie durch die Lei-
tung einiger Bäche und verschaffte den Bewoh-
nern der Hauptstadt eine bequeme, geschmückte
Promenade, wo die Feinheiten der aufgewandten
Kunst nur als ländliche Reize der Natur hervor-
treten". Natürlich geschah die Umwandlung im
französischen Stil. Wir hören außer von Salons,
auch von drei Labyrinthen, von geschnittenen
Fichtenhecken, mit denen Knobelsdorff den Park
belebte. Er begann seine Tätigkeit damit, daß
er dem „Großen Stern" eine neue Gestalt verlieh.
Er umgab ihn mit beschnittenen Hecken und pyra-
midenförmig zugestutzten Buchen. An den Ein-
gängen der Alleen, von denen vorher die Rede
war, wurden zu beiden Seiten antike Götter dar-
stellende Statuen aufgestellt, im ganzen sechzehn.
Sie hatte Friedrich vom sogenannten „Langen
Stall" am Potsdamer Stadtschloß herversetzen
lassen. Das sind die sogenannten „Puppen"
(Abb. 15, Seite 124).
Wie sich diese Partie des Tiergartens prä-
sentierte, zeigt ungefähr diese Abbildung, wenn
auch freilich auf der fünfzig Jahre jüngeren Vor-
lage die ursprüngliche Anlage einigermaßen ver-
ändert erscheint. Was auf der Aufnahme schirm-
artig hervorragt, ist ein zum Park des benach-
barten Schlosses Bellevue gehöriger chinesischer
Pavillon. Dieses Schloß war am Ende der acht-
123
und dem alten in Berlin, indem zugleich von die-
sem Punkt zu jenem eine Allee, die heutige Char-
lottenburger Chaussee, geschaffen ward. Eine
ähnliche entstand nicht allzuweit von ihr an der
Spree zwischen den heutigen Zelten und der
Lutherbrücke. Hier liefen sieben Alleen aus,
woher der Platz „Die sieben Kurfürsten" benannt
wurde. Diese beiden Schöpfungen waren im Ver-
hältnis zu dem großen Umfang des Tiergartens
nur bescheidene Eingriffe in seine Beschaffenheit
als Wald. Völlig den Charakter eines Parks im
großen Stil gab ihm erst Friedrichs I. Enkel, Fried-
rich der Große, der bald nach seinem Regierungs-
antritt Knobelsdorff, den Erbauer des Schlosses
von Rheinsberg und unseres Opernhauses, mit
der schönen Aufgabe betraute. Wie er sie löste,
das im einzelnen zu zeigen, würde einen Aufsatz
für sich erfordern. Und es anschaulich zu machen,
wäre schwierig, da wir Abbildungen des Parks
aus dieser Zeit nicht besitzen. In welchem Geist
es geschah, bezeugt der König selbst, der in der
Lobrede auf seinen im Leben von ihm hart und
ungerecht behandelten Architekten und künst-
lerischen Beirat seiner Tätigkeit für den Tier-
garten mit folgenden Worten gedenkt: „Er schuf
aus dem Wald einen köstlichen Aufenthalt durch
die Mannigfaltigkeit der Alleen, Laubwände und
Salons, durch die angenehme Mischung, die die
Schattierungen des Laubes so vieler verschieden-
artiger Bäume dem Auge darbieten. Er verschö-
nerte den Park durch Statuen wie durch die Lei-
tung einiger Bäche und verschaffte den Bewoh-
nern der Hauptstadt eine bequeme, geschmückte
Promenade, wo die Feinheiten der aufgewandten
Kunst nur als ländliche Reize der Natur hervor-
treten". Natürlich geschah die Umwandlung im
französischen Stil. Wir hören außer von Salons,
auch von drei Labyrinthen, von geschnittenen
Fichtenhecken, mit denen Knobelsdorff den Park
belebte. Er begann seine Tätigkeit damit, daß
er dem „Großen Stern" eine neue Gestalt verlieh.
Er umgab ihn mit beschnittenen Hecken und pyra-
midenförmig zugestutzten Buchen. An den Ein-
gängen der Alleen, von denen vorher die Rede
war, wurden zu beiden Seiten antike Götter dar-
stellende Statuen aufgestellt, im ganzen sechzehn.
Sie hatte Friedrich vom sogenannten „Langen
Stall" am Potsdamer Stadtschloß herversetzen
lassen. Das sind die sogenannten „Puppen"
(Abb. 15, Seite 124).
Wie sich diese Partie des Tiergartens prä-
sentierte, zeigt ungefähr diese Abbildung, wenn
auch freilich auf der fünfzig Jahre jüngeren Vor-
lage die ursprüngliche Anlage einigermaßen ver-
ändert erscheint. Was auf der Aufnahme schirm-
artig hervorragt, ist ein zum Park des benach-
barten Schlosses Bellevue gehöriger chinesischer
Pavillon. Dieses Schloß war am Ende der acht-
123