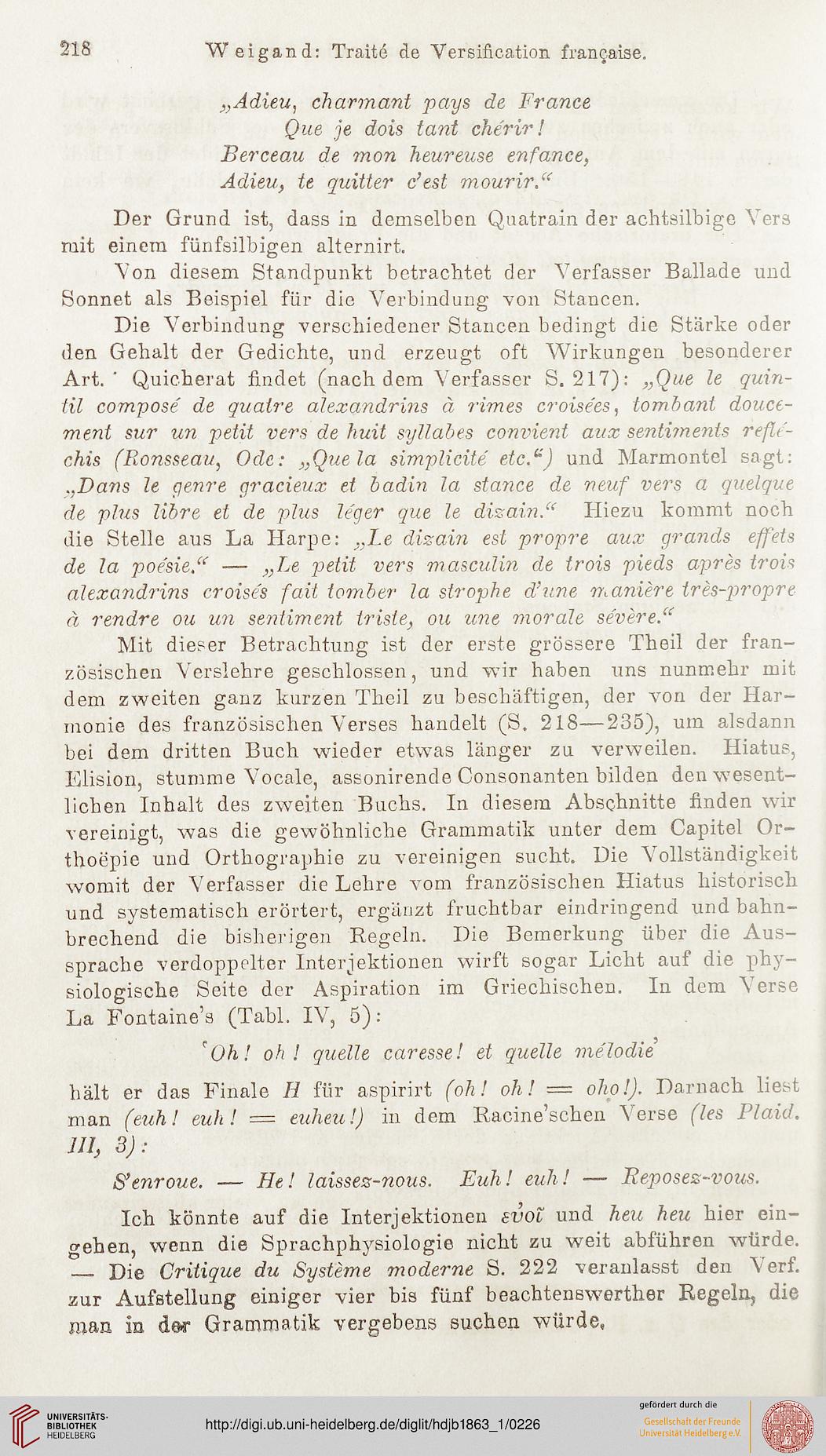218
W eigand: Traitä de Versification fran^aise.
„Adieu, charmant pays de France
Que je dois tant cherir!
JBerceau de mon heureuse enfance,
Adieu, te quitter Fest mourir.“
Der Grund ist, dass in demselben Quatrain der achtsilbige Vers
mit einem fünfsilbigen alternirt.
λ on diesem Standpunkt betrachtet der Verfasser Ballade und
Sonnet als Beispiel für die Verbindung von Stancen.
Die Verbindung verschiedener Stancen bedingt die Stärke oder
den Gehalt der Gedichte, und erzeugt oft Wirkungen besonderer
Art. ' Quicherat findet (nachdem Verfasser S. 217): „Que le quin-
til compose de quatre alexandrins ä rimes croisees, tombant douce-
ment sur un petit vers de huit syllabes convient aux sentiments refle-
chis (Ronsseau, Ode: „Que la simplicite etcF) und Marmontel sagt;
„Dans le genre gracieux et badin la stance de neuf vers a quelque
de plus libre et de plus leger que le dizain.“ Hiezu kommt noch
die Stelle aus La Harpe: „Le dizain est propre aux grands effets
de la poe'sie.“ — „Le petit vers masculin de trois pieds apres trois
alexandrins croises fait tomber la Strophe d’une maniere tres-propre
ä rendre ou un sentiment triste, ou une morale severe.“
Mit dieser Betrachtung ist der erste grössere Theil der fran-
zösischen Verslehre geschlossen, und wir haben uns nunmehr mit
dem zweiten ganz kurzen Theil zu beschäftigen, der von der Har-
monie des französischen Verses handelt (S. 218—235), um alsdann
bei dem dritten Buch wieder etwas länger zu verweilen. Hiatus,
Elision, stumme Vocale, assonirende Consonanten bilden den wesent-
lichen Inhalt des zweiten Buchs. In diesem Abschnitte finden wir
vereinigt, was die gewöhnliche Grammatik unter dem Capitel Or-
thoepie und Orthographie zu vereinigen sucht. Die Vollständigkeit
womit der Verfasser die Lehre vom französischen Hiatus historisch
und systematisch erörtert, ergänzt fruchtbar eindringend und bahn-
brechend die bisherigen Regeln. Die Bemerkung über die Aus-
sprache verdoppelter Interjektionen wirft sogar Licht auf die phy-
siologische Seite der Aspiration im Griechischen. In dem Verse
La Fontaine’s (Tabl. IV, 5):
'Oh! oh! quelle caresse! et quelle me'lodie
hält er das Finale H für aspirirt (oh! oh! — oho!). Darnach liest
man (euh! euh ! = eulieu!) in dem Racine’schen Verse (les Plaid.
Hl, 3):
S’enroue. — He! laissez-nous. Euh! euh! — Reposez-vous.
Ich könnte auf die Interjektionen ενοΐ und heu heu hier ein-
gehen, wenn die Sprachphysiologie nicht zu weit abführen würde.
— Die Critique du Systeme moderne S. 222 veranlasst den Verf.
zur Aufstellung einiger vier bis fünf beachtenswerther Regeln, die
man in der Grammatik vergebens suchen würde.
W eigand: Traitä de Versification fran^aise.
„Adieu, charmant pays de France
Que je dois tant cherir!
JBerceau de mon heureuse enfance,
Adieu, te quitter Fest mourir.“
Der Grund ist, dass in demselben Quatrain der achtsilbige Vers
mit einem fünfsilbigen alternirt.
λ on diesem Standpunkt betrachtet der Verfasser Ballade und
Sonnet als Beispiel für die Verbindung von Stancen.
Die Verbindung verschiedener Stancen bedingt die Stärke oder
den Gehalt der Gedichte, und erzeugt oft Wirkungen besonderer
Art. ' Quicherat findet (nachdem Verfasser S. 217): „Que le quin-
til compose de quatre alexandrins ä rimes croisees, tombant douce-
ment sur un petit vers de huit syllabes convient aux sentiments refle-
chis (Ronsseau, Ode: „Que la simplicite etcF) und Marmontel sagt;
„Dans le genre gracieux et badin la stance de neuf vers a quelque
de plus libre et de plus leger que le dizain.“ Hiezu kommt noch
die Stelle aus La Harpe: „Le dizain est propre aux grands effets
de la poe'sie.“ — „Le petit vers masculin de trois pieds apres trois
alexandrins croises fait tomber la Strophe d’une maniere tres-propre
ä rendre ou un sentiment triste, ou une morale severe.“
Mit dieser Betrachtung ist der erste grössere Theil der fran-
zösischen Verslehre geschlossen, und wir haben uns nunmehr mit
dem zweiten ganz kurzen Theil zu beschäftigen, der von der Har-
monie des französischen Verses handelt (S. 218—235), um alsdann
bei dem dritten Buch wieder etwas länger zu verweilen. Hiatus,
Elision, stumme Vocale, assonirende Consonanten bilden den wesent-
lichen Inhalt des zweiten Buchs. In diesem Abschnitte finden wir
vereinigt, was die gewöhnliche Grammatik unter dem Capitel Or-
thoepie und Orthographie zu vereinigen sucht. Die Vollständigkeit
womit der Verfasser die Lehre vom französischen Hiatus historisch
und systematisch erörtert, ergänzt fruchtbar eindringend und bahn-
brechend die bisherigen Regeln. Die Bemerkung über die Aus-
sprache verdoppelter Interjektionen wirft sogar Licht auf die phy-
siologische Seite der Aspiration im Griechischen. In dem Verse
La Fontaine’s (Tabl. IV, 5):
'Oh! oh! quelle caresse! et quelle me'lodie
hält er das Finale H für aspirirt (oh! oh! — oho!). Darnach liest
man (euh! euh ! = eulieu!) in dem Racine’schen Verse (les Plaid.
Hl, 3):
S’enroue. — He! laissez-nous. Euh! euh! — Reposez-vous.
Ich könnte auf die Interjektionen ενοΐ und heu heu hier ein-
gehen, wenn die Sprachphysiologie nicht zu weit abführen würde.
— Die Critique du Systeme moderne S. 222 veranlasst den Verf.
zur Aufstellung einiger vier bis fünf beachtenswerther Regeln, die
man in der Grammatik vergebens suchen würde.