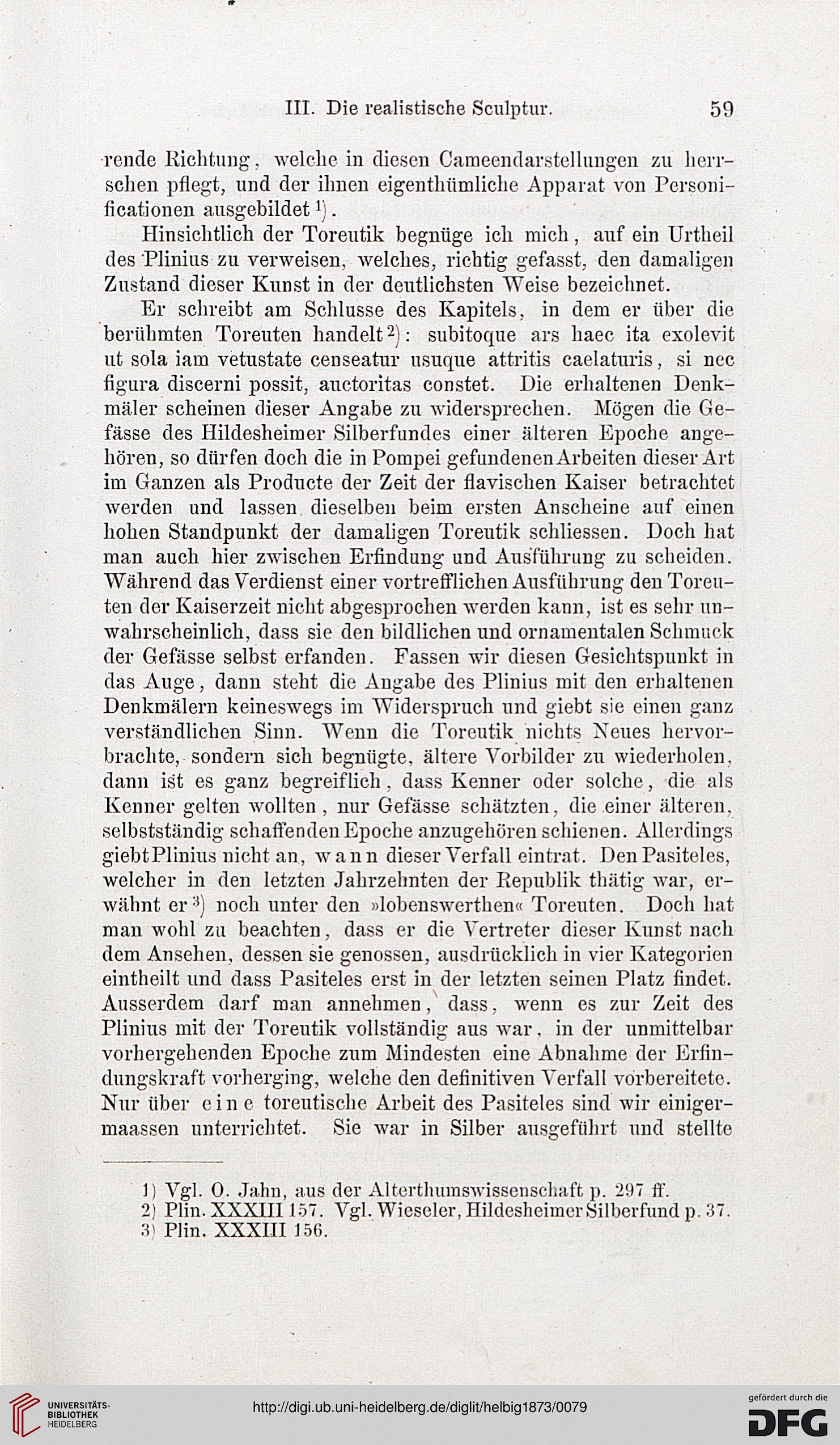III. Die realistische Sculptur.
59
rende Eichtling. welche in diesen Cameendarstellungcn zu herr-
schen pflegt, und der ihnen eigenthümliche Apparat von Pcrsoni-
ficationen ausgebildetl).
Hinsichtlich der Toreutik begnüge ich mich, auf ein Urtheil
des Plinius zu verweisen, welches, richtig gefasst, den damaligen
Zustand dieser Kunst in der deutlichsten Weise bezeichnet'.
Er schreibt am Schlüsse des Kapitels, in dem er über die
berühmten Toreuten handelt2): subitoque ars haec ita exolevit
ut sola iam vetustate censeatur usuque attritis caelaturis, si nec
figura discerni possit, auctoritas constet. Die erhaltenen Denk-
mäler scheinen dieser Angabe zu widersprechen. Mögen die Ge-
fässe des Hildesheimer Silberfundes einer älteren Epoche ange-
hören, so dürfen doch die in Pompei gefundenen Arbeiten dieser Art
im Ganzen als Producte der Zeit der flavischen Kaiser betrachtet
werden und lassen dieselben beim ersten Anscheine auf einen
hohen Standpunkt der damaligen Toreutik schliessen. Doch hat
man auch hier zwischen Erfindung und Ausführung zu scheiden.
Während das Verdienst einer vortrefflichen Ausführung den Toreu-
ten der Kaiserzeit nicht abgesprochen werden kann, ist es sehr un-
wahrscheinlich, dass sie den bildlichen und ornamentalen Schmuck
der Gefässe selbst erfanden. Fassen wir diesen Gesichtspunkt in
das Auge, dann steht die Angabe des Plinius mit den erhaltenen
Denkmälern keineswegs im Widerspruch und giebt sie einen ganz
verständlichen Sinn. Wenn die Toreutik nichts Neues hervor-
brachte, sondern sich begnügte, ältere Vorbilder zu wiederholen,
dann ist es ganz begreiflich . dass Kenner oder solche, die als
Kenner gelten wollten , nur Gefässe schätzten, die einer älteren,
selbstständig schaffenden Epoche anzugehören schienen. Allerdings
giebtPlinius nicht an, w a n n dieser Verfall eintrat. Den Pasiteles,
welcher in den letzten Jahrzehnten der Eepublik thätig war, er-
wähnt er3) noch unter den »lobenswerthen« Toreuten. Doch hat
man wohl zu beachten, dass er die Vertreter dieser Kunst nach
dem Ansehen, dessen sie genossen, ausdrücklich in vier Kategorien
eintheilt und dass Pasiteles erst in der letzten seinen Platz findet.
Ausserdem darf man annehmen, dass, wenn es zur Zeit des
Plinius mit der Toreutik vollständig aus war. in der unmittelbar
vorhergehenden Epoche zum Mindesten eine Abnahme der Erfin-
dungskraft vorherging, welche den definitiven Verfall vorbereitete.
Nur über eine toreutische Arbeit des Pasiteles sind wir einiger-
maassen unterrichtet. Sie war in Silber ausgeführt und stellte
1) Vgl. 0. Jahn, aus der Alterthumswissenschaft p. 297 ff.
2) Plin. XXX1I1157. Vgl. Wieseler, Hildesheimer Silberfund p. 37.
3) Plin. XXXIII 150.
59
rende Eichtling. welche in diesen Cameendarstellungcn zu herr-
schen pflegt, und der ihnen eigenthümliche Apparat von Pcrsoni-
ficationen ausgebildetl).
Hinsichtlich der Toreutik begnüge ich mich, auf ein Urtheil
des Plinius zu verweisen, welches, richtig gefasst, den damaligen
Zustand dieser Kunst in der deutlichsten Weise bezeichnet'.
Er schreibt am Schlüsse des Kapitels, in dem er über die
berühmten Toreuten handelt2): subitoque ars haec ita exolevit
ut sola iam vetustate censeatur usuque attritis caelaturis, si nec
figura discerni possit, auctoritas constet. Die erhaltenen Denk-
mäler scheinen dieser Angabe zu widersprechen. Mögen die Ge-
fässe des Hildesheimer Silberfundes einer älteren Epoche ange-
hören, so dürfen doch die in Pompei gefundenen Arbeiten dieser Art
im Ganzen als Producte der Zeit der flavischen Kaiser betrachtet
werden und lassen dieselben beim ersten Anscheine auf einen
hohen Standpunkt der damaligen Toreutik schliessen. Doch hat
man auch hier zwischen Erfindung und Ausführung zu scheiden.
Während das Verdienst einer vortrefflichen Ausführung den Toreu-
ten der Kaiserzeit nicht abgesprochen werden kann, ist es sehr un-
wahrscheinlich, dass sie den bildlichen und ornamentalen Schmuck
der Gefässe selbst erfanden. Fassen wir diesen Gesichtspunkt in
das Auge, dann steht die Angabe des Plinius mit den erhaltenen
Denkmälern keineswegs im Widerspruch und giebt sie einen ganz
verständlichen Sinn. Wenn die Toreutik nichts Neues hervor-
brachte, sondern sich begnügte, ältere Vorbilder zu wiederholen,
dann ist es ganz begreiflich . dass Kenner oder solche, die als
Kenner gelten wollten , nur Gefässe schätzten, die einer älteren,
selbstständig schaffenden Epoche anzugehören schienen. Allerdings
giebtPlinius nicht an, w a n n dieser Verfall eintrat. Den Pasiteles,
welcher in den letzten Jahrzehnten der Eepublik thätig war, er-
wähnt er3) noch unter den »lobenswerthen« Toreuten. Doch hat
man wohl zu beachten, dass er die Vertreter dieser Kunst nach
dem Ansehen, dessen sie genossen, ausdrücklich in vier Kategorien
eintheilt und dass Pasiteles erst in der letzten seinen Platz findet.
Ausserdem darf man annehmen, dass, wenn es zur Zeit des
Plinius mit der Toreutik vollständig aus war. in der unmittelbar
vorhergehenden Epoche zum Mindesten eine Abnahme der Erfin-
dungskraft vorherging, welche den definitiven Verfall vorbereitete.
Nur über eine toreutische Arbeit des Pasiteles sind wir einiger-
maassen unterrichtet. Sie war in Silber ausgeführt und stellte
1) Vgl. 0. Jahn, aus der Alterthumswissenschaft p. 297 ff.
2) Plin. XXX1I1157. Vgl. Wieseler, Hildesheimer Silberfund p. 37.
3) Plin. XXXIII 150.