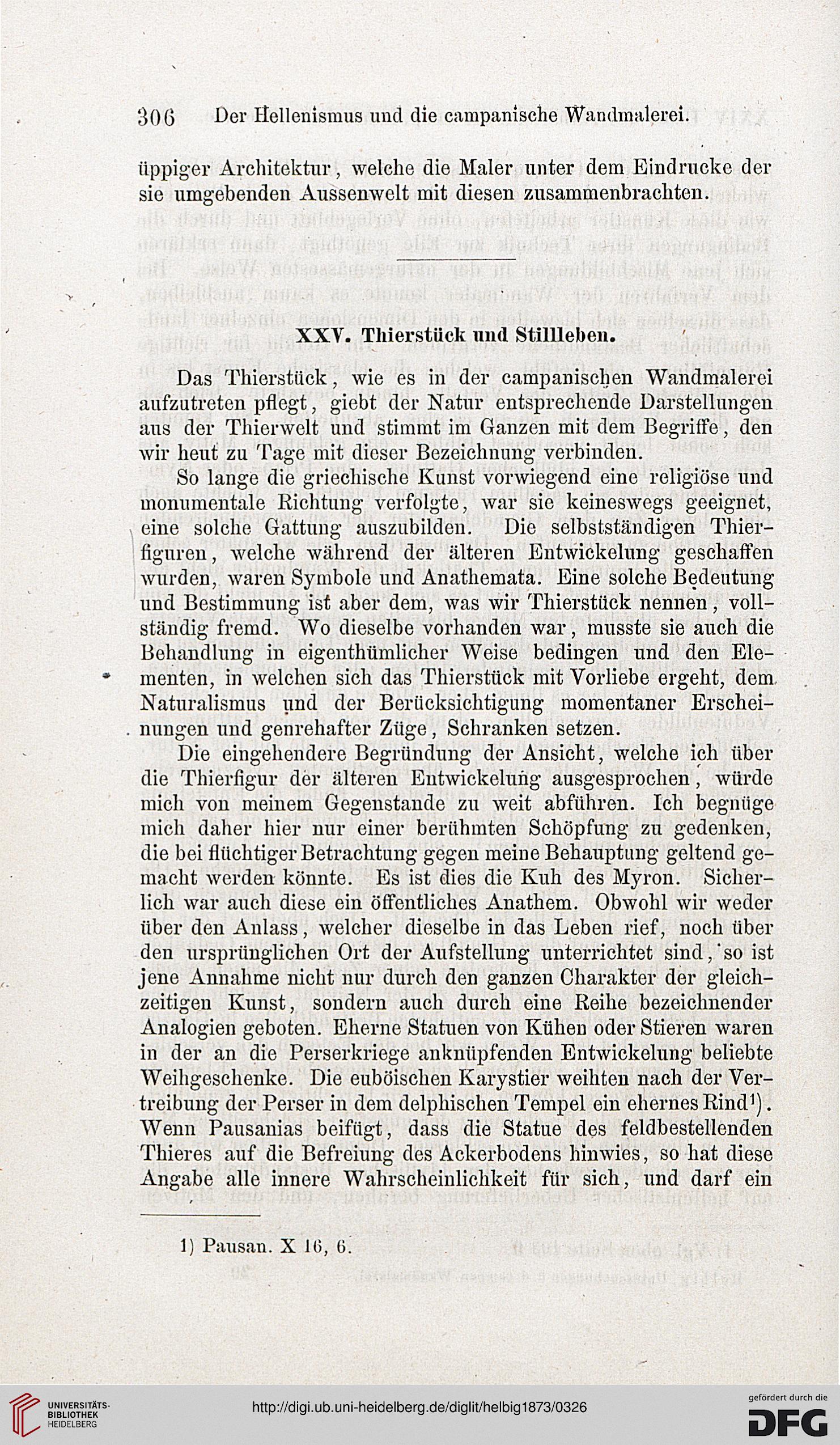306 Der Hellenismus und die campanische Wandmalerei.
üppiger Architektur, welche die Maler unter dem Eindrucke der
sie umgebenden Aussenwelt mit diesen zusammenbrachten.
XXV. Thierstück und Stillleben.
Das Thierstiick, wie es in der campanischen Wandmalerei
aufzutreten pflegt, giebt der Natur entsprechende Darstellungen
aus der Thierwelt und stimmt im Ganzen mit dem Begriffe, den
wir heut zu Tage mit dieser Bezeichnung verbinden.
So lange die griechische Kunst vorwiegend eine religiöse und
monumentale Richtung verfolgte, war sie keineswegs geeignet,
eine solche Gattung auszubilden. Die selbstständigen Thier-
figuren , welche während der älteren Entwickelung geschaffen
wurden, waren Symbole und Anathemata. Eine solche Bedeutung
und Bestimmung ist aber dem, was wir Thierstück nennen, voll-
ständig fremd. Wo dieselbe vorhanden war, musste sie auch die
Behandlung in eigenthümlicher Weise bedingen und den Ele-
menten, in welchen sich das Thierstück mit Vorliebe ergeht, dem
Naturalismus und der Berücksichtigung momentaner Erschei-
nungen und genrehafter Züge, Schranken setzen.
Die eingehendere Begründung der Ansicht, welche ich über
die Thierfigur der älteren Entwickelung ausgesprochen, würde
mich von meinem Gegenstande zu weit abführen. Ich begnüge
mich daher hier nur einer berühmten Schöpfung zu gedenken,
die bei flüchtiger Betrachtung gegen meine Behauptung geltend ge-
macht werden könnte. Es ist dies die Kuh des Myron. Sicher-
lich war auch diese ein öffentliches Anathem. Obwohl wir weder
über den Anlass, welcher dieselbe in das Leben rief, noch über
den ursprünglichen Ort der Aufstellung unterrichtet sind,'so ist
jene Annahme nicht nur durch den ganzen Charakter der gleich-
zeitigen Kunst, sondern auch durch eine Reihe bezeichnender
Analogien geboten. Eherne Statuen von Kühen oder Stieren waren
in der an die Perserkriege anknüpfenden Entwickelung beliebte
Weihgeschenke. Die euböischen Karystier weihten nach der Ver-
treibung der Perser in dem delphischen Tempel ein ehernes Rind1).
Wenn Pausanias beifügt, dass die Statue des feldbestellenden
Thieres auf die Befreiung des Ackerbodens hinwies, so hat diese
Angabe alle innere Wahrscheinlichkeit für sich, und darf ein
1) Pausan. X 10, ö.
üppiger Architektur, welche die Maler unter dem Eindrucke der
sie umgebenden Aussenwelt mit diesen zusammenbrachten.
XXV. Thierstück und Stillleben.
Das Thierstiick, wie es in der campanischen Wandmalerei
aufzutreten pflegt, giebt der Natur entsprechende Darstellungen
aus der Thierwelt und stimmt im Ganzen mit dem Begriffe, den
wir heut zu Tage mit dieser Bezeichnung verbinden.
So lange die griechische Kunst vorwiegend eine religiöse und
monumentale Richtung verfolgte, war sie keineswegs geeignet,
eine solche Gattung auszubilden. Die selbstständigen Thier-
figuren , welche während der älteren Entwickelung geschaffen
wurden, waren Symbole und Anathemata. Eine solche Bedeutung
und Bestimmung ist aber dem, was wir Thierstück nennen, voll-
ständig fremd. Wo dieselbe vorhanden war, musste sie auch die
Behandlung in eigenthümlicher Weise bedingen und den Ele-
menten, in welchen sich das Thierstück mit Vorliebe ergeht, dem
Naturalismus und der Berücksichtigung momentaner Erschei-
nungen und genrehafter Züge, Schranken setzen.
Die eingehendere Begründung der Ansicht, welche ich über
die Thierfigur der älteren Entwickelung ausgesprochen, würde
mich von meinem Gegenstande zu weit abführen. Ich begnüge
mich daher hier nur einer berühmten Schöpfung zu gedenken,
die bei flüchtiger Betrachtung gegen meine Behauptung geltend ge-
macht werden könnte. Es ist dies die Kuh des Myron. Sicher-
lich war auch diese ein öffentliches Anathem. Obwohl wir weder
über den Anlass, welcher dieselbe in das Leben rief, noch über
den ursprünglichen Ort der Aufstellung unterrichtet sind,'so ist
jene Annahme nicht nur durch den ganzen Charakter der gleich-
zeitigen Kunst, sondern auch durch eine Reihe bezeichnender
Analogien geboten. Eherne Statuen von Kühen oder Stieren waren
in der an die Perserkriege anknüpfenden Entwickelung beliebte
Weihgeschenke. Die euböischen Karystier weihten nach der Ver-
treibung der Perser in dem delphischen Tempel ein ehernes Rind1).
Wenn Pausanias beifügt, dass die Statue des feldbestellenden
Thieres auf die Befreiung des Ackerbodens hinwies, so hat diese
Angabe alle innere Wahrscheinlichkeit für sich, und darf ein
1) Pausan. X 10, ö.