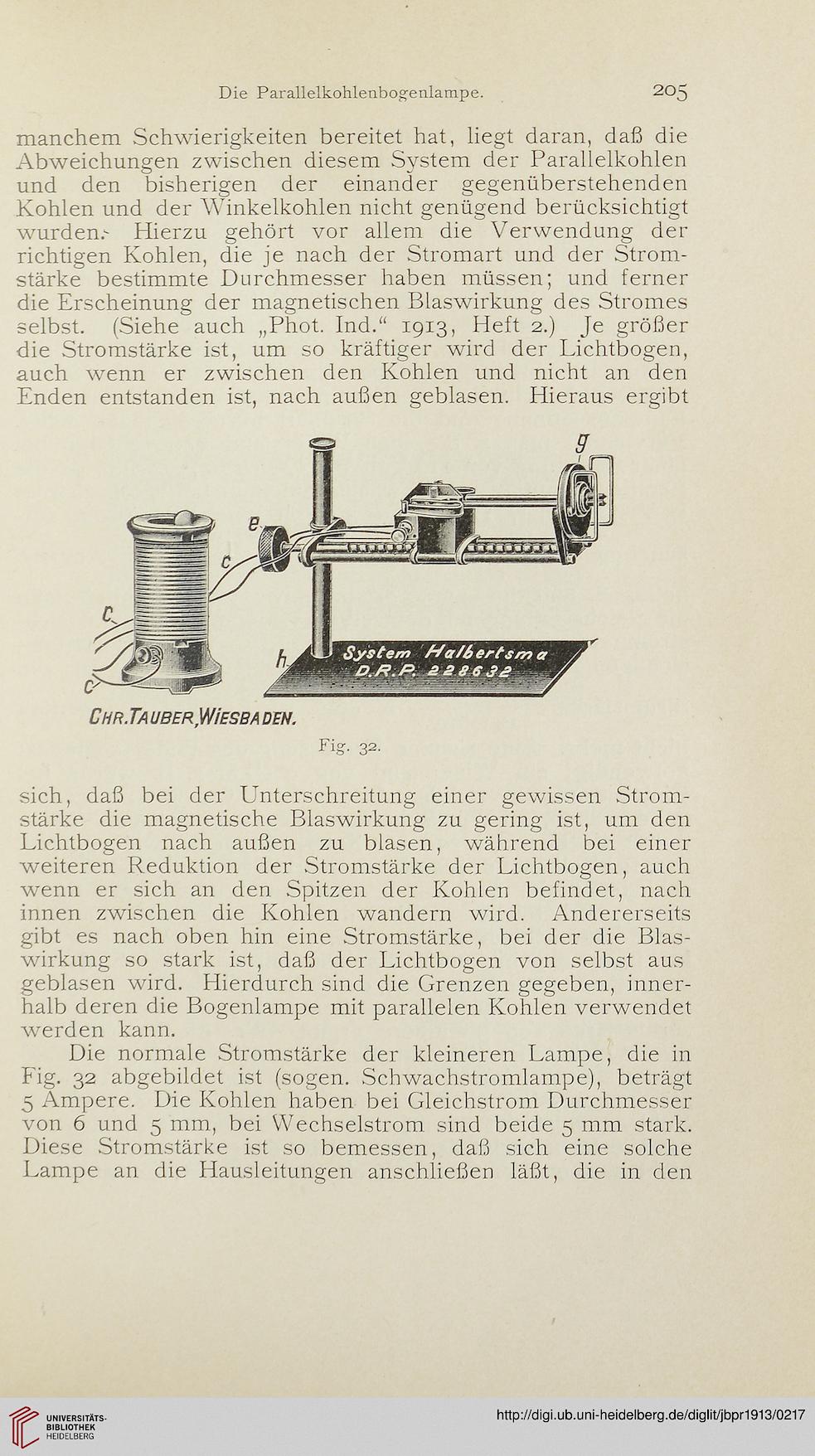Die Parallelkohlenbogenlampe.
2O5
manchem Schwierigkeiten bereitet hat, liegt daran, daß die
Abweichungen zwischen diesem System der Parallelkohlen
und den bisherigen der einander gegenüberstehenden
Kohlen und der Winkelkohlen nicht genügend berücksichtigt
wurden.- Hierzu gehört vor allem die Verwendung der
richtigen Kohlen, die je nach der Stromart und der Strom-
stärke bestimmte Durchmesser haben müssen; und ferner
die Erscheinung der magnetischen Blaswirkung des Stromes
selbst. (Siehe auch „Phot. Ind.“ 1913, Heft 2.) Je größer
die Stromstärke ist, um so kräftiger wird der Lichtbogen,
auch wenn er zwischen den Kohlen und nicht an den
Enden entstanden ist, nach außen geblasen. Hieraus ergibt
C HR. TA UBERy/iESBA DEN.
Fig- 32-
sich, daß bei der Unterschreitung einer gewissen Strom-
stärke die magnetische Blaswirkung zu gering ist, um den
Lichtbogen nach außen zu blasen, während bei einer
weiteren Reduktion der Stromstärke der Lichtbogen, auch
wenn er sich an den Spitzen der Kohlen befindet, nach
innen zwischen die Kohlen wandern wird. Andererseits
gibt es nach oben hin eine Stromstärke, bei der die Blas-
wirkung so stark ist, daß der Lichtbogen von selbst aus
geblasen wird. Hierdurch sind die Grenzen gegeben, inner-
halb deren die Bogenlampe mit parallelen Kohlen verwendet
werden kann.
Die normale Stromstärke der kleineren Lampe, die in
Fig. 32 abgebildet ist (sogen. Schwachstromlampe), beträgt
5 Ampere. Die Kohlen haben bei Gleichstrom Durchmesser
von 6 und 5 mm, bei Wechselstrom sind beide 5 mm stark.
Diese Stromstärke ist so bemessen, daß sich eine solche
Lampe an die Hausleitungen anschließen läßt, die in den
2O5
manchem Schwierigkeiten bereitet hat, liegt daran, daß die
Abweichungen zwischen diesem System der Parallelkohlen
und den bisherigen der einander gegenüberstehenden
Kohlen und der Winkelkohlen nicht genügend berücksichtigt
wurden.- Hierzu gehört vor allem die Verwendung der
richtigen Kohlen, die je nach der Stromart und der Strom-
stärke bestimmte Durchmesser haben müssen; und ferner
die Erscheinung der magnetischen Blaswirkung des Stromes
selbst. (Siehe auch „Phot. Ind.“ 1913, Heft 2.) Je größer
die Stromstärke ist, um so kräftiger wird der Lichtbogen,
auch wenn er zwischen den Kohlen und nicht an den
Enden entstanden ist, nach außen geblasen. Hieraus ergibt
C HR. TA UBERy/iESBA DEN.
Fig- 32-
sich, daß bei der Unterschreitung einer gewissen Strom-
stärke die magnetische Blaswirkung zu gering ist, um den
Lichtbogen nach außen zu blasen, während bei einer
weiteren Reduktion der Stromstärke der Lichtbogen, auch
wenn er sich an den Spitzen der Kohlen befindet, nach
innen zwischen die Kohlen wandern wird. Andererseits
gibt es nach oben hin eine Stromstärke, bei der die Blas-
wirkung so stark ist, daß der Lichtbogen von selbst aus
geblasen wird. Hierdurch sind die Grenzen gegeben, inner-
halb deren die Bogenlampe mit parallelen Kohlen verwendet
werden kann.
Die normale Stromstärke der kleineren Lampe, die in
Fig. 32 abgebildet ist (sogen. Schwachstromlampe), beträgt
5 Ampere. Die Kohlen haben bei Gleichstrom Durchmesser
von 6 und 5 mm, bei Wechselstrom sind beide 5 mm stark.
Diese Stromstärke ist so bemessen, daß sich eine solche
Lampe an die Hausleitungen anschließen läßt, die in den