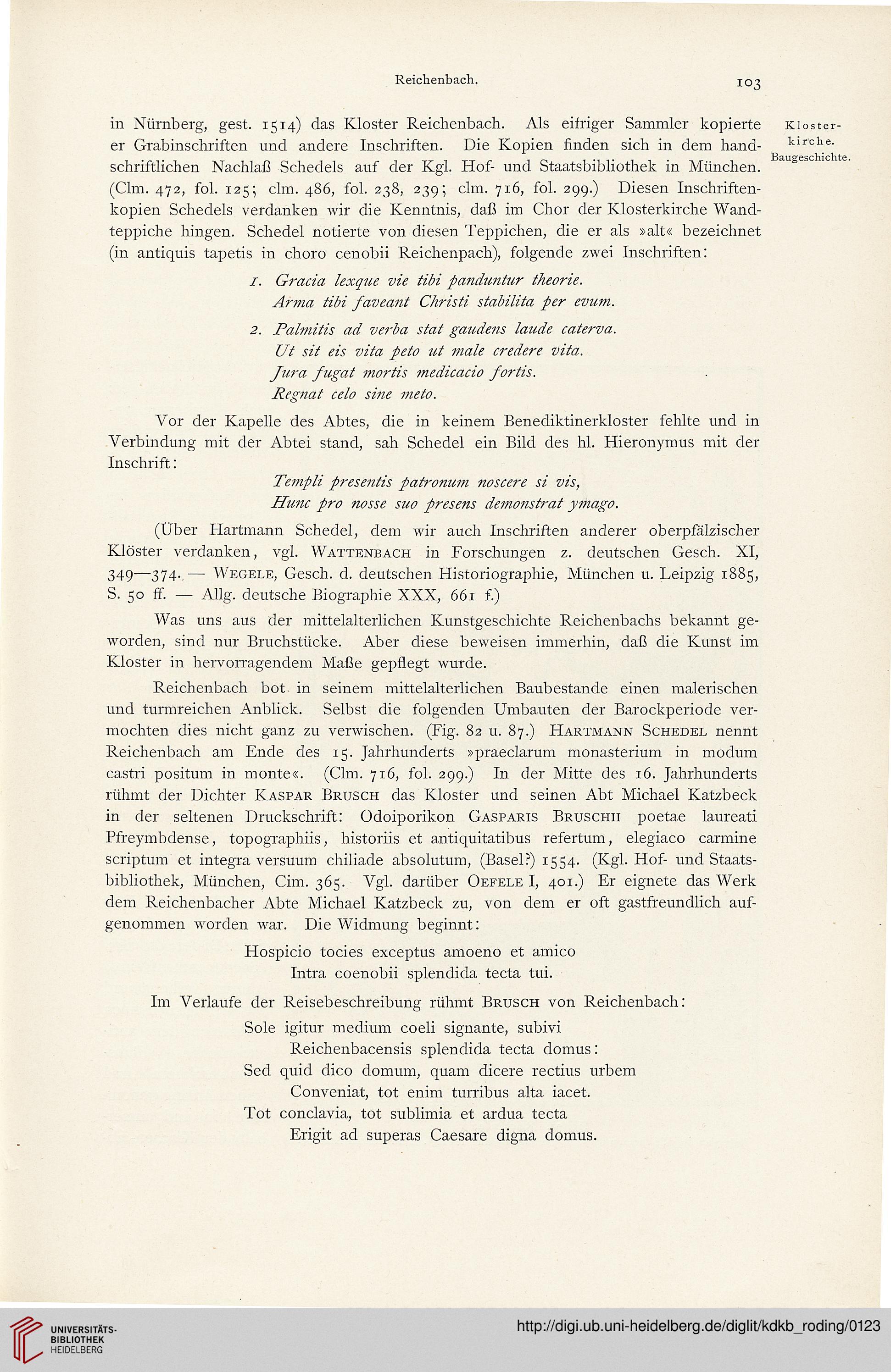Reichenbach. 103
in Nürnberg, gest. 1514) das Kloster Reichenbach. Als eifriger Sammler kopierte
er Grabinschriften und andere Inschriften. Die Kopien finden sich in dem hana-
schriftlichen Nachlaß Schedels auf der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München.
(Clm. 472, fol. 125; clm. 486, fol. 238, 239; clm. 716, fol. 299.) Diesen Inschriften-
kopien Schedels verdanken wir die Kenntnis, daß im Chor der Klosterkirche Wand-
teppiche hingen. Schedel notierte von diesen Teppichen, die er als »alt« bezeichnet
(in antiquis tapetis in choro cenobii Reichenpach), folgende zwei Inschriften:
1. Gracia lexque vie tibi panduntur theorie.
Arma tibi faveant Christi stabilita per evum.
2. Palmitis ad verba stat gaudens laude caterva.
Ut sit eis vita peto ut male credere vita.
Jura fugat mortis medicacio fortis.
Regnat celo sine meto.
Vor der Kapelle des Abtes, die in keinem Benediktinerkloster fehlte und in
Verbindung mit der Abtei stand, sah Schedel ein Bild des hl. Hieronymus mit der
Inschrift:
Templi presentis patronum noscere si vis,
Hunc pro nosse suo presens demonstrat ymago.
(Uber Hartmann Schedel, dem wir auch Inschriften anderer oberpfälzischer
Klöster verdanken, vgl. Wattenbach in Forschungen z. deutschen Gesch. XI,
349—374. — Wegele, Gesch. d. deutschen Historiographie, München u. Leipzig 1885,
S. 50 ff. — Allg. deutsche Biographie XXX, 661 f.)
Was uns aus der mittelalterlichen Kunstgeschichte Reichenbachs bekannt ge-
worden, sind nur Bruchstiicke. Aber diese beweisen immerhin, daß die Kunst im
Kloster in hervorragendem Maße gepflegt wurde.
Reichenbach bot in seinem mittelalterlichen Baubestande einen malerischen
und turmreichen Anblick. Selbst die folgenden Umbauten der Barockperiode ver-
mochten dies nicht ganz zu verwischen. (Fig. 82 u. 87.) Hartmann Schedel nennt
Reichenbach am Ende des 15. Jahrhunderts »praeclarum monasterium in modurn
castri positum in monte«. (Clm. 716, fol. 299.) In der Mitte des 16. Jahrhunderts
rühmt der Dichter Kaspar Brusch das Kloster und seinen Abt Michael Katzbeck
in der seltenen Druckschrift: Odoiporikon Gasparis Bruschii poetae laureati
Pfreymbdense, topographiis, historiis et antiquitatibus refertum, elegiaco carmine
scriptum et integra versuum chiliade absolutum, (Basel?) 1554. (Kgl. Hof- und Staats-
bibliothek, Miinchen, Cim. 365. Vgl. darüber Oefele I, 401.) Er eignete das Werk
dem Reichenbacher Abte Michael Katzbeck zu, von dem er oft gastfreundlich auf-
genommen worden war. Die Widmung beginnt:
Hospicio tocies exceptus amoeno et amico
Intra coenobii splendida tecta tui.
Im Verlaufe der Reisebeschreibung rühmt Brusch von Reichenbach:
Sole igitur medium coeli signante, subivi
Reichenbacensis splendida tecta domus:
Sed quid dico domum, quam dicere rectius urbem
Conveniat, tot enim turribus alta iacet.
Tot conclavia, tot sublimia et ardua tecta
Erigit ad superas Caesare digna domus.
Kloster-
k i r‘c h e.
Baugeschichte.
in Nürnberg, gest. 1514) das Kloster Reichenbach. Als eifriger Sammler kopierte
er Grabinschriften und andere Inschriften. Die Kopien finden sich in dem hana-
schriftlichen Nachlaß Schedels auf der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München.
(Clm. 472, fol. 125; clm. 486, fol. 238, 239; clm. 716, fol. 299.) Diesen Inschriften-
kopien Schedels verdanken wir die Kenntnis, daß im Chor der Klosterkirche Wand-
teppiche hingen. Schedel notierte von diesen Teppichen, die er als »alt« bezeichnet
(in antiquis tapetis in choro cenobii Reichenpach), folgende zwei Inschriften:
1. Gracia lexque vie tibi panduntur theorie.
Arma tibi faveant Christi stabilita per evum.
2. Palmitis ad verba stat gaudens laude caterva.
Ut sit eis vita peto ut male credere vita.
Jura fugat mortis medicacio fortis.
Regnat celo sine meto.
Vor der Kapelle des Abtes, die in keinem Benediktinerkloster fehlte und in
Verbindung mit der Abtei stand, sah Schedel ein Bild des hl. Hieronymus mit der
Inschrift:
Templi presentis patronum noscere si vis,
Hunc pro nosse suo presens demonstrat ymago.
(Uber Hartmann Schedel, dem wir auch Inschriften anderer oberpfälzischer
Klöster verdanken, vgl. Wattenbach in Forschungen z. deutschen Gesch. XI,
349—374. — Wegele, Gesch. d. deutschen Historiographie, München u. Leipzig 1885,
S. 50 ff. — Allg. deutsche Biographie XXX, 661 f.)
Was uns aus der mittelalterlichen Kunstgeschichte Reichenbachs bekannt ge-
worden, sind nur Bruchstiicke. Aber diese beweisen immerhin, daß die Kunst im
Kloster in hervorragendem Maße gepflegt wurde.
Reichenbach bot in seinem mittelalterlichen Baubestande einen malerischen
und turmreichen Anblick. Selbst die folgenden Umbauten der Barockperiode ver-
mochten dies nicht ganz zu verwischen. (Fig. 82 u. 87.) Hartmann Schedel nennt
Reichenbach am Ende des 15. Jahrhunderts »praeclarum monasterium in modurn
castri positum in monte«. (Clm. 716, fol. 299.) In der Mitte des 16. Jahrhunderts
rühmt der Dichter Kaspar Brusch das Kloster und seinen Abt Michael Katzbeck
in der seltenen Druckschrift: Odoiporikon Gasparis Bruschii poetae laureati
Pfreymbdense, topographiis, historiis et antiquitatibus refertum, elegiaco carmine
scriptum et integra versuum chiliade absolutum, (Basel?) 1554. (Kgl. Hof- und Staats-
bibliothek, Miinchen, Cim. 365. Vgl. darüber Oefele I, 401.) Er eignete das Werk
dem Reichenbacher Abte Michael Katzbeck zu, von dem er oft gastfreundlich auf-
genommen worden war. Die Widmung beginnt:
Hospicio tocies exceptus amoeno et amico
Intra coenobii splendida tecta tui.
Im Verlaufe der Reisebeschreibung rühmt Brusch von Reichenbach:
Sole igitur medium coeli signante, subivi
Reichenbacensis splendida tecta domus:
Sed quid dico domum, quam dicere rectius urbem
Conveniat, tot enim turribus alta iacet.
Tot conclavia, tot sublimia et ardua tecta
Erigit ad superas Caesare digna domus.
Kloster-
k i r‘c h e.
Baugeschichte.