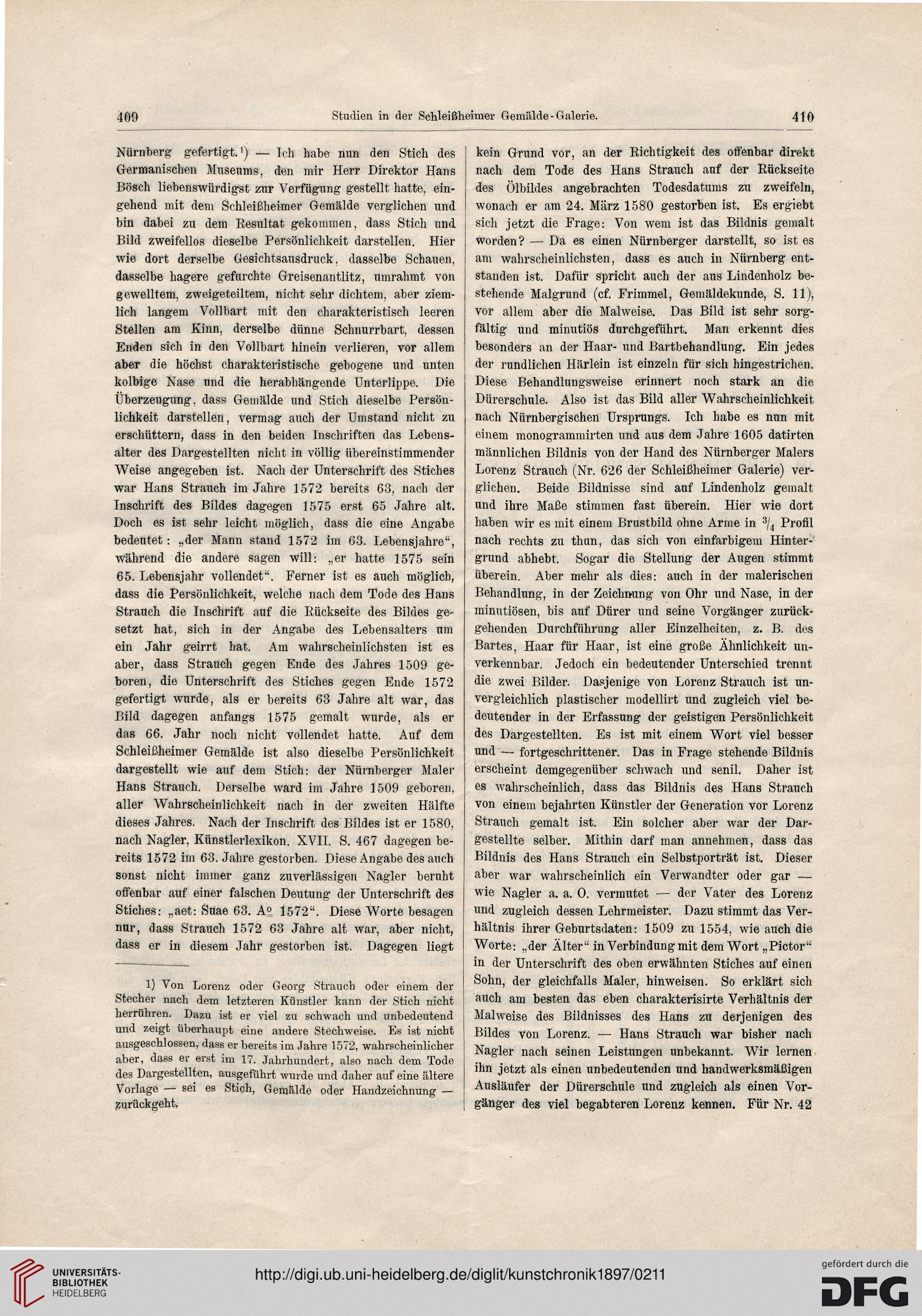400
Studien in der Schleißheimer Gemälde-Galerie.
410
Nürnberg gefertigt.1) — Ich habe mm den Stich des
Germanischen Museums, den mir Herr Direktor Hans
Bosch liebenswürdigst zur Verfügung gestellt hatte, ein-
gehend mit dem Schleißheimer Gemälde verglichen und
bin dabei zu dem Eesultat gekommen, dass Stich und
Bild zweifellos dieselbe Persönlichkeit darstellen. Hier
wie dort derselbe Gesichtsansdruck, dasselbe Schauen,
dasselbe hagere gefurchte Greisenantlitz, umrahmt von
gewelltem, zweigeteiltem, nicht sehr dichtem, aber ziem-
lich langem Vollbart mit den charakteristisch leeren
Stellen am Kinn, derselbe dünne Schnurrbart, dessen
Enden sich in den Vollbart hinein verlieren, vor allem
aber die höchst charakteristische gebogene und unten
kolbige Nase und die herabhängende Unterlippe. Die
Überzeugung, dass Gemälde und Stich dieselbe Persön-
lichkeit darstellen, vermag auch der Umstand nicht zu
erschüttern, dass in den beiden Inschriften das Lebens-
alter des Dargestellten nicht in völlig übereinstimmender
Weise angegeben ist. Nach der Unterschrift des Stiches
war Hans Strauch im Jahre 1572 bereits 63, nach der
Inschrift des Bildes dagegen 1575 erst 65 Jahre alt.
Doch es ist sehr leicht möglich, dass die eine Angabe
bedeutet: „der Mann stand 1572 im 63. Lebensjahre",
während die andere sagen will: „er hatte 1575 sein
65. Lebensjahr vollendet". Ferner ist es auch möglich,
dass die Persönlichkeit, welche nach dem Tode des Hans
Strauch die Inschrift auf die Rückseite des Bildes ge-
setzt hat, sich in der Angabe des Lebensalters um
ein Jahr geirrt hat. Am wahrscheinlichsten ist es
aber, dass Strauch gegen Ende des Jahres 1509 ge-
boren, die Unterschrift des Stiches gegen Ende 1572
gefertigt wurde, als er bereits 63 Jahre alt war, das
Bild dagegen anfangs 1575 gemalt wurde, als er
das 66. Jahr noch nicht vollendet hatte. Auf dem
Schleißheimer Gemälde ist also dieselbe Persönlichkeit
dargestellt wie auf dem Stich: der Nürnberger Maler
Hans Strauch. Derselbe ward im Jahre 1509 geboren,
aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Hälfte
dieses Jahres. Nach der Inschrift des Bildes ist er 1580,
nach Nagler, Künstlerlexikon. XVII. S. 467 dagegen be-
reits 1572 im 63. Jahre gestorben. Diese Angabe des auch
sonst nicht immer ganz zuverlässigen Nagler beruht
offenbar auf einer falschen Deutung der Unterschrift des
Stiches: ,.aet: Suae 63. A° 1572". Diese Worte besagen
nur, dass Strauch 1572 63 Jahre alt war, aber nicht,
dass er in diesem Jahr gestorben ist. Dagegen liegt
1) Von Lorenz oder Georg Strauch oder einem der
Stecher nach dem letzteren Künstler kann der Stich nicht
herrühren. Dazu ist er viel zu schwach und unbedeutend
und zeigt überhaupt eine andere Stechweise. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass er bereits im Jahre 1572, wahrscheinlicher
aber, dass er erst im 17. Jahrhundert, also nach dem Tode
des Dargestellten, ausgeführt wurde und daher auf eine ältere
Vorlage — sei es Stich, Gemälde oder Handzeichnung —
zurückgeht.
kein Grund vor, an der Richtigkeit des offenbar direkt
nach dem Tode des Hans Strauch auf der Rückseite
des Ölbildes angebrachten Todesdatums zu zweifeln,
wonach er am 24. März 1580 gestorben ist. Es ergiebt
sich jetzt die Frage: Von wem ist das Bildnis gemalt
worden? — Da es einen Nürnberger darstellt, so ist es
am wahrscheinlichsten, dass es auch in Nürnberg ent-
standen ist. Dafür spricht auch der aus Lindenholz be-
stehende Malgrund (cf. Frimmel, Gemäldekunde, S. 11),
vor allem aber die Malweise. Das Bild ist sehr sorg-
fältig und minutiös durchgeführt. Man erkennt dies
besonders an der Haar- und Bartbehandlung. Ein jedes
der rundlichen Härlein ist einzeln für sich hingestrichen.
Diese Behandlungsweise erinnert noch stark an die
Dürerschule. Also ist das Bild aller Wahrscheinlichkeit
nach Nürnbergischen Ursprungs. Ich habe es nun mit
einem monogrammirten und aus dem Jahre 1605 datirten
männlichen Bildnis von der Hand des Nürnberger Malers
Lorenz Strauch (Nr. 626 der Schleißheimer Galerie) ver-
glichen. Beide Bildnisse sind auf Lindenholz gemalt
und ihre Maße stimmen fast überein. Hier wie dort
haben wir es mit einem Brustbild ohne Arme in 3/4 Profil
nach rechts zu thun, das sich von einfarbigem Hinter-
grund abhebt. Sogar die Stellung der Augen stimmt
überein. Aber mehr als dies: auch in der malerischen
Behandlung, in der Zeichnung von Ohr und Nase, in der
minutiösen, bis auf Dürer und seine Vorgänger zurück-
gehenden Durchführung aller Einzelheiten, z. B. des
Bartes, Haar für Haar, ist eine große Ähnlichkeit un-
verkennbar. Jedoch ein bedeutender Unterschied trennt
die zwei Bilder. Dasjenige von Lorenz Strauch ist un-
vergleichlich plastischer modellirt und zugleich viel be-
deutender in der Erfassung der geistigen Persönlichkeit
des Dargestellten. Es ist mit einem Wort viel besser
und — fortgeschrittener. Das in Frage stehende Bildnis
erscheint demgegenüber schwach und senil. Daher ist
es wahrscheinlich, dass das Bildnis des Hans Strauch
von einem bejahrten Künstler der Generation vor Lorenz
Strauch gemalt ist. Ein solcher aber war der Dar-
gestellte selber. Mithin darf man annehmen, dass das
Bildnis des Hans Strauch ein Selbstporträt ist. Dieser
aber war wahrscheinlich ein Verwandter oder gar —
wie Nagler a. a. 0. vermutet — der Vater des Lorenz
und zugleich dessen Lehrmeister. Dazu stimmt das Ver-
hältnis ihrer Geburtsdaten: 1509 zu 1554, wie auch die
Worte: ..der Älter" in Verbindung mit dem Wort „Pictor"
in der Unterschrift des oben erwähnten Stiches auf einen
Sohn, der gleichfalls Maler, hinweisen. So erklärt sich
auch am besten das eben charakterisirte Verhältnis der
Malweise des Bildnisses des Hans zu derjenigen des
Bildes von Lorenz. — Hans Strauch war bisher nach
Nagler nach seinen Leistungen unbekannt. Wir lernen
ihn jetzt als einen unbedeutenden und handwerksmäßigen
Ausläufer der Dürerschule und zugleich als einen Vor-
gänger des viel begabteren Lorenz kennen. Für Nr. 42
Studien in der Schleißheimer Gemälde-Galerie.
410
Nürnberg gefertigt.1) — Ich habe mm den Stich des
Germanischen Museums, den mir Herr Direktor Hans
Bosch liebenswürdigst zur Verfügung gestellt hatte, ein-
gehend mit dem Schleißheimer Gemälde verglichen und
bin dabei zu dem Eesultat gekommen, dass Stich und
Bild zweifellos dieselbe Persönlichkeit darstellen. Hier
wie dort derselbe Gesichtsansdruck, dasselbe Schauen,
dasselbe hagere gefurchte Greisenantlitz, umrahmt von
gewelltem, zweigeteiltem, nicht sehr dichtem, aber ziem-
lich langem Vollbart mit den charakteristisch leeren
Stellen am Kinn, derselbe dünne Schnurrbart, dessen
Enden sich in den Vollbart hinein verlieren, vor allem
aber die höchst charakteristische gebogene und unten
kolbige Nase und die herabhängende Unterlippe. Die
Überzeugung, dass Gemälde und Stich dieselbe Persön-
lichkeit darstellen, vermag auch der Umstand nicht zu
erschüttern, dass in den beiden Inschriften das Lebens-
alter des Dargestellten nicht in völlig übereinstimmender
Weise angegeben ist. Nach der Unterschrift des Stiches
war Hans Strauch im Jahre 1572 bereits 63, nach der
Inschrift des Bildes dagegen 1575 erst 65 Jahre alt.
Doch es ist sehr leicht möglich, dass die eine Angabe
bedeutet: „der Mann stand 1572 im 63. Lebensjahre",
während die andere sagen will: „er hatte 1575 sein
65. Lebensjahr vollendet". Ferner ist es auch möglich,
dass die Persönlichkeit, welche nach dem Tode des Hans
Strauch die Inschrift auf die Rückseite des Bildes ge-
setzt hat, sich in der Angabe des Lebensalters um
ein Jahr geirrt hat. Am wahrscheinlichsten ist es
aber, dass Strauch gegen Ende des Jahres 1509 ge-
boren, die Unterschrift des Stiches gegen Ende 1572
gefertigt wurde, als er bereits 63 Jahre alt war, das
Bild dagegen anfangs 1575 gemalt wurde, als er
das 66. Jahr noch nicht vollendet hatte. Auf dem
Schleißheimer Gemälde ist also dieselbe Persönlichkeit
dargestellt wie auf dem Stich: der Nürnberger Maler
Hans Strauch. Derselbe ward im Jahre 1509 geboren,
aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Hälfte
dieses Jahres. Nach der Inschrift des Bildes ist er 1580,
nach Nagler, Künstlerlexikon. XVII. S. 467 dagegen be-
reits 1572 im 63. Jahre gestorben. Diese Angabe des auch
sonst nicht immer ganz zuverlässigen Nagler beruht
offenbar auf einer falschen Deutung der Unterschrift des
Stiches: ,.aet: Suae 63. A° 1572". Diese Worte besagen
nur, dass Strauch 1572 63 Jahre alt war, aber nicht,
dass er in diesem Jahr gestorben ist. Dagegen liegt
1) Von Lorenz oder Georg Strauch oder einem der
Stecher nach dem letzteren Künstler kann der Stich nicht
herrühren. Dazu ist er viel zu schwach und unbedeutend
und zeigt überhaupt eine andere Stechweise. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass er bereits im Jahre 1572, wahrscheinlicher
aber, dass er erst im 17. Jahrhundert, also nach dem Tode
des Dargestellten, ausgeführt wurde und daher auf eine ältere
Vorlage — sei es Stich, Gemälde oder Handzeichnung —
zurückgeht.
kein Grund vor, an der Richtigkeit des offenbar direkt
nach dem Tode des Hans Strauch auf der Rückseite
des Ölbildes angebrachten Todesdatums zu zweifeln,
wonach er am 24. März 1580 gestorben ist. Es ergiebt
sich jetzt die Frage: Von wem ist das Bildnis gemalt
worden? — Da es einen Nürnberger darstellt, so ist es
am wahrscheinlichsten, dass es auch in Nürnberg ent-
standen ist. Dafür spricht auch der aus Lindenholz be-
stehende Malgrund (cf. Frimmel, Gemäldekunde, S. 11),
vor allem aber die Malweise. Das Bild ist sehr sorg-
fältig und minutiös durchgeführt. Man erkennt dies
besonders an der Haar- und Bartbehandlung. Ein jedes
der rundlichen Härlein ist einzeln für sich hingestrichen.
Diese Behandlungsweise erinnert noch stark an die
Dürerschule. Also ist das Bild aller Wahrscheinlichkeit
nach Nürnbergischen Ursprungs. Ich habe es nun mit
einem monogrammirten und aus dem Jahre 1605 datirten
männlichen Bildnis von der Hand des Nürnberger Malers
Lorenz Strauch (Nr. 626 der Schleißheimer Galerie) ver-
glichen. Beide Bildnisse sind auf Lindenholz gemalt
und ihre Maße stimmen fast überein. Hier wie dort
haben wir es mit einem Brustbild ohne Arme in 3/4 Profil
nach rechts zu thun, das sich von einfarbigem Hinter-
grund abhebt. Sogar die Stellung der Augen stimmt
überein. Aber mehr als dies: auch in der malerischen
Behandlung, in der Zeichnung von Ohr und Nase, in der
minutiösen, bis auf Dürer und seine Vorgänger zurück-
gehenden Durchführung aller Einzelheiten, z. B. des
Bartes, Haar für Haar, ist eine große Ähnlichkeit un-
verkennbar. Jedoch ein bedeutender Unterschied trennt
die zwei Bilder. Dasjenige von Lorenz Strauch ist un-
vergleichlich plastischer modellirt und zugleich viel be-
deutender in der Erfassung der geistigen Persönlichkeit
des Dargestellten. Es ist mit einem Wort viel besser
und — fortgeschrittener. Das in Frage stehende Bildnis
erscheint demgegenüber schwach und senil. Daher ist
es wahrscheinlich, dass das Bildnis des Hans Strauch
von einem bejahrten Künstler der Generation vor Lorenz
Strauch gemalt ist. Ein solcher aber war der Dar-
gestellte selber. Mithin darf man annehmen, dass das
Bildnis des Hans Strauch ein Selbstporträt ist. Dieser
aber war wahrscheinlich ein Verwandter oder gar —
wie Nagler a. a. 0. vermutet — der Vater des Lorenz
und zugleich dessen Lehrmeister. Dazu stimmt das Ver-
hältnis ihrer Geburtsdaten: 1509 zu 1554, wie auch die
Worte: ..der Älter" in Verbindung mit dem Wort „Pictor"
in der Unterschrift des oben erwähnten Stiches auf einen
Sohn, der gleichfalls Maler, hinweisen. So erklärt sich
auch am besten das eben charakterisirte Verhältnis der
Malweise des Bildnisses des Hans zu derjenigen des
Bildes von Lorenz. — Hans Strauch war bisher nach
Nagler nach seinen Leistungen unbekannt. Wir lernen
ihn jetzt als einen unbedeutenden und handwerksmäßigen
Ausläufer der Dürerschule und zugleich als einen Vor-
gänger des viel begabteren Lorenz kennen. Für Nr. 42