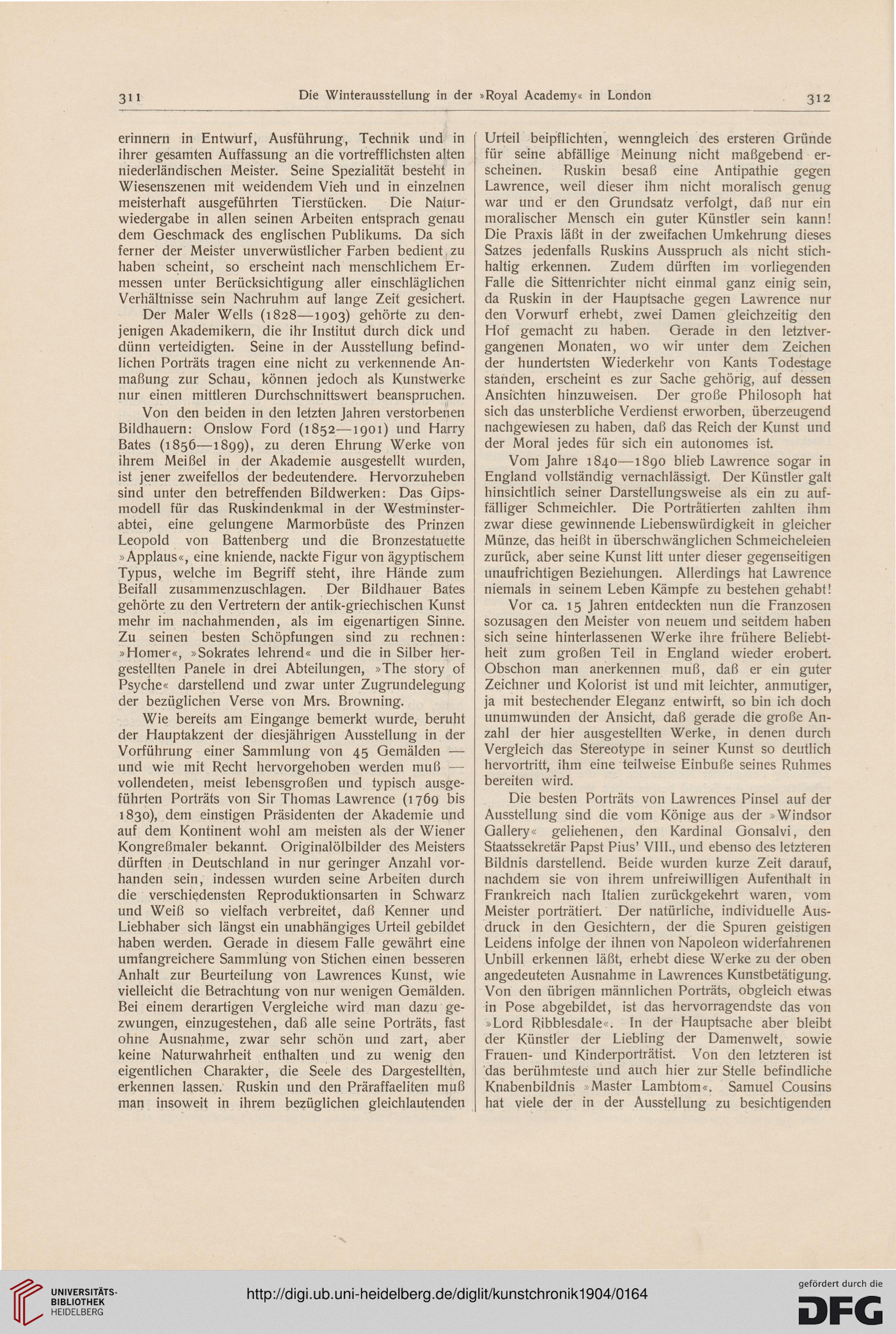3U
Die Winterausstellung in der
»Royal Academy« in London
312
erinnern in Entwurf, Ausführung, Technik und in
ihrer gesamten Auffassung an die vortrefflichsten alten
niederländischen Meister. Seine Spezialität besteht in
Wiesenszenen mit weidendem Vieh und in einzelnen
meisterhaft ausgeführten Tierstücken. Die Natur-
wiedergabe in allen seinen Arbeiten entsprach genau
dem Geschmack des englischen Publikums. Da sich
ferner der Meister unverwüstlicher Farben bedient zu
haben scheint, so erscheint nach menschlichem Er-
messen unter Berücksichtigung aller einschläglichen
Verhältnisse sein Nachruhm auf lange Zeit gesichert.
Der Maler Wells (1828—1903) gehörte zu den-
jenigen Akademikern, die ihr Institut durch dick und
dünn verteidigten. Seine in der Ausstellung befind-
lichen Porträts tragen eine nicht zu verkennende An-
maßung zur Schau, können jedoch als Kunstwerke
nur einen mittleren Durchschnittswert beanspruchen.
Von den beiden in den letzten Jahren verstorbenen
Bildhauern: Onslow Ford (1852—1901) und Harry
Bates (1856—1899), zu deren Ehrung Werke von
ihrem Meißel in der Akademie ausgestellt wurden,
ist jener zweifellos der bedeutendere. Hervorzuheben
sind unter den betreffenden Bildwerken: Das Gips-
modell für das Ruskindenkmal in der Westminster-
abtei, eine gelungene Marmorbüste des Prinzen
Leopold von Battenberg und die Bronzestatuette
»Applaus«, eine kniende, nackte Figur von ägyptischem
Typus, welche im Begriff steht, ihre Hände zum
Beifall zusammenzuschlagen. Der Bildhauer Bates
gehörte zu den Vertretern der antik-griechischen Kunst
mehr im nachahmenden, als im eigenartigen Sinne.
Zu seinen besten Schöpfungen sind zu rechnen:
»Homer«, »Sokrates lehrend« und die in Silber her-
gestellten Panele in drei Abteilungen, »The story of
Psyche« darstellend und zwar unter Zugrundelegung
der bezüglichen Verse von Mrs. Browning.
Wie bereits am Eingange bemerkt wurde, beruht
der Hauptakzent der diesjährigen Ausstellung in der
Vorführung einer Sammlung von 45 Gemälden —
und wie mit Recht hervorgehoben werden muß —
vollendeten, meist lebensgroßen und typisch ausge-
führten Porträts von Sir Thomas Lawrence (1769 bis
1830), dem einstigen Präsidenten der Akademie und
auf dem Kontinent wohl am meisten als der Wiener
Kongreßmaler bekannt. Originalölbilder des Meisters
dürften in Deutschland in nur geringer Anzahl vor-
handen sein, indessen wurden seine Arbeiten durch
die verschiedensten Reproduktionsarten in Schwarz
und Weiß so vielfach verbreitet, daß Kenner und
Liebhaber sich längst ein unabhängiges Urteil gebildet
haben werden. Gerade in diesem Falle gewährt eine
umfangreichere Sammlung von Stichen einen besseren
Anhalt zur Beurteilung von Lawrences Kunst, wie
vielleicht die Betrachtung von nur wenigen Gemälden.
Bei einem derartigen Vergleiche wird man dazu ge-
zwungen, einzugestehen, daß alle seine Porträts, fast
ohne Ausnahme, zwar sehr schön und zart, aber
keine Naturwahrheit enthalten und zu wenig den
eigentlichen Charakter, die Seele des Dargestellten,
erkennen lassen. Ruskin und den Präraffaeliten muß
man insoweit in ihrem bezüglichen gleichlautenden
Urteil beipflichten, wenngleich des ersteren Gründe
für seine abfällige Meinung nicht maßgebend er-
scheinen. Ruskin besaß eine Antipathie gegen
Lawrence, weil dieser ihm nicht moralisch genug
war und er den Grundsatz verfolgt, daß nur ein
moralischer Mensch ein guter Künstler sein kann!
Die Praxis läßt in der zweifachen Umkehrung dieses
Satzes jedenfalls Ruskins Ausspruch als nicht stich-
haltig erkennen. Zudem dürften im vorliegenden
Falle die Sittenrichter nicht einmal ganz einig sein,
da Ruskin in der Hauptsache gegen Lawrence nur
den Vorwurf erhebt, zwei Damen gleichzeitig den
Hof gemacht zu haben. Gerade in den letztver-
gangenen Monaten, wo wir unter dem Zeichen
der hundertsten Wiederkehr von Kants Todestage
standen, erscheint es zur Sache gehörig, auf dessen
Ansichten hinzuweisen. Der große Philosoph hat
sich das unsterbliche Verdienst erworben, überzeugend
nachgewiesen zu haben, daß das Reich der Kunst und
der Moral jedes für sich ein autonomes ist.
Vom Jahre 1840—1890 blieb Lawrence sogar in
England vollständig vernachlässigt. Der Künstler galt
hinsichtlich seiner Darstellungsweise als ein zu auf-
fälliger Schmeichler. Die Porträtierten zahlten ihm
zwar diese gewinnende Liebenswürdigkeit in gleicher
Münze, das heißt in überschwänglichen Schmeicheleien
zurück, aber seine Kunst litt unter dieser gegenseitigen
unaufrichtigen Beziehungen. Allerdings hat Lawrence
niemals in seinem Leben Kämpfe zu bestehen gehabt!
Vor ca. 15 Jahren entdeckten nun die Franzosen
sozusagen den Meister von neuem und seitdem haben
sich seine hinterlassenen Werke ihre frühere Beliebt-
heit zum großen Teil in England wieder erobert.
Obschon man anerkennen muß, daß er ein guter
Zeichner und Kolorist ist und mit leichter, anmutiger,
ja mit bestechender Eleganz entwirft, so bin ich doch
unumwunden der Ansicht, daß gerade die große An-
zahl der hier ausgestellten Werke, in denen durch
Vergleich das Stereotype in seiner Kunst so deutlich
hervortritt, ihm eine teilweise Einbuße seines Ruhmes
bereiten wird.
Die besten Porträts von Lawrences Pinsel auf der
Ausstellung sind die vom Könige aus der »Windsor
Gallery« geliehenen, den Kardinal Gonsalvi, den
Staatssekretär Papst Pius' VIII., und ebenso des letzteren
Bildnis darstellend. Beide wurden kurze Zeit darauf,
nachdem sie von ihrem unfreiwilligen Aufenthalt in
Frankreich nach Italien zurückgekehrt waren, vom
Meister porträtiert. Der natürliche, individuelle Aus-
druck in den Gesichtern, der die Spuren geistigen
Leidens infolge der ihnen von Napoleon widerfahrenen
Unbill erkennen läßt, erhebt diese Werke zu der oben
angedeuteten Ausnahme in Lawrences Kunstbetätigung.
Von den übrigen männlichen Porträts, obgleich etwas
in Pose abgebildet, ist das hervorragendste das von
»Lord Ribblesdale«. In der Hauptsache aber bleibt
der Künstler der Liebling der Damenwelt, sowie
Frauen- und Kinderporträtist. Von den letzteren ist
das berühmteste und auch hier zur Stelle befindliche
Knabenbildnis Master Lambtom«. Samuel Cousins
hat viele der in der Ausstellung zu besichtigenden
Die Winterausstellung in der
»Royal Academy« in London
312
erinnern in Entwurf, Ausführung, Technik und in
ihrer gesamten Auffassung an die vortrefflichsten alten
niederländischen Meister. Seine Spezialität besteht in
Wiesenszenen mit weidendem Vieh und in einzelnen
meisterhaft ausgeführten Tierstücken. Die Natur-
wiedergabe in allen seinen Arbeiten entsprach genau
dem Geschmack des englischen Publikums. Da sich
ferner der Meister unverwüstlicher Farben bedient zu
haben scheint, so erscheint nach menschlichem Er-
messen unter Berücksichtigung aller einschläglichen
Verhältnisse sein Nachruhm auf lange Zeit gesichert.
Der Maler Wells (1828—1903) gehörte zu den-
jenigen Akademikern, die ihr Institut durch dick und
dünn verteidigten. Seine in der Ausstellung befind-
lichen Porträts tragen eine nicht zu verkennende An-
maßung zur Schau, können jedoch als Kunstwerke
nur einen mittleren Durchschnittswert beanspruchen.
Von den beiden in den letzten Jahren verstorbenen
Bildhauern: Onslow Ford (1852—1901) und Harry
Bates (1856—1899), zu deren Ehrung Werke von
ihrem Meißel in der Akademie ausgestellt wurden,
ist jener zweifellos der bedeutendere. Hervorzuheben
sind unter den betreffenden Bildwerken: Das Gips-
modell für das Ruskindenkmal in der Westminster-
abtei, eine gelungene Marmorbüste des Prinzen
Leopold von Battenberg und die Bronzestatuette
»Applaus«, eine kniende, nackte Figur von ägyptischem
Typus, welche im Begriff steht, ihre Hände zum
Beifall zusammenzuschlagen. Der Bildhauer Bates
gehörte zu den Vertretern der antik-griechischen Kunst
mehr im nachahmenden, als im eigenartigen Sinne.
Zu seinen besten Schöpfungen sind zu rechnen:
»Homer«, »Sokrates lehrend« und die in Silber her-
gestellten Panele in drei Abteilungen, »The story of
Psyche« darstellend und zwar unter Zugrundelegung
der bezüglichen Verse von Mrs. Browning.
Wie bereits am Eingange bemerkt wurde, beruht
der Hauptakzent der diesjährigen Ausstellung in der
Vorführung einer Sammlung von 45 Gemälden —
und wie mit Recht hervorgehoben werden muß —
vollendeten, meist lebensgroßen und typisch ausge-
führten Porträts von Sir Thomas Lawrence (1769 bis
1830), dem einstigen Präsidenten der Akademie und
auf dem Kontinent wohl am meisten als der Wiener
Kongreßmaler bekannt. Originalölbilder des Meisters
dürften in Deutschland in nur geringer Anzahl vor-
handen sein, indessen wurden seine Arbeiten durch
die verschiedensten Reproduktionsarten in Schwarz
und Weiß so vielfach verbreitet, daß Kenner und
Liebhaber sich längst ein unabhängiges Urteil gebildet
haben werden. Gerade in diesem Falle gewährt eine
umfangreichere Sammlung von Stichen einen besseren
Anhalt zur Beurteilung von Lawrences Kunst, wie
vielleicht die Betrachtung von nur wenigen Gemälden.
Bei einem derartigen Vergleiche wird man dazu ge-
zwungen, einzugestehen, daß alle seine Porträts, fast
ohne Ausnahme, zwar sehr schön und zart, aber
keine Naturwahrheit enthalten und zu wenig den
eigentlichen Charakter, die Seele des Dargestellten,
erkennen lassen. Ruskin und den Präraffaeliten muß
man insoweit in ihrem bezüglichen gleichlautenden
Urteil beipflichten, wenngleich des ersteren Gründe
für seine abfällige Meinung nicht maßgebend er-
scheinen. Ruskin besaß eine Antipathie gegen
Lawrence, weil dieser ihm nicht moralisch genug
war und er den Grundsatz verfolgt, daß nur ein
moralischer Mensch ein guter Künstler sein kann!
Die Praxis läßt in der zweifachen Umkehrung dieses
Satzes jedenfalls Ruskins Ausspruch als nicht stich-
haltig erkennen. Zudem dürften im vorliegenden
Falle die Sittenrichter nicht einmal ganz einig sein,
da Ruskin in der Hauptsache gegen Lawrence nur
den Vorwurf erhebt, zwei Damen gleichzeitig den
Hof gemacht zu haben. Gerade in den letztver-
gangenen Monaten, wo wir unter dem Zeichen
der hundertsten Wiederkehr von Kants Todestage
standen, erscheint es zur Sache gehörig, auf dessen
Ansichten hinzuweisen. Der große Philosoph hat
sich das unsterbliche Verdienst erworben, überzeugend
nachgewiesen zu haben, daß das Reich der Kunst und
der Moral jedes für sich ein autonomes ist.
Vom Jahre 1840—1890 blieb Lawrence sogar in
England vollständig vernachlässigt. Der Künstler galt
hinsichtlich seiner Darstellungsweise als ein zu auf-
fälliger Schmeichler. Die Porträtierten zahlten ihm
zwar diese gewinnende Liebenswürdigkeit in gleicher
Münze, das heißt in überschwänglichen Schmeicheleien
zurück, aber seine Kunst litt unter dieser gegenseitigen
unaufrichtigen Beziehungen. Allerdings hat Lawrence
niemals in seinem Leben Kämpfe zu bestehen gehabt!
Vor ca. 15 Jahren entdeckten nun die Franzosen
sozusagen den Meister von neuem und seitdem haben
sich seine hinterlassenen Werke ihre frühere Beliebt-
heit zum großen Teil in England wieder erobert.
Obschon man anerkennen muß, daß er ein guter
Zeichner und Kolorist ist und mit leichter, anmutiger,
ja mit bestechender Eleganz entwirft, so bin ich doch
unumwunden der Ansicht, daß gerade die große An-
zahl der hier ausgestellten Werke, in denen durch
Vergleich das Stereotype in seiner Kunst so deutlich
hervortritt, ihm eine teilweise Einbuße seines Ruhmes
bereiten wird.
Die besten Porträts von Lawrences Pinsel auf der
Ausstellung sind die vom Könige aus der »Windsor
Gallery« geliehenen, den Kardinal Gonsalvi, den
Staatssekretär Papst Pius' VIII., und ebenso des letzteren
Bildnis darstellend. Beide wurden kurze Zeit darauf,
nachdem sie von ihrem unfreiwilligen Aufenthalt in
Frankreich nach Italien zurückgekehrt waren, vom
Meister porträtiert. Der natürliche, individuelle Aus-
druck in den Gesichtern, der die Spuren geistigen
Leidens infolge der ihnen von Napoleon widerfahrenen
Unbill erkennen läßt, erhebt diese Werke zu der oben
angedeuteten Ausnahme in Lawrences Kunstbetätigung.
Von den übrigen männlichen Porträts, obgleich etwas
in Pose abgebildet, ist das hervorragendste das von
»Lord Ribblesdale«. In der Hauptsache aber bleibt
der Künstler der Liebling der Damenwelt, sowie
Frauen- und Kinderporträtist. Von den letzteren ist
das berühmteste und auch hier zur Stelle befindliche
Knabenbildnis Master Lambtom«. Samuel Cousins
hat viele der in der Ausstellung zu besichtigenden