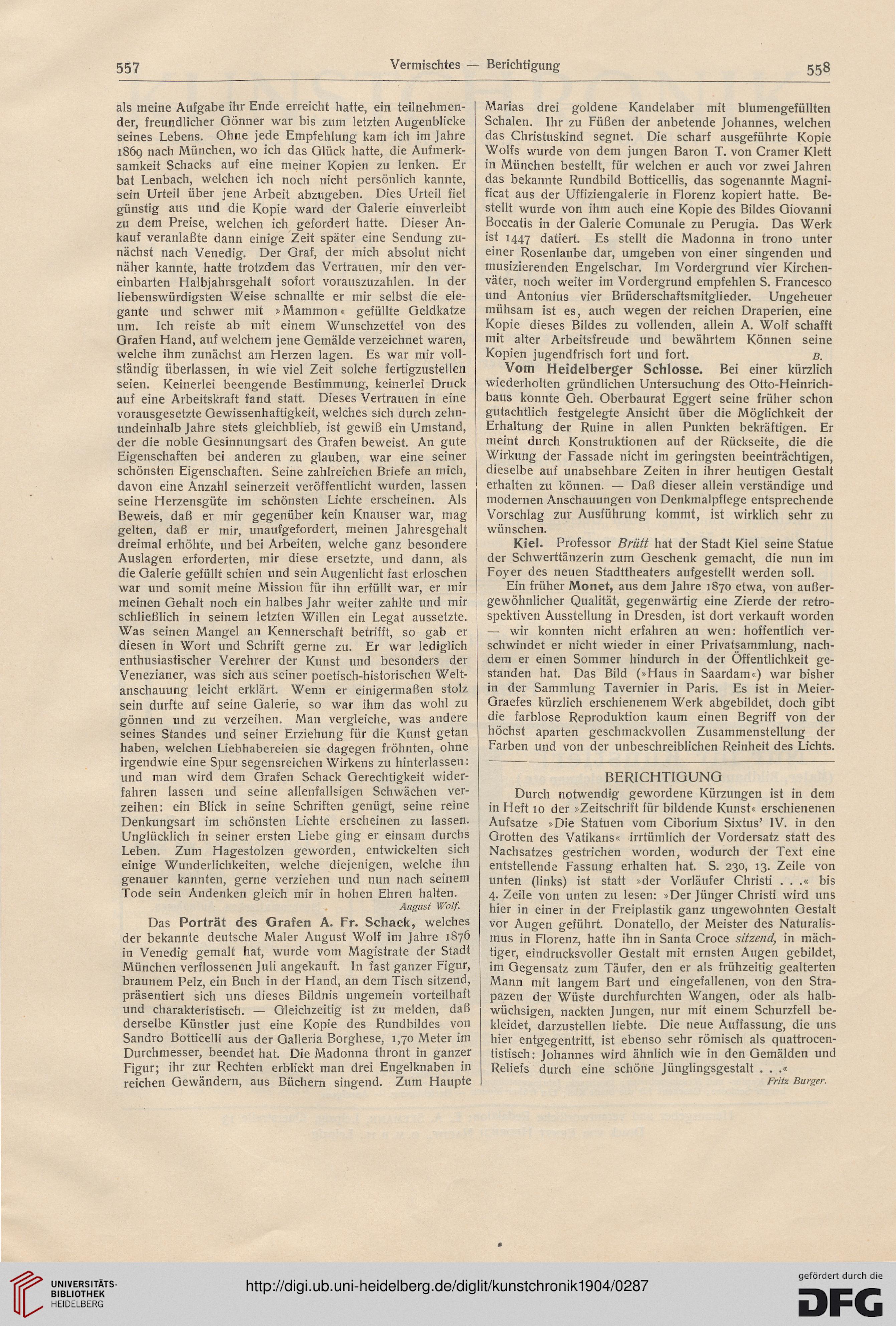557
Vermischtes — Berichtigung
558
als meine Aufgabe ihr Ende erreicht hatte, ein teilnehmen-
der, freundlicher Gönner war bis zum letzten Augenblicke
seines Lebens. Ohne jede Empfehlung kam ich im Jahre
1869 nach München, wo ich das Glück hatte, die Aufmerk-
samkeit Schacks auf eine meiner Kopien zu lenken. Er
bat Lenbach, welchen ich noch nicht persönlich kannte,
sein Urteil über jene Arbeit abzugeben. Dies Urteil fiel
günstig aus und die Kopie ward der Galerie einverleibt
zu dem Preise, welchen ich gefordert hatte. Dieser An-
kauf veranlaßte dann einige Zeit später eine Sendung zu-
nächst nach Venedig. Der Graf, der mich absolut nicht
näher kannte, hatte trotzdem das Vertrauen, mir den ver-
einbarten Halbjahrsgehalt sofort vorauszuzahlen. In der
liebenswürdigsten Weise schnallte er mir selbst die ele-
gante und schwer mit »Mammon« gefüllte Geldkatze
um. Ich reiste ab mit einem Wunschzettel von des
Grafen Hand, auf welchem jene Gemälde verzeichnet waren,
welche ihm zunächst am Herzen lagen. Es war mir voll-
ständig überlassen, in wie viel Zeit solche fertigzustellen
seien. Keinerlei beengende Bestimmung, keinerlei Druck
auf eine Arbeitskraft fand statt. Dieses Vertrauen in eine
vorausgesetzte Gewissenhaftigkeit, welches sich durch zehn-
undeinhalb Jahre stets gleichblieb, ist gewiß ein Umstand,
der die noble Gesinnungsart des Grafen beweist. An gute
Eigenschaften bei anderen zu glauben, war eine seiner
schönsten Eigenschaften. Seine zahlreichen Briefe an mich,
davon eine Anzahl seinerzeit veröffentlicht wurden, lassen
seine Herzensgüte im schönsten Lichte erscheinen. Als
Beweis, daß er mir gegenüber kein Knauser war, mag
gelten, daß er mir, unaufgefordert, meinen Jahresgehalt
dreimal erhöhte, und bei Arbeiten, welche ganz besondere
Auslagen erforderten, mir diese ersetzte, und dann, als
die Galerie gefüllt schien und sein Augenlicht fast erloschen
war und somit meine Mission für ihn erfüllt war, er mir
meinen Gehalt noch ein halbes Jahr weiter zahlte und mir
schließlich in seinem letzten Willen ein Legat aussetzte.
Was seinen Mangel an Kennerschaft betrifft, so gab er
diesen in Wort und Schrift gerne zu. Er war lediglich
enthusiastischer Verehrer der Kunst und besonders der
Venezianer, was sich aus seiner poetisch-historischen Welt-
anschauung leicht erklärt. Wenn er einigermaßen stolz
sein durfte auf seine Galerie, so war ihm das wohl zu
gönnen und zu verzeihen. Man vergleiche, was andere
seines Standes und seiner Erziehung für die Kunst getan
haben, welchen Liebhabereien sie dagegen fiöhnten, ohne
irgendwie eine Spur segensreichen Wirkens zu hinterlassen:
und man wird dem Grafen Schack Gerechtigkeit wider-
fahren lassen und seine allenfallsigen Schwächen ver-
zeihen: ein Blick in seine Schriften genügt, seine reine
Denkungsart im schönsten Lichte erscheinen zu lassen.
Unglücklich in seiner ersten Liebe ging er einsam durchs
Leben. Zum Hagestolzen geworden, entwickelten sich
einige Wunderlichkeiten, welche diejenigen, welche ihn
genauer kannten, gerne verziehen und nun nach seinem
Tode sein Andenken gleich mir in hohen Ehren halten.
August Wolf.
Das Porträt des Grafen A. Fr. Schack, welches
der bekannte deutsche Maler August Wolf im Jahre 1876
in Venedig gemalt hat, wurde vom Magistrate der Stadt
München verflossenen Juli angekauft. In fast ganzer Figur,
braunem Pelz, ein Buch in der Hand, an dem Tisch sitzend,
präsentiert sich uns dieses Bildnis ungemein vorteilhaft
und charakteristisch. — Gleichzeitig ist zu melden, daß
derselbe Künstler just eine Kopie des Rundbildes von
Sandro Botticelli aus der Galleria Borghese, 1,70 Meter im
Durchmesser, beendet hat. Die Madonna thront in ganzer
Figur; ihr zur Rechten erblickt man drei Engelknaben in
reichen Gewändern, aus Büchern singend. Zum Haupte
Marias drei goldene Kandelaber mit blumengefüllten
Schalen. Ihr zu Füßen der anbetende Johannes, welchen
das Christuskind segnet. Die scharf ausgeführte Kopie
Wolfs wurde von dem jungen Baron T. von Cramer Klett
in München bestellt, für welchen er auch vor zwei Jahren
das bekannte Rundbild Botticellis, das sogenannte Magni-
ficat aus der Uffiziengalerie in Florenz kopiert hatte. Be-
stellt wurde von ihm auch eine Kopie des Bildes Giovanni
Boccatis in der Galerie Comunale zu Perugia. Das Werk
ist 1447 datiert. Es stellt die Madonna in trono unter
einer Rosenlaube dar, umgeben von einer singenden und
musizierenden Engelschar. Im Vordergrund vier Kirchen-
väter, noch weiter im Vordergrund empfehlen S. Francesco
und Antonius vier Brüderschaftsmitglieder. Ungeheuer
mühsam ist es, auch wegen der reichen Draperien, eine
Kopie dieses Bildes zu vollenden, allein A. Wolf schafft
mit alter Arbeitsfreude und bewährtem Können seine
Kopien jugendfrisch fort und fort. b.
Vom Heidelberger Schlosse. Bei einer kürzlich
wiederholten gründlichen Untersuchung des Otto-Heinrich-
baus konnte Geh. Oberbaurat Eggert seine früher schon
gutachtlich festgelegte Ansicht über die Möglichkeit der
Erhaltung der Ruine in allen Punkten bekräftigen. Er
meint durch Konstruktionen auf der Rückseite, die die
Wirkung der Fassade nicht im geringsten beeinträchtigen,
dieselbe auf unabsehbare Zeiten in ihrer heutigen Gestalt
erhalten zu können. — Daß dieser allein verständige und
modernen Anschauungen von Denkmalpflege entsprechende
Vorschlag zur Ausführung kommt, ist wirklich sehr zu
wünschen.
Kiel. Professor Brätt hat der Stadt Kiel seine Statue
der Schwerttänzerin zum Geschenk gemacht, die nun im
Foyer des neuen Stadttheaters aufgestellt werden soll.
Ein früher Monet, aus dem Jahre 1870 etwa, von außer-
gewöhnlicher Qualität, gegenwärtig eine Zierde der retro-
spektiven Ausstellung in Dresden, ist dort verkauft worden
— wir konnten nicht erfahren an wen: hoffentlich ver-
schwindet er nicht wieder in einer Privatsammlung, nach-
dem er einen Sommer hindurch in der Öffentlichkeit ge-
standen hat. Das Bild (»Haus in Saardam«) war bisher
in der Sammlung Tavernier in Paris. Es ist in Meier-
Graefes kürzlich erschienenem Werk abgebildet, doch gibt
die farblose Reproduktion kaum einen Begriff von der
höchst aparten geschmackvollen Zusammenstellung der
Farben und von der unbeschreiblichen Reinheit des Lichts.
BERICHTIGUNG
Durch notwendig gewordene Kürzungen ist in dem
in Heft 10 der »Zeitschrift für bildende Kunst« erschienenen
Aufsatze »Die Statuen vom Ciborium Sixtus' IV. in den
Grotten des Vatikans« irrtümlich der Vordersatz statt des
Nachsatzes gestrichen worden, wodurch der Text eine
entstellende Fassung erhalten hat. S. 230, 13. Zeile von
unten (links) ist statt »der Vorläufer Christi . . .« bis
4. Zeile von unten zu lesen: »Der Jünger Christi wird uns
hier in einer in der Freiplastik ganz ungewohnten Gestalt
vor Augen geführt. Donatello, der Meister des Naturalis-
mus in Florenz, hatte ihn in Santa Croce sitzend, in mäch-
tiger, eindrucksvoller Gestalt mit ernsten Augen gebildet,
im Gegensatz zum Täufer, den er als frühzeitig gealterten
Mann mit langem Bart und eingefallenen, von den Stra-
pazen der Wüste durchfurchten Wangen, oder als halb-
wüchsigen, nackten Jungen, nur mit einem Schurzfell be-
kleidet, darzustellen liebte. Die neue Auffassung, die uns
hier entgegentritt, ist ebenso sehr römisch als quattrocen-
tistisch: Johannes wird ähnlich wie in den Gemälden und
Reliefs durch eine schöne Jünglingsgestalt . . .«
Fritz Burger.
Vermischtes — Berichtigung
558
als meine Aufgabe ihr Ende erreicht hatte, ein teilnehmen-
der, freundlicher Gönner war bis zum letzten Augenblicke
seines Lebens. Ohne jede Empfehlung kam ich im Jahre
1869 nach München, wo ich das Glück hatte, die Aufmerk-
samkeit Schacks auf eine meiner Kopien zu lenken. Er
bat Lenbach, welchen ich noch nicht persönlich kannte,
sein Urteil über jene Arbeit abzugeben. Dies Urteil fiel
günstig aus und die Kopie ward der Galerie einverleibt
zu dem Preise, welchen ich gefordert hatte. Dieser An-
kauf veranlaßte dann einige Zeit später eine Sendung zu-
nächst nach Venedig. Der Graf, der mich absolut nicht
näher kannte, hatte trotzdem das Vertrauen, mir den ver-
einbarten Halbjahrsgehalt sofort vorauszuzahlen. In der
liebenswürdigsten Weise schnallte er mir selbst die ele-
gante und schwer mit »Mammon« gefüllte Geldkatze
um. Ich reiste ab mit einem Wunschzettel von des
Grafen Hand, auf welchem jene Gemälde verzeichnet waren,
welche ihm zunächst am Herzen lagen. Es war mir voll-
ständig überlassen, in wie viel Zeit solche fertigzustellen
seien. Keinerlei beengende Bestimmung, keinerlei Druck
auf eine Arbeitskraft fand statt. Dieses Vertrauen in eine
vorausgesetzte Gewissenhaftigkeit, welches sich durch zehn-
undeinhalb Jahre stets gleichblieb, ist gewiß ein Umstand,
der die noble Gesinnungsart des Grafen beweist. An gute
Eigenschaften bei anderen zu glauben, war eine seiner
schönsten Eigenschaften. Seine zahlreichen Briefe an mich,
davon eine Anzahl seinerzeit veröffentlicht wurden, lassen
seine Herzensgüte im schönsten Lichte erscheinen. Als
Beweis, daß er mir gegenüber kein Knauser war, mag
gelten, daß er mir, unaufgefordert, meinen Jahresgehalt
dreimal erhöhte, und bei Arbeiten, welche ganz besondere
Auslagen erforderten, mir diese ersetzte, und dann, als
die Galerie gefüllt schien und sein Augenlicht fast erloschen
war und somit meine Mission für ihn erfüllt war, er mir
meinen Gehalt noch ein halbes Jahr weiter zahlte und mir
schließlich in seinem letzten Willen ein Legat aussetzte.
Was seinen Mangel an Kennerschaft betrifft, so gab er
diesen in Wort und Schrift gerne zu. Er war lediglich
enthusiastischer Verehrer der Kunst und besonders der
Venezianer, was sich aus seiner poetisch-historischen Welt-
anschauung leicht erklärt. Wenn er einigermaßen stolz
sein durfte auf seine Galerie, so war ihm das wohl zu
gönnen und zu verzeihen. Man vergleiche, was andere
seines Standes und seiner Erziehung für die Kunst getan
haben, welchen Liebhabereien sie dagegen fiöhnten, ohne
irgendwie eine Spur segensreichen Wirkens zu hinterlassen:
und man wird dem Grafen Schack Gerechtigkeit wider-
fahren lassen und seine allenfallsigen Schwächen ver-
zeihen: ein Blick in seine Schriften genügt, seine reine
Denkungsart im schönsten Lichte erscheinen zu lassen.
Unglücklich in seiner ersten Liebe ging er einsam durchs
Leben. Zum Hagestolzen geworden, entwickelten sich
einige Wunderlichkeiten, welche diejenigen, welche ihn
genauer kannten, gerne verziehen und nun nach seinem
Tode sein Andenken gleich mir in hohen Ehren halten.
August Wolf.
Das Porträt des Grafen A. Fr. Schack, welches
der bekannte deutsche Maler August Wolf im Jahre 1876
in Venedig gemalt hat, wurde vom Magistrate der Stadt
München verflossenen Juli angekauft. In fast ganzer Figur,
braunem Pelz, ein Buch in der Hand, an dem Tisch sitzend,
präsentiert sich uns dieses Bildnis ungemein vorteilhaft
und charakteristisch. — Gleichzeitig ist zu melden, daß
derselbe Künstler just eine Kopie des Rundbildes von
Sandro Botticelli aus der Galleria Borghese, 1,70 Meter im
Durchmesser, beendet hat. Die Madonna thront in ganzer
Figur; ihr zur Rechten erblickt man drei Engelknaben in
reichen Gewändern, aus Büchern singend. Zum Haupte
Marias drei goldene Kandelaber mit blumengefüllten
Schalen. Ihr zu Füßen der anbetende Johannes, welchen
das Christuskind segnet. Die scharf ausgeführte Kopie
Wolfs wurde von dem jungen Baron T. von Cramer Klett
in München bestellt, für welchen er auch vor zwei Jahren
das bekannte Rundbild Botticellis, das sogenannte Magni-
ficat aus der Uffiziengalerie in Florenz kopiert hatte. Be-
stellt wurde von ihm auch eine Kopie des Bildes Giovanni
Boccatis in der Galerie Comunale zu Perugia. Das Werk
ist 1447 datiert. Es stellt die Madonna in trono unter
einer Rosenlaube dar, umgeben von einer singenden und
musizierenden Engelschar. Im Vordergrund vier Kirchen-
väter, noch weiter im Vordergrund empfehlen S. Francesco
und Antonius vier Brüderschaftsmitglieder. Ungeheuer
mühsam ist es, auch wegen der reichen Draperien, eine
Kopie dieses Bildes zu vollenden, allein A. Wolf schafft
mit alter Arbeitsfreude und bewährtem Können seine
Kopien jugendfrisch fort und fort. b.
Vom Heidelberger Schlosse. Bei einer kürzlich
wiederholten gründlichen Untersuchung des Otto-Heinrich-
baus konnte Geh. Oberbaurat Eggert seine früher schon
gutachtlich festgelegte Ansicht über die Möglichkeit der
Erhaltung der Ruine in allen Punkten bekräftigen. Er
meint durch Konstruktionen auf der Rückseite, die die
Wirkung der Fassade nicht im geringsten beeinträchtigen,
dieselbe auf unabsehbare Zeiten in ihrer heutigen Gestalt
erhalten zu können. — Daß dieser allein verständige und
modernen Anschauungen von Denkmalpflege entsprechende
Vorschlag zur Ausführung kommt, ist wirklich sehr zu
wünschen.
Kiel. Professor Brätt hat der Stadt Kiel seine Statue
der Schwerttänzerin zum Geschenk gemacht, die nun im
Foyer des neuen Stadttheaters aufgestellt werden soll.
Ein früher Monet, aus dem Jahre 1870 etwa, von außer-
gewöhnlicher Qualität, gegenwärtig eine Zierde der retro-
spektiven Ausstellung in Dresden, ist dort verkauft worden
— wir konnten nicht erfahren an wen: hoffentlich ver-
schwindet er nicht wieder in einer Privatsammlung, nach-
dem er einen Sommer hindurch in der Öffentlichkeit ge-
standen hat. Das Bild (»Haus in Saardam«) war bisher
in der Sammlung Tavernier in Paris. Es ist in Meier-
Graefes kürzlich erschienenem Werk abgebildet, doch gibt
die farblose Reproduktion kaum einen Begriff von der
höchst aparten geschmackvollen Zusammenstellung der
Farben und von der unbeschreiblichen Reinheit des Lichts.
BERICHTIGUNG
Durch notwendig gewordene Kürzungen ist in dem
in Heft 10 der »Zeitschrift für bildende Kunst« erschienenen
Aufsatze »Die Statuen vom Ciborium Sixtus' IV. in den
Grotten des Vatikans« irrtümlich der Vordersatz statt des
Nachsatzes gestrichen worden, wodurch der Text eine
entstellende Fassung erhalten hat. S. 230, 13. Zeile von
unten (links) ist statt »der Vorläufer Christi . . .« bis
4. Zeile von unten zu lesen: »Der Jünger Christi wird uns
hier in einer in der Freiplastik ganz ungewohnten Gestalt
vor Augen geführt. Donatello, der Meister des Naturalis-
mus in Florenz, hatte ihn in Santa Croce sitzend, in mäch-
tiger, eindrucksvoller Gestalt mit ernsten Augen gebildet,
im Gegensatz zum Täufer, den er als frühzeitig gealterten
Mann mit langem Bart und eingefallenen, von den Stra-
pazen der Wüste durchfurchten Wangen, oder als halb-
wüchsigen, nackten Jungen, nur mit einem Schurzfell be-
kleidet, darzustellen liebte. Die neue Auffassung, die uns
hier entgegentritt, ist ebenso sehr römisch als quattrocen-
tistisch: Johannes wird ähnlich wie in den Gemälden und
Reliefs durch eine schöne Jünglingsgestalt . . .«
Fritz Burger.