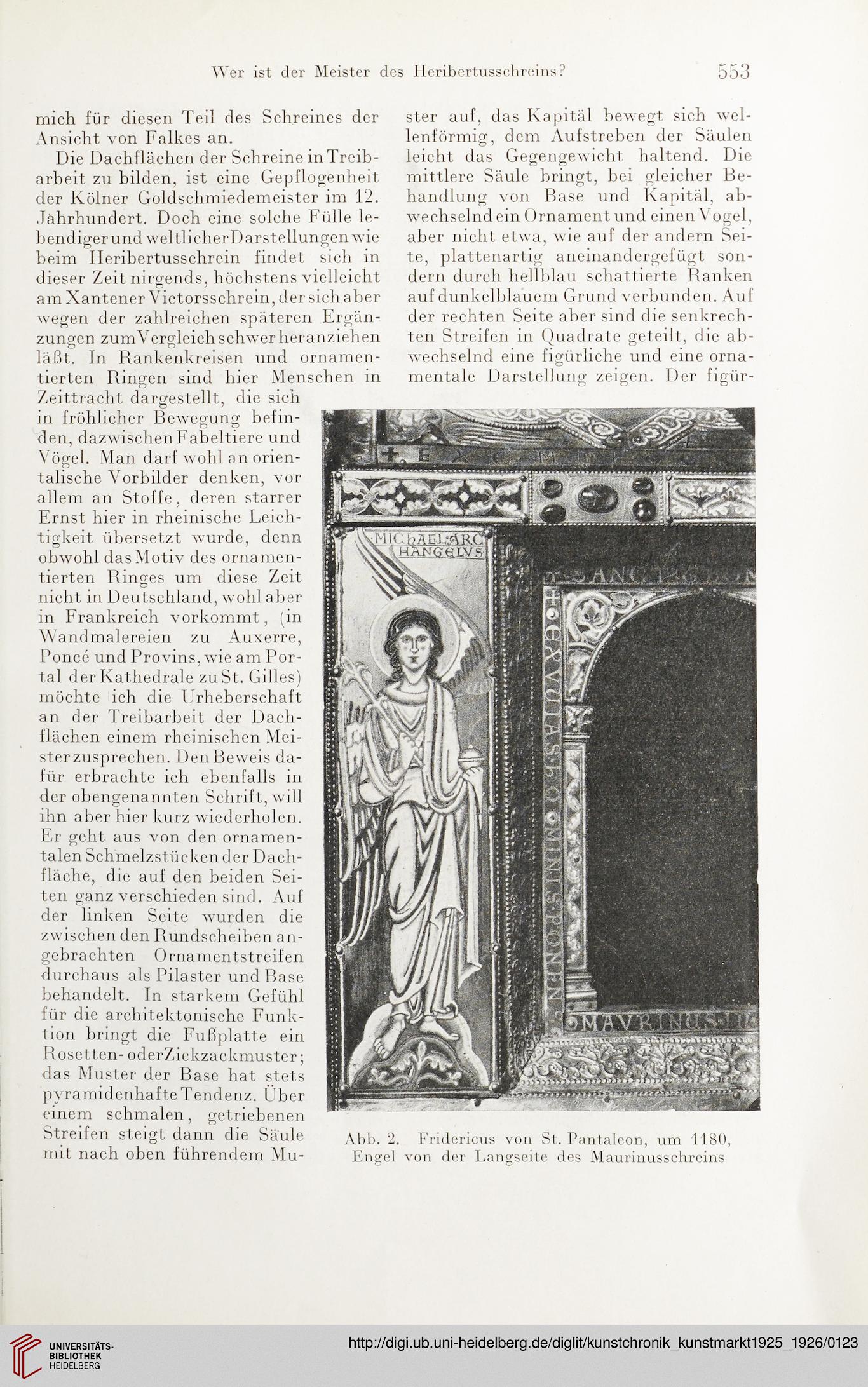Wer ist der Meister des Heribertusschreins?
553
mich für diesen Teil des Schreines der
Ansicht von Falkes an.
Die Dachflächen der Schreine in Treib-
arbeit zu bilden, ist eine Gepflogenheit
der Kölner Goldschmiedemeister im 12.
Jahrhundert. Doch eine solche Fülle le-
bendiger und weltlicher Darstellungen wie
beim IJeribertusschrein findet sich in
dieser Zeit nirgends, höchstens vielleicht
amXantener Victorsschrein, der sich aber
wegen der zahlreichen späteren Ergän-
zungen zumYergleich schwer heranziehen
läßt. In Rankenkreisen und ornamen-
tierten Ringen sind hier Menschen in
Zeittracht dargestellt, die sich
in fröhlicher Bewegung befin-
den, dazwischen Fabeltiere und
Vögel. Man darf wohl an orien-
talische Vorbilder denken, vor
allem an Stoffe, deren starrer
Ernst hier in rheinische Leich-
tigkeit übersetzt wurde, denn
obwohl das Motiv des ornamen-
tierten Ringes um diese Zeit
nicht in Deutschland, wohl aber
in Frankreich vorkommt, (in
Wandmalereien zu Auxerre,
Ponce und Provins, wie am Por-
tal der Kathedrale zu St. Gilles)
möchte ich die Urheberschaft
an der Treibarbeit der Dach-
flächen einem rheinischen Mei-
ster zusprechen. Den Beweis da-
für erbrachte ich ebenfalls in
der obengenannten Schrift, will
ihn aber hier kurz wiederholen.
Er geht aus von den ornamen-
talen Schmelzstücken der Dach-
fläche, die auf den beiden Sei-
ten ganz verschieden sind. Auf
der linken Seite wurden die
zwischen den Rundscheiben an-
gebrachten Ornamentstreifen
durchaus als Pilaster und Base
behandelt. In starkem Gefühl
für die architektonische Funk-
tion bringt die Fußplatte ein
Rosetten- oderZickzackmuster;
das Muster der Base hat stets
pyramidenhafteTendenz. Über
einem schmalen, getriebenen
Streifen steigt dann die Säule Abb. 2. Fridericus von St. Pantaleon, um 1180,
mit nach oben führendem Mu- Engel von der Langseite des Maurinusschreins
ster auf, das Kapitäl bewegt sich wel-
lenförmig, dem Aufstreben der Säulen
leicht das Gegengewicht haltend. Die
mittlere Säule bringt, bei gleicher Be-
handlung von Base und Kapitäl, ab-
wechselndein Ornament und einen Vogel,
aber nicht etwa, wie auf der andern Sei-
te, plattenartig aneinandergefügt son-
dern durch hellblau schattierte Ranken
auf dunkelblauem Grund verbunden. Auf
der rechten Seite aber sind die senkrech-
ten Streifen in Quadrate geteilt, die ab-
wechselnd eine figürliche und eine orna-
mentale Darstellung zeigen. Der figür-
553
mich für diesen Teil des Schreines der
Ansicht von Falkes an.
Die Dachflächen der Schreine in Treib-
arbeit zu bilden, ist eine Gepflogenheit
der Kölner Goldschmiedemeister im 12.
Jahrhundert. Doch eine solche Fülle le-
bendiger und weltlicher Darstellungen wie
beim IJeribertusschrein findet sich in
dieser Zeit nirgends, höchstens vielleicht
amXantener Victorsschrein, der sich aber
wegen der zahlreichen späteren Ergän-
zungen zumYergleich schwer heranziehen
läßt. In Rankenkreisen und ornamen-
tierten Ringen sind hier Menschen in
Zeittracht dargestellt, die sich
in fröhlicher Bewegung befin-
den, dazwischen Fabeltiere und
Vögel. Man darf wohl an orien-
talische Vorbilder denken, vor
allem an Stoffe, deren starrer
Ernst hier in rheinische Leich-
tigkeit übersetzt wurde, denn
obwohl das Motiv des ornamen-
tierten Ringes um diese Zeit
nicht in Deutschland, wohl aber
in Frankreich vorkommt, (in
Wandmalereien zu Auxerre,
Ponce und Provins, wie am Por-
tal der Kathedrale zu St. Gilles)
möchte ich die Urheberschaft
an der Treibarbeit der Dach-
flächen einem rheinischen Mei-
ster zusprechen. Den Beweis da-
für erbrachte ich ebenfalls in
der obengenannten Schrift, will
ihn aber hier kurz wiederholen.
Er geht aus von den ornamen-
talen Schmelzstücken der Dach-
fläche, die auf den beiden Sei-
ten ganz verschieden sind. Auf
der linken Seite wurden die
zwischen den Rundscheiben an-
gebrachten Ornamentstreifen
durchaus als Pilaster und Base
behandelt. In starkem Gefühl
für die architektonische Funk-
tion bringt die Fußplatte ein
Rosetten- oderZickzackmuster;
das Muster der Base hat stets
pyramidenhafteTendenz. Über
einem schmalen, getriebenen
Streifen steigt dann die Säule Abb. 2. Fridericus von St. Pantaleon, um 1180,
mit nach oben führendem Mu- Engel von der Langseite des Maurinusschreins
ster auf, das Kapitäl bewegt sich wel-
lenförmig, dem Aufstreben der Säulen
leicht das Gegengewicht haltend. Die
mittlere Säule bringt, bei gleicher Be-
handlung von Base und Kapitäl, ab-
wechselndein Ornament und einen Vogel,
aber nicht etwa, wie auf der andern Sei-
te, plattenartig aneinandergefügt son-
dern durch hellblau schattierte Ranken
auf dunkelblauem Grund verbunden. Auf
der rechten Seite aber sind die senkrech-
ten Streifen in Quadrate geteilt, die ab-
wechselnd eine figürliche und eine orna-
mentale Darstellung zeigen. Der figür-