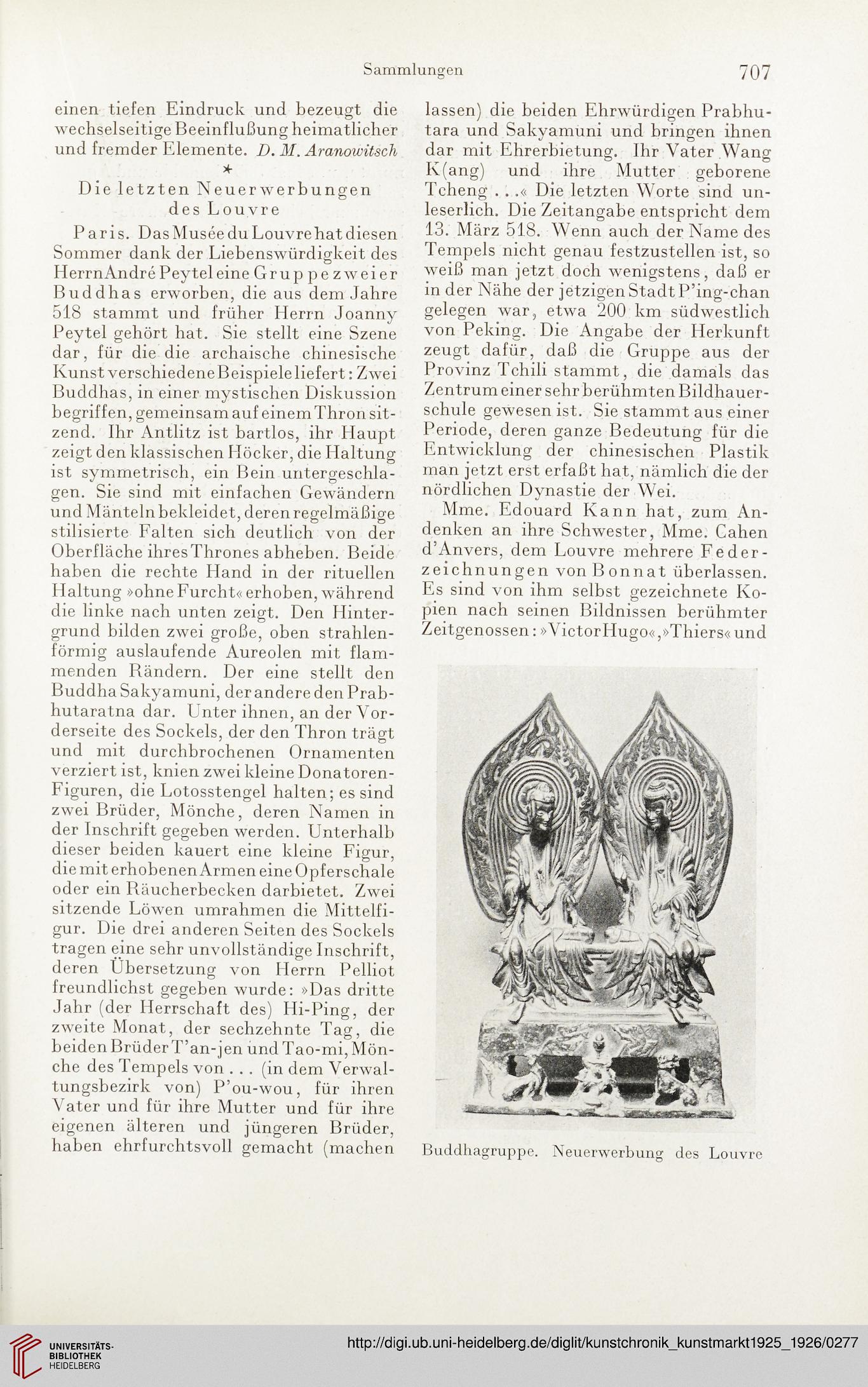Sammlungen
707
einen tiefen Eindruck und bezeugt die
wechselseitige Beeinflußung heimatlicher
und fremder Elemente. D. M. Aranowitsch
*
Die letzten Neuerwerbungen
des Louvre
Paris. DasMuseedu Louvrehat diesen
Sommer dank der Liebenswürdigkeit des
HerrnAndre Peyteleine Grup pe zwei er
Buddhas erworben, die aus dem Jahre
518 stammt und früher Herrn Joanny
Peytel gehört hat. Sie stellt eine Szene
dar, für die die archaische chinesische
Kunst verschiedene Beispiele liefert: Zwei
Buddhas, in einer mystischen Diskussion
begriffen, gemeinsam auf einem Thron sit-
zend. Ihr Antlitz ist bartlos, ihr Haupt
zeigt den klassischen Höcker, die Haltung
ist symmetrisch, ein Bein untergeschla-
gen. Sie sind mit einfachen Gewändern
und Mänteln bekleidet, deren regelmäßige
stilisierte Palten sich deutlich von der
Oberfläche ihresThrones abheben. Beide
haben die rechte Hand in der rituellen
Haltung »ohne Purcht« erhoben, während
die linke nach unten zeigt. Den Hinter-
grund bilden zwei große, oben strahlen-
förmig auslaufende Aureolen mit flam-
menden Rändern. Der eine stellt den
Buddha Sakyamuni, der andere den Prab-
hutaratna dar. Unter ihnen, an der Vor-
derseite des Sockels, der den Thron trägt
und mit durchbrochenen Ornamenten
verziert ist, knien zwei kleine Donatoren-
Piguren, die Lotosstengel halten; es sind
zwei Brüder, Mönche, deren Namen in
der Inschrift gegeben werden. Unterhalb
dieser beiden kauert eine kleine Pigur,
die mit erhobenen Armen eine Opferschale
oder ein Räucherhecken darbietet. Zwei
sitzende Löwen umrahmen die Mittelfi-
gur. Die drei anderen Seiten des Sockels
tragen eine sehr unvollständige Inschrift,
deren Übersetzung von Herrn Pelliot
freundlichst gegeben wurde: »Das dritte
Jahr (der Herrschaft des) Hi-Ping, der
zweite Monat, der sechzehnte Tag, die
beiden Brüder T’an-jen und Tao-mi, Mön-
che des Tempels von ... (in dem Verwal-
tungsbezirk von) P’ou-wou, für ihren
Vater und für ihre Mutter und für ihre
eigenen älteren und jüngeren Brüder,
haben ehrfurchtsvoll gemacht (machen
lassen) die beiden Ehrwürdigen Prabhu-
tara und Sakyamuni und bringen ihnen
dar mit Ehrerbietung. Ihr Vater Wang
Iv(ang) und ihre Mutter geborene
Tcheng . . .« Die letzten Worte sind un-
leserlich. Die Zeitangabe entspricht dem
13. März 518. Wenn auch der Name des
Tempels nicht genau festzustellen ist, so
weiß man jetzt doch wenigstens, daß er
in der Nähe der jetzigen Stadt P’ing-chan
gelegen war, etwa 200 km südwestlich
von Peking. Die Angabe der Herkunft
zeugt dafür, daß die Gruppe aus der
Provinz Tchili stammt, die damals das
Zentrum einer sehr berühmten Bildhauer-
schule gewesen ist. Sie stammt aus einer
Periode, deren ganze Bedeutung für die
Entwicklung der chinesischen Plastik
man jetzt erst erfaßt hat, nämlich die der
nördlichen Dynastie der Wei.
Mme. Edouard Kann hat, zum An-
denken an ihre Schwester, Mme. Cahen
d’Anvers, dem Louvre mehrere Feder-
zeichnungen von B onnat überlassen.
Es sind von ihm selbst gezeichnete Ko-
pien nach seinen Bildnissen berühmter
Zeitgenossen: »VictorPIugo«,»Thiers« und
Buddhagruppe. Neuerwerbung des Louvre
707
einen tiefen Eindruck und bezeugt die
wechselseitige Beeinflußung heimatlicher
und fremder Elemente. D. M. Aranowitsch
*
Die letzten Neuerwerbungen
des Louvre
Paris. DasMuseedu Louvrehat diesen
Sommer dank der Liebenswürdigkeit des
HerrnAndre Peyteleine Grup pe zwei er
Buddhas erworben, die aus dem Jahre
518 stammt und früher Herrn Joanny
Peytel gehört hat. Sie stellt eine Szene
dar, für die die archaische chinesische
Kunst verschiedene Beispiele liefert: Zwei
Buddhas, in einer mystischen Diskussion
begriffen, gemeinsam auf einem Thron sit-
zend. Ihr Antlitz ist bartlos, ihr Haupt
zeigt den klassischen Höcker, die Haltung
ist symmetrisch, ein Bein untergeschla-
gen. Sie sind mit einfachen Gewändern
und Mänteln bekleidet, deren regelmäßige
stilisierte Palten sich deutlich von der
Oberfläche ihresThrones abheben. Beide
haben die rechte Hand in der rituellen
Haltung »ohne Purcht« erhoben, während
die linke nach unten zeigt. Den Hinter-
grund bilden zwei große, oben strahlen-
förmig auslaufende Aureolen mit flam-
menden Rändern. Der eine stellt den
Buddha Sakyamuni, der andere den Prab-
hutaratna dar. Unter ihnen, an der Vor-
derseite des Sockels, der den Thron trägt
und mit durchbrochenen Ornamenten
verziert ist, knien zwei kleine Donatoren-
Piguren, die Lotosstengel halten; es sind
zwei Brüder, Mönche, deren Namen in
der Inschrift gegeben werden. Unterhalb
dieser beiden kauert eine kleine Pigur,
die mit erhobenen Armen eine Opferschale
oder ein Räucherhecken darbietet. Zwei
sitzende Löwen umrahmen die Mittelfi-
gur. Die drei anderen Seiten des Sockels
tragen eine sehr unvollständige Inschrift,
deren Übersetzung von Herrn Pelliot
freundlichst gegeben wurde: »Das dritte
Jahr (der Herrschaft des) Hi-Ping, der
zweite Monat, der sechzehnte Tag, die
beiden Brüder T’an-jen und Tao-mi, Mön-
che des Tempels von ... (in dem Verwal-
tungsbezirk von) P’ou-wou, für ihren
Vater und für ihre Mutter und für ihre
eigenen älteren und jüngeren Brüder,
haben ehrfurchtsvoll gemacht (machen
lassen) die beiden Ehrwürdigen Prabhu-
tara und Sakyamuni und bringen ihnen
dar mit Ehrerbietung. Ihr Vater Wang
Iv(ang) und ihre Mutter geborene
Tcheng . . .« Die letzten Worte sind un-
leserlich. Die Zeitangabe entspricht dem
13. März 518. Wenn auch der Name des
Tempels nicht genau festzustellen ist, so
weiß man jetzt doch wenigstens, daß er
in der Nähe der jetzigen Stadt P’ing-chan
gelegen war, etwa 200 km südwestlich
von Peking. Die Angabe der Herkunft
zeugt dafür, daß die Gruppe aus der
Provinz Tchili stammt, die damals das
Zentrum einer sehr berühmten Bildhauer-
schule gewesen ist. Sie stammt aus einer
Periode, deren ganze Bedeutung für die
Entwicklung der chinesischen Plastik
man jetzt erst erfaßt hat, nämlich die der
nördlichen Dynastie der Wei.
Mme. Edouard Kann hat, zum An-
denken an ihre Schwester, Mme. Cahen
d’Anvers, dem Louvre mehrere Feder-
zeichnungen von B onnat überlassen.
Es sind von ihm selbst gezeichnete Ko-
pien nach seinen Bildnissen berühmter
Zeitgenossen: »VictorPIugo«,»Thiers« und
Buddhagruppe. Neuerwerbung des Louvre