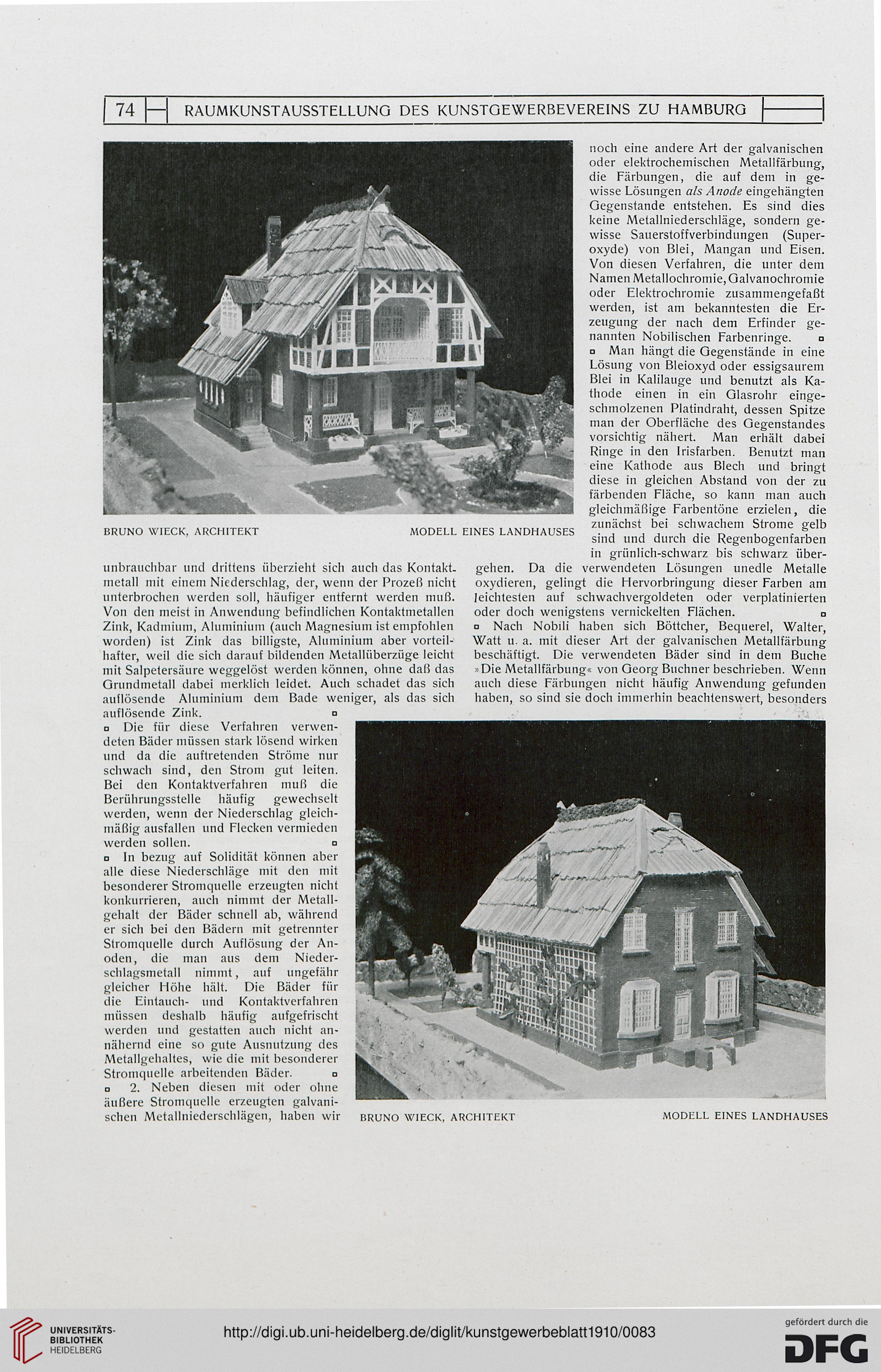74
RAUMKUNSTAUSSTELLUNG DES KUNSTGEWERBEVEREINS ZU HAMBURG
BRUNO WIECK, ARCHITEKT
unbrauchbar und drittens überzieht sich auch das Kontakt-
nietall mit einem Niederschlag, der, wenn der Prozeß nicht
unterbrochen werden soll, häufiger entfernt werden muß.
Von den meist in Anwendung befindlichen Kontaktmetallen
Zink, Kadmium, Aluminium (auch Magnesium ist empfohlen
worden) ist Zink das billigste, Aluminium aber vorteil-
hafter, weil die sich darauf bildenden Metallüberzüge leicht
mit Salpetersäure weggelöst werden können, ohne daß das
Grtindmetall dabei merklich leidet. Auch schadet das sich
auflösende Aluminium dem Bade weniger, als das sich
auflösende Zink. □
d Die für diese Verfahren verwen-
deten Bäder müssen stark lösend wirken
und da die auftretenden Ströme nur
schwach sind, den Strom gut leiten.
Bei den Kontaktverfahren muß die
Berührungsstelle häufig gewechselt
werden, wenn der Niederschlag gleich-
mäßig ausfallen und Flecken vermieden
werden sollen. n
o In bezug auf Solidität können aber
alle diese Niederschläge mit den mit
besonderer Stromquelle erzeugten nicht
konkurrieren, auch nimmt der Metall-
gehalt der Bäder schnell ab, während
er sich bei den Bädern mit getrennter
Stromquelle durch Auflösung der An-
oden, die man aus dein Nieder-
schlagsmetall nimmt, auf ungefähr
gleicher Höhe hält. Die Bäder für
die Eintauch- und Kontaktverfahren
müssen deshalb häufig aufgefrischt
werden und gestatten auch nicht an-
nähernd eine so gute Ausnutzung des
Metallgehaltes, wie die mit besonderer
Stromquelle arbeitenden Bäder. a
d 2. Neben diesen mit oder ohne
äußere Stromquelle erzeugten galvani-
schen Metallniederschlägen, haben wir
noch eine andere Art der galvanischen
oder elektrochemischen Metallfärbung,
die Färbungen, die auf dem in ge-
wisse Lösungen als Anode eingehängten
Gegenstande entstehen. Es sind dies
keine Metallniederschläge, sondern ge-
wisse Sauerstoffverbindungen (Super-
oxyde) von Blei, Mangan und Eisen.
Von diesen Verfahren, die unter dem
Namen Metallochromie,Galvanochromie
oder Elektrochromie zusammengefaßt
werden, ist am bekanntesten die Er-
zeugung der nach dem Erfinder ge-
nannten Nobilischen Farbenringe. o
n Man hängt die Gegenstände in eine
Lösung von Bleioxyd oder essigsaurem
Blei in Kalilauge und benutzt als Ka-
thode einen in ein Glasrohr einge-
schmolzenen Platindraht, dessen Spitze
man der Oberfläche des Gegenstandes
vorsichtig nähert. Man erhält dabei
Ringe in den Irisfarben. Benutzt man
eine Kathode aus Blech und bringt
diese in gleichen Abstand von der zu
färbenden Fläche, so kann man auch
gleichmäßige Farbentöne erzielen, die
zunächst bei schwachem Strome gelb
sind und durch die Regenbogenfarben
in grünlich-schwarz bis schwarz über-
gehen. Da die verwendeten Lösungen unedle Metalle
oxydieren, gelingt die Hervorbringung dieser Farben am
leichtesten auf schwachvergoldeten oder verplatinierten
oder doch wenigstens vernickelten Flächen. n
□ Nach Nobili haben sich Böttcher, Bequerel, Walter,
Watt u. a. mit dieser Art der galvanischen Metallfärbung
beschäftigt. Die verwendeten Bäder sind in dem Buche
»Die Metallfärbung« von Georg Buchner beschrieben. Wenn
auch diese Färbungen nicht häufig Anwendung gefunden
haben, so sind sie doch immerhin beachtenswert, besonders
MODELL EINES LANDHAUSES
BRUNO WIECK, ARCHITEKT
MODELL EINES LANDHAUSES
RAUMKUNSTAUSSTELLUNG DES KUNSTGEWERBEVEREINS ZU HAMBURG
BRUNO WIECK, ARCHITEKT
unbrauchbar und drittens überzieht sich auch das Kontakt-
nietall mit einem Niederschlag, der, wenn der Prozeß nicht
unterbrochen werden soll, häufiger entfernt werden muß.
Von den meist in Anwendung befindlichen Kontaktmetallen
Zink, Kadmium, Aluminium (auch Magnesium ist empfohlen
worden) ist Zink das billigste, Aluminium aber vorteil-
hafter, weil die sich darauf bildenden Metallüberzüge leicht
mit Salpetersäure weggelöst werden können, ohne daß das
Grtindmetall dabei merklich leidet. Auch schadet das sich
auflösende Aluminium dem Bade weniger, als das sich
auflösende Zink. □
d Die für diese Verfahren verwen-
deten Bäder müssen stark lösend wirken
und da die auftretenden Ströme nur
schwach sind, den Strom gut leiten.
Bei den Kontaktverfahren muß die
Berührungsstelle häufig gewechselt
werden, wenn der Niederschlag gleich-
mäßig ausfallen und Flecken vermieden
werden sollen. n
o In bezug auf Solidität können aber
alle diese Niederschläge mit den mit
besonderer Stromquelle erzeugten nicht
konkurrieren, auch nimmt der Metall-
gehalt der Bäder schnell ab, während
er sich bei den Bädern mit getrennter
Stromquelle durch Auflösung der An-
oden, die man aus dein Nieder-
schlagsmetall nimmt, auf ungefähr
gleicher Höhe hält. Die Bäder für
die Eintauch- und Kontaktverfahren
müssen deshalb häufig aufgefrischt
werden und gestatten auch nicht an-
nähernd eine so gute Ausnutzung des
Metallgehaltes, wie die mit besonderer
Stromquelle arbeitenden Bäder. a
d 2. Neben diesen mit oder ohne
äußere Stromquelle erzeugten galvani-
schen Metallniederschlägen, haben wir
noch eine andere Art der galvanischen
oder elektrochemischen Metallfärbung,
die Färbungen, die auf dem in ge-
wisse Lösungen als Anode eingehängten
Gegenstande entstehen. Es sind dies
keine Metallniederschläge, sondern ge-
wisse Sauerstoffverbindungen (Super-
oxyde) von Blei, Mangan und Eisen.
Von diesen Verfahren, die unter dem
Namen Metallochromie,Galvanochromie
oder Elektrochromie zusammengefaßt
werden, ist am bekanntesten die Er-
zeugung der nach dem Erfinder ge-
nannten Nobilischen Farbenringe. o
n Man hängt die Gegenstände in eine
Lösung von Bleioxyd oder essigsaurem
Blei in Kalilauge und benutzt als Ka-
thode einen in ein Glasrohr einge-
schmolzenen Platindraht, dessen Spitze
man der Oberfläche des Gegenstandes
vorsichtig nähert. Man erhält dabei
Ringe in den Irisfarben. Benutzt man
eine Kathode aus Blech und bringt
diese in gleichen Abstand von der zu
färbenden Fläche, so kann man auch
gleichmäßige Farbentöne erzielen, die
zunächst bei schwachem Strome gelb
sind und durch die Regenbogenfarben
in grünlich-schwarz bis schwarz über-
gehen. Da die verwendeten Lösungen unedle Metalle
oxydieren, gelingt die Hervorbringung dieser Farben am
leichtesten auf schwachvergoldeten oder verplatinierten
oder doch wenigstens vernickelten Flächen. n
□ Nach Nobili haben sich Böttcher, Bequerel, Walter,
Watt u. a. mit dieser Art der galvanischen Metallfärbung
beschäftigt. Die verwendeten Bäder sind in dem Buche
»Die Metallfärbung« von Georg Buchner beschrieben. Wenn
auch diese Färbungen nicht häufig Anwendung gefunden
haben, so sind sie doch immerhin beachtenswert, besonders
MODELL EINES LANDHAUSES
BRUNO WIECK, ARCHITEKT
MODELL EINES LANDHAUSES