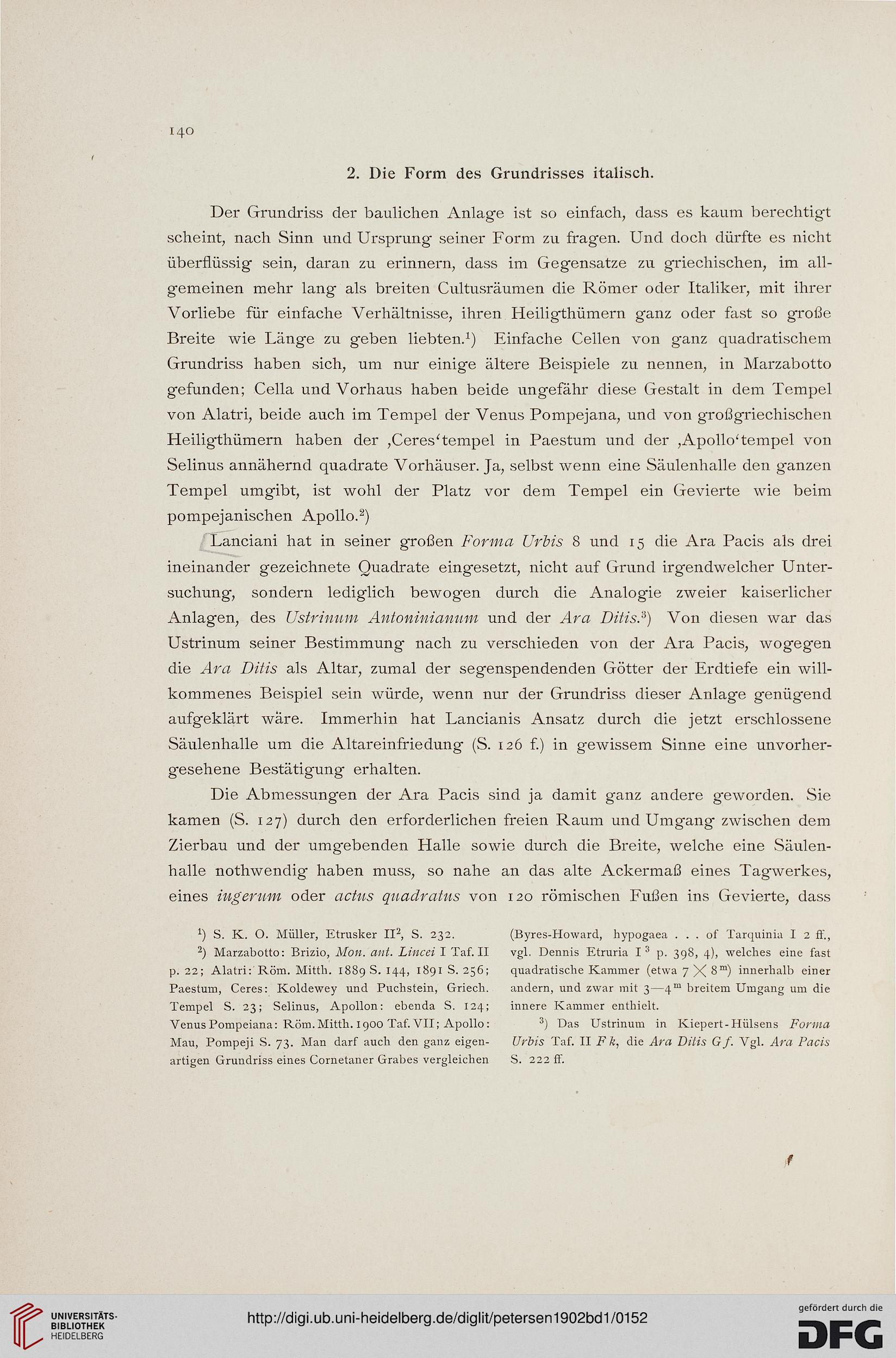140
2. Die Form des Grundrisses italisch.
Der Grundriss der baulichen Anlage ist so einfach, dass es kaum berechtigt
scheint, nach Sinn und Ursprung seiner Form zu fragen. Und doch dürfte es nicht
überflüssig sein, daran zu erinnern, dass im Gegensatze zu griechischen, im all-
gemeinen mehr lang als breiten Cultusräumen die Römer oder Italiker, mit ihrer
Vorliebe für einfache Verhältnisse, ihren Heiligthümern ganz oder fast so große
Breite wie Länge zu geben liebten.1) Einfache Cellen von ganz quadratischem
Grundriss haben sich, um nur einige ältere Beispiele zu nennen, in Marzabotto
gefunden; Cella und Vorhaus haben beide ungefähr diese Gestalt in dem Tempel
von Alatri, beide auch im Tempel der Venus Pompejana, und von großgriechischen
Heiligthümern haben der ,Ceres'tempel in Paestum und der ,Apollo'tempel von
Selinus annähernd quadrate Vorhäuser. Ja, selbst wenn eine Säulenhalle den ganzen
Tempel umgibt, ist wohl der Platz vor dem Tempel ein Gevierte wie beim
pompejanischen Apollo.2)
Lanciani hat in seiner großen Forma Urbis 8 und 15 die Ära Pacis als drei
ineinander gezeichnete Quadrate eingesetzt, nicht auf Grund irgendwelcher Unter-
suchung, sondern lediglich bewogen durch die Analogie zweier kaiserlicher
Anlagen, des Ustrinum Antoninianum und der Ära Ditis.'A) Von diesen war das
Ustrinum seiner Bestimmung nach zu verschieden von der Ära Pacis, wogegen
die Ära Ditis als Altar, zumal der segenspendenden Götter der Erdtiefe ein will-
kommenes Beispiel sein würde, wenn nur der Grundriss dieser Anlage genügend
aufgeklärt wäre. Immerhin hat Lancianis Ansatz durch die jetzt erschlossene
Säulenhalle um die Altareinfriedung (S. 126 f.) in gewissem Sinne eine unvorher-
gesehene Bestätigung erhalten.
Die Abmessungen der Ära Pacis sind ja damit ganz andere geworden. Sie
kamen (S. 127) durch den erforderlichen freien Raum und Umgang zwischen dem
Zierbau und der umgebenden Halle sowie durch die Breite, welche eine Säulen-
halle nothwendig haben muss, so nahe an das alte Ackermaß eines Tagwerkes,
eines iugerum oder actus quadratus von 120 römischen Fußen ins Gevierte, dass
!) S. K. O. Müller, Etrusker II2, S. 232.
2) Marzabotto: Brizio, Mon. ant. Lincei I Taf. II
p. 22; Alatri:'Rom. Mitfh. 1889 S. 144, 1891S. 256;
Paestum, Ceres: Koldewey und Puchstein, Griech.
Tempel S. 23; Selinus, Apollon: ebenda S. 124;
Venus Pompeiana: Rom.Mitth. 1900 Taf. VII; Apollo:
Mau, Pompeji S. 73. Man darf auch den ganz eigen-
artigen Grundriss eines Cornetaner Grabes vergleichen
(Byres-Howard, hypogaea . . . of Tarquinia I 2 ff.,
vgl. Dennis Etruria I 3 p. 398, 4), welches eine fast
quadratische Kammer (etwa 7 X 8m) innerhalb einer
andern, und zwar mit 3—4™ breitem Umgang um die
innere Kammer enthielt.
3) Das Ustrinum in Kiepert-Hülsens Forma
Urbis Taf. II F k, die Ära Ditis G f. Vgl. Ära Pacis
S. 222 ff.
2. Die Form des Grundrisses italisch.
Der Grundriss der baulichen Anlage ist so einfach, dass es kaum berechtigt
scheint, nach Sinn und Ursprung seiner Form zu fragen. Und doch dürfte es nicht
überflüssig sein, daran zu erinnern, dass im Gegensatze zu griechischen, im all-
gemeinen mehr lang als breiten Cultusräumen die Römer oder Italiker, mit ihrer
Vorliebe für einfache Verhältnisse, ihren Heiligthümern ganz oder fast so große
Breite wie Länge zu geben liebten.1) Einfache Cellen von ganz quadratischem
Grundriss haben sich, um nur einige ältere Beispiele zu nennen, in Marzabotto
gefunden; Cella und Vorhaus haben beide ungefähr diese Gestalt in dem Tempel
von Alatri, beide auch im Tempel der Venus Pompejana, und von großgriechischen
Heiligthümern haben der ,Ceres'tempel in Paestum und der ,Apollo'tempel von
Selinus annähernd quadrate Vorhäuser. Ja, selbst wenn eine Säulenhalle den ganzen
Tempel umgibt, ist wohl der Platz vor dem Tempel ein Gevierte wie beim
pompejanischen Apollo.2)
Lanciani hat in seiner großen Forma Urbis 8 und 15 die Ära Pacis als drei
ineinander gezeichnete Quadrate eingesetzt, nicht auf Grund irgendwelcher Unter-
suchung, sondern lediglich bewogen durch die Analogie zweier kaiserlicher
Anlagen, des Ustrinum Antoninianum und der Ära Ditis.'A) Von diesen war das
Ustrinum seiner Bestimmung nach zu verschieden von der Ära Pacis, wogegen
die Ära Ditis als Altar, zumal der segenspendenden Götter der Erdtiefe ein will-
kommenes Beispiel sein würde, wenn nur der Grundriss dieser Anlage genügend
aufgeklärt wäre. Immerhin hat Lancianis Ansatz durch die jetzt erschlossene
Säulenhalle um die Altareinfriedung (S. 126 f.) in gewissem Sinne eine unvorher-
gesehene Bestätigung erhalten.
Die Abmessungen der Ära Pacis sind ja damit ganz andere geworden. Sie
kamen (S. 127) durch den erforderlichen freien Raum und Umgang zwischen dem
Zierbau und der umgebenden Halle sowie durch die Breite, welche eine Säulen-
halle nothwendig haben muss, so nahe an das alte Ackermaß eines Tagwerkes,
eines iugerum oder actus quadratus von 120 römischen Fußen ins Gevierte, dass
!) S. K. O. Müller, Etrusker II2, S. 232.
2) Marzabotto: Brizio, Mon. ant. Lincei I Taf. II
p. 22; Alatri:'Rom. Mitfh. 1889 S. 144, 1891S. 256;
Paestum, Ceres: Koldewey und Puchstein, Griech.
Tempel S. 23; Selinus, Apollon: ebenda S. 124;
Venus Pompeiana: Rom.Mitth. 1900 Taf. VII; Apollo:
Mau, Pompeji S. 73. Man darf auch den ganz eigen-
artigen Grundriss eines Cornetaner Grabes vergleichen
(Byres-Howard, hypogaea . . . of Tarquinia I 2 ff.,
vgl. Dennis Etruria I 3 p. 398, 4), welches eine fast
quadratische Kammer (etwa 7 X 8m) innerhalb einer
andern, und zwar mit 3—4™ breitem Umgang um die
innere Kammer enthielt.
3) Das Ustrinum in Kiepert-Hülsens Forma
Urbis Taf. II F k, die Ära Ditis G f. Vgl. Ära Pacis
S. 222 ff.