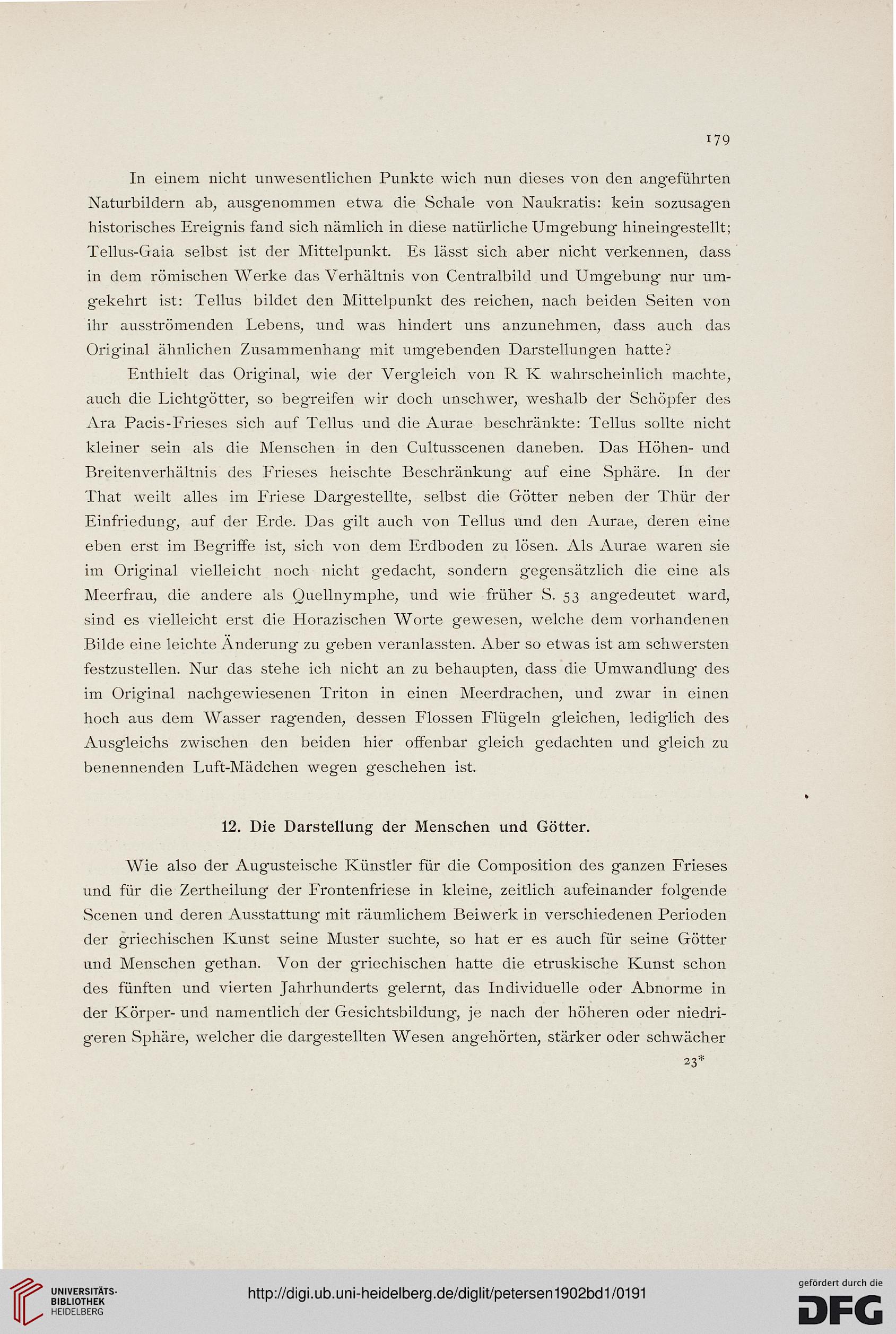179
In einem nicht unwesentlichen Punkte wich nun dieses von den angeführten
Naturbildern ab, ausgenommen etwa die Schale von Naukratis: kein sozusagen
historisches Ereignis fand sich nämlich in diese natürliche Umgebung hineingestellt;
Tellus-Gaia selbst ist der Mittelpunkt. Es lässt sich aber nicht verkennen, dass
in dem römischen Werke das Verhältnis von Centraibild und Umgebung nur um-
gekehrt ist: Tellus bildet den Mittelpunkt des reichen, nach beiden Seiten von
ihr ausströmenden Lebens, und was hindert uns anzunehmen, dass auch das
Original ähnlichen Zusammenhang mit umgebenden Darstellungen hatte?
Enthielt das Original, wie der Vergleich von R K wahrscheinlich machte,
auch die Lichtg'ötter, so begreifen wir doch unschwer, weshalb der Schöpfer des
Ära Pacis-Frieses sich auf Tellus und die Aurae beschränkte: Tellus sollte nicht
kleiner sein als die Menschen in den Cultusscenen daneben. Das Höhen- und
Breitenverhältnis des Frieses heischte Beschränkung auf eine Sphäre. In der
That weilt alles im Friese Dargestellte, selbst die Götter neben der Thür der
Einfriedung, auf der Erde. Das gilt auch von Tellus und den Aurae, deren eine
eben erst im Begriffe ist, sich von dem Erdboden zu lösen. Als Aurae waren sie
im Original vielleicht noch nicht g'edacht, sondern gegensätzlich die eine als
Meerfrau, die andere als Quellnymphe, und wie früher S. 53 angedeutet ward,
sind es vielleicht erst die Horazischen Worte gewesen, welche dem vorhandenen
Bilde eine leichte Änderung zu geben veranlassten. Aber so etwas ist am schwersten
festzustellen. Nur das stehe ich nicht an zu behaupten, dass die Umwandlung des
im Original nachgewiesenen Triton in einen Meerdrachen, und zwar in einen
hoch aus dem Wasser ragenden, dessen Flossen Flügeln gleichen, lediglich des
Ausgleichs zwischen den beiden hier offenbar gleich gedachten und gleich zu
benennenden Luft-Mädchen wegen geschehen ist.
12. Die Darstellung der Menschen und Götter.
Wie also der Augusteische Künstler für die Composition des ganzen Frieses
und für die Zertheilung der Frontenfriese in kleine, zeitlich aufeinander folgende
Scenen und deren Ausstattung mit räumlichem Beiwerk in verschiedenen Perioden
der griechischen Kunst seine Muster suchte, so hat er es auch für seine Götter
und Menschen gethan. Von der griechischen hatte die etruskische Kunst schon
des fünften und vierten Jahrhunderts gelernt, das Individuelle oder Abnorme in
der Körper- und namentlich der Gesichtsbildung, je nach der höheren oder niedri-
geren Sphäre, welcher die dargestellten Wesen angehörten, stärker oder schwächer
23*
In einem nicht unwesentlichen Punkte wich nun dieses von den angeführten
Naturbildern ab, ausgenommen etwa die Schale von Naukratis: kein sozusagen
historisches Ereignis fand sich nämlich in diese natürliche Umgebung hineingestellt;
Tellus-Gaia selbst ist der Mittelpunkt. Es lässt sich aber nicht verkennen, dass
in dem römischen Werke das Verhältnis von Centraibild und Umgebung nur um-
gekehrt ist: Tellus bildet den Mittelpunkt des reichen, nach beiden Seiten von
ihr ausströmenden Lebens, und was hindert uns anzunehmen, dass auch das
Original ähnlichen Zusammenhang mit umgebenden Darstellungen hatte?
Enthielt das Original, wie der Vergleich von R K wahrscheinlich machte,
auch die Lichtg'ötter, so begreifen wir doch unschwer, weshalb der Schöpfer des
Ära Pacis-Frieses sich auf Tellus und die Aurae beschränkte: Tellus sollte nicht
kleiner sein als die Menschen in den Cultusscenen daneben. Das Höhen- und
Breitenverhältnis des Frieses heischte Beschränkung auf eine Sphäre. In der
That weilt alles im Friese Dargestellte, selbst die Götter neben der Thür der
Einfriedung, auf der Erde. Das gilt auch von Tellus und den Aurae, deren eine
eben erst im Begriffe ist, sich von dem Erdboden zu lösen. Als Aurae waren sie
im Original vielleicht noch nicht g'edacht, sondern gegensätzlich die eine als
Meerfrau, die andere als Quellnymphe, und wie früher S. 53 angedeutet ward,
sind es vielleicht erst die Horazischen Worte gewesen, welche dem vorhandenen
Bilde eine leichte Änderung zu geben veranlassten. Aber so etwas ist am schwersten
festzustellen. Nur das stehe ich nicht an zu behaupten, dass die Umwandlung des
im Original nachgewiesenen Triton in einen Meerdrachen, und zwar in einen
hoch aus dem Wasser ragenden, dessen Flossen Flügeln gleichen, lediglich des
Ausgleichs zwischen den beiden hier offenbar gleich gedachten und gleich zu
benennenden Luft-Mädchen wegen geschehen ist.
12. Die Darstellung der Menschen und Götter.
Wie also der Augusteische Künstler für die Composition des ganzen Frieses
und für die Zertheilung der Frontenfriese in kleine, zeitlich aufeinander folgende
Scenen und deren Ausstattung mit räumlichem Beiwerk in verschiedenen Perioden
der griechischen Kunst seine Muster suchte, so hat er es auch für seine Götter
und Menschen gethan. Von der griechischen hatte die etruskische Kunst schon
des fünften und vierten Jahrhunderts gelernt, das Individuelle oder Abnorme in
der Körper- und namentlich der Gesichtsbildung, je nach der höheren oder niedri-
geren Sphäre, welcher die dargestellten Wesen angehörten, stärker oder schwächer
23*